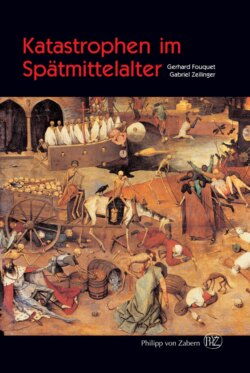Читать книгу Katastrophen im Spätmittelalter - Gerhard Fouquet - Страница 10
Die Augenzeugen und das Schadensereignis
Оглавление„Als die sieben Tage vorbei waren, kam das Wasser der Flut über die Erde, im sechshundertsten Lebensjahr Noachs, am siebzehnten Tag des zweiten Monats. An diesem Tag brachen alle Quellen der gewaltigen Urflut auf, und die Schleusen des Himmels öffneten sich. Der Regen ergoss sich vierzig Tage und vierzig Nächte lang auf die Erde.“ (Genesis 7,10–12)
Am Morgen jenes 13. Juni 1529 öffneten sich auch über Basel die „cataractae caeli“, die himmlischen Schleusen. Sturzbächen gleich brach der große Regen über die Stadt herein, das Unwetter tobte den ganzen Tag, ununterbrochen, „ohne Unterlass“, hielt der Starkregen auch noch in der darauffolgenden Nacht an. So berichtet es der Basler Zunftmeister und Ratsherr Konrad Schnitt in seiner um 1533 entstandenen Reformationschronik.38
Am Tag danach, um die neunte Stunde am Vormittag des 14. Juni brachen die Wassermassen, die ungestimmy des wassers, gleich der gewaltigen biblischen ‚Urflut‘ über die Innenstadt Basels herein. Der Birsig, ein Zufluss des Rheins, führte „in schneller Eile ein großes Wasser“ mit sich. Konrad Schnitt, der unbekannte Verfasser der Chronik des Fridolin Ryff, und Hans Stoltz aus Gebweiler berichten von diesem Schadensereignis, erzählen atemlos von der Topographie des Hochwassers:39 Die Flut des Birsigs staute sich innerhalb einer Viertelstunde, so Hans Stoltz, vor den Gattereinlässen am Steinentor, das die Steinenvorstadt nach Süden hin zum offenen Land beschirmte. Sie riss, wie bei einem Hochwasser des Jahres 1267 geschehen, als noch Reuerinnen dort lebten40, die Umfassungsmauer des Steinenklosters der Dominikanerinnen nieder und stürzte sich dann in die Vorstadt. Alle Häuser, auch das Barfüßerkloster wurden von den Wassermassen des Birsigs überschwemmt. Die Wasser eilten von der Steinenvorstadt aus in die Innenstadt, rauschten die Gerbergasse hinunter, vorbei am Wirtshaus zum Schnabel, sie stauten sich, Holz, Zweige, Stämme, benck und trög, auch ganze Brückenteile, mit sich führend, an den Dolen, den teilweise überdeckten Kanälen, des Birsigs auf Korn- und Fischmarktplatz. Die Flut schoss über die Dolen hinaus, an der Schiffslände bei der Rheinbrücke zwischen den Wirtshäusern bim Blumen und by der Cronen ergoss sie sich endlich in den Rhein – eine alles unter sich begrabende Wasserfurie, ein erschrockenlich wasser, so Konrad Schnitt. Die gesamte untere Stadt zwischen den Hügeln, auf denen Basel erbaut ist, war nach dem Verfasser der Chronik des Fridolin Ryff etwan by zwo stund lang überflutet.
„Das Wasser schwoll an und stieg immer mehr auf der Erde (…).“ (Genesis, 7,18)
Der Birsig entspringt im Jura am Nordhang der Blauen-Kette, fließt von Süd nach Nord durch die unteren Stadtteile Basels und mündet an der Schiffslände in den Rhein. Die Häuserzeilen entlang der Steinenvorstadt und der Gerbergasse waren direkt an den damals noch offenen Flusslauf gebaut, zahlreiche Brücken, Stege und Gewölbe überspannten ihn. Auf Korn- und Fischmarkt hatte der Rat den Birsig überbauen und eindolen lassen. Der Fluss war zu Beginn des 16. Jahrhunderts noch ein Wildwasser, vor den Toren Basels ohne festes Bett, mit Kiesbänken und Inseln, die die ‚Allmend‘ bildeten. Innerhalb der Stadt diente der Birsig Basel als ‚große Kloake‘, wie ihn Enea Silvio Piccolomini nannte. Fäkalien und Abwässer aus den Abtritten der anstoßenden Häuser, Einleitungen der umliegenden Stadtquartiere – allen Unrat der Stadt nahm der Fluss auf und schwemmte ihn in den Rhein.41
Am 14. Juni 1529 hatte das Birsigwasser, das sonst den Schmutz der Stadt glücklich hinwegtrug, Unglück nach Basel getragen. Das Hochwasser habe sich ungefähr manshoch in den Gassen und den Häusern gestaut, berichtet Konrad Schnitt. So groß und starck sei es gewesen, dass es ein beladenes Schiff hätte tragen mögen. Der unbekannte Verfasser der Chronik des Fridolin Ryff, auch er wie Schnitt ein Augenzeuge der großen Flut und wahrscheinlich seit 1528 Angehöriger des Großen Rates, hatte genauer hingeschaut: In der Steinenvorstadt, so schreibt er, habe das Wasser über Mannshoch gestanden – mit der Hand habe ein Mann, der uff dem herdt stund, die Wasserhöhe ermessen können. In der Gerbergasse und auf dem Fischmarkt, wo sich die Flut bis zum ‚Wirtshaus zur Krone‘ an der Schiffslände am Rhein einem ‚See‘ gleich darbot, war das Wasser nach den Beobachtungen des Anonymus dagegen eins halben mans hoch, am Rathaus hatte es sich eins mans hoch aufgestaut.