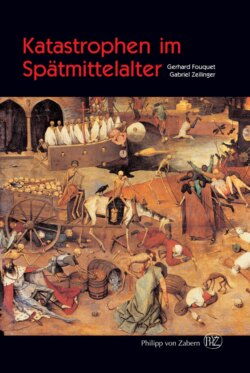Читать книгу Katastrophen im Spätmittelalter - Gerhard Fouquet - Страница 7
Mittelalterliche Menschen in ihrem „gefährdeten Alltag“9
ОглавлениеWesentlich ungeschützter als in den Industrieländern unserer Zeit waren die Menschen im europäischen Mittelalter den physischen Konsequenzen von Wetter- und Witterungskapriolen, von Erdbeben und Bränden, von Epidemien und Kriegen ausgesetzt. Trotz aller mittelalterlichen Dynamik u. a. in Landwirtschaft, Landesausbau und Urbanisierung waren die Lebensbedingungen in jener Epoche weithin hart: „Der Ablauf des Menschenlebens blieb das ganze Mittelalter hindurch von Eingriffen von Natur und Geschichte aufs höchste gefährdet“.10 So kann es nicht wundern, dass in vielen Chroniken der Epoche Nachrichten über Frost und Fluten, Hagel und Hunger gleich neben Königskrönungen und Kirchenspaltungen stehen. „Winterkälte [war eben] für die Menschen mehr als Zähneklappern in dünnwandigen Häusern“.11 Dies gilt im Besonderen für den bäuerlichen Lebenskreis, in dem das Leben in der, mit der und oft genug auch gegen die Natur zu gestalten, ja zu behaupten war. Die karolingischen Reichsannalen geben für das Jahr 820 an, eine überaus feuchte Witterung habe zur Folge gehabt, dass „unter Mensch und Tier“ fast im ganzen Frankenreich eine heftige Seuche grassierte: „Auch das Getreide und Gemüse ging bei dem fortwährenden Regen zugrunde und konnte entweder nicht eingeheimst werden oder es verfaulte in den Scheuern. Nicht besser stand es mit dem Wein, der in diesem Jahre einen höchst spärlichen Ertrag gab und dabei noch wegen des Mangels an Wärme herb und sauer wurde. In einigen Gegenden aber war, da das Wasser von den ausgetretenen Flüssen noch in der Ebene stand, die Herbstaussaat ganz unmöglich“. Auch im Jahr darauf wurde die Lage nicht besser und zu alldem kam noch ein sehr kalter und langer Winter.12 Die Auswirkungen für die Ernährungslage und körperliche Verfassung der Menschen müssen in der Folge verheerend gewesen sein – eine drastische Zunahme von Krankheit und Tod in Westeuropa!
Die Mönche, die in der nordfranzösischen Abtei St. Bertin die Reichsannalen fortschrieben, notierten im Jahr 846: „Während des ganzen Winters bis fast zum Anfang des Mai herrschte ein heftiger Nordwind zum Schaden der Saaten und Weingärten. Im unteren Gallien fielen eindringende Wölfe mit größter Frechheit die Menschen an“.13 Die früh- und hochmittelalterliche Erfahrung der Rodung und des Lebens in den noch weiten Waldgebieten des Kontinents, der mühseligen Urbarmachung des Landes, der bescheidenen Anfänge von Dörfern war dabei wohl mentalitätsprägend: „Angst war eine Grunderfahrung des bäuerlichen Daseins“14 im Mittelalter.
Solche über Jahrhunderte hinweg zu Lebensformen geronnenen Erfahrungen scheinen in der Jenseitsvision des holsteinischen Bauern Gottschalk vom Ende des 12. Jahrhunderts auf, die in zwei von Klerikern verfassten Versionen überliefert ist: Gottschalk war Ende 1189 schon ein alter und kranker Mann, als er – in das Bauernaufgebot Heinrichs des Löwen gezwungen – bei der Belagerung der Burg Segeberg das Bewusstsein verlor und für fünf Tage leblos dalag. Doch seine Nachbarn nahmen ihn auf einem Karren wieder mit in das Heimatdorf Harrie bei Neumünster, wo er sich vorübergehend wieder erholte und allen, die es hören wollten, seine Nahtodvisionen erzählte. Seine Schilderung der Jenseitslandschaft wurde zwar von den aufzeichnenden Kirchenmännern zu einer bäuerlichen ‚via dolorosa‘ stilisiert, doch sie ist eben auch die transponierte Erfahrung seines bäuerlichen Lebens im Rodungsland Holsteins. Gottschalks Weg durch das Jenseits war nämlich genauso mühsam wie sein Leben und Arbeiten im diesseitigen Alltag: Der Bauer ging barfuß, zunächst über eine weite Heidefläche voller Dornen. Endlose Qualen teilte Gottschalk mit denen, die mit ihm durch dieses Distel- und Dornenfeld wandelten: „Manchmal wälzten sie sich sogar wie ein gefällter Stamm eine Weile hin und her, und wenn sie sich dann ein bißchen auf den Knien aufrichteten, vor dem rasenden Schmerz die Hände unter beide Knie schoben, um sie zu stützen, und unter ärgsten Qualen weiterkrochen, dann schmerzten ihnen nun auch die zerstochenen Hände von der Peinigung. Und standen sie auf und versuchten sie weiterzugehen, dann zerstachen sie sich bei jedem Schritt ebenso die Füße und brachen erneut zusammen; und so brachten sie in einem tränenreichen Auf und Nieder diesen Weg des Schreckens hinter sich“.15
Besser ließ sich ein Fluss überwinden, der in Gottschalks Vision von eisernen Schneiden und Spitzen starrte. Er sei auf einem schmalen, langen Balken hinüberbalanciert. Das war ihm durch sein Erdendasein wohl vertraut, denn vermutlich hatte er beim Bau so mancher Brücke helfen müssen. Dann geriet Gottschalk an einen abschüssigen Hohlweg, voller Morast und Gestank, schmerzhaft stiegen ihm die Ausdünstungen zu Kopf. Schließlich gelangten der Bauer und seine Begleiter zu einem brennenden Landstück, einem Flächenbrand von schier unsagbarer Hitze und Grauen: Alles „brannte in sich selbst, aus sich selbst und durch sich selbst“.16 Was Gottschalk hier im Jenseits sah und erlebte, so darf man annehmen, war ein Spiegel der Eindrücke seines Lebens, das zu Zeiten ein vorweggenommenes Fegefeuer gewesen sein muss. Der Himmel, den Gottschalk nach dieser Drangsal erblickte, konnte für ihn nur eine Stadt sein – eine Stadt mit breiten, guten Straßen und schönen Gebäuden, eben wie die den Zeitgenossen bekannte Vorstellung vom ‚himmlischen Jerusalem‘. Die sich ausbildenden Eliten der um 1200 in ganz Europa entstehenden und wachsenden Städte strebten wohl nach diesem geläufigen Idealbild, aber ihre Anfänge waren oft eher rudimentär, auch wenn sie manchem Landmann Bewunderung abnötigten.17
Doch selbst wenn man wie die Führungsgruppen in den inzwischen wohlbewehrten und vergleichsweise dicht bebauten Städten des Spätmittelalters den Unbilden der Natur weniger krass ausgesetzt war als die vielen Armen in der Stadt oder auf dem Land, blieben die natürlichen Unwägbarkeiten doch stets präsent und waren gefürchtet – nicht zuletzt wegen ihrer potentiellen sozialen Folgen. Gleichzeitig war die Erinnerung der Gemeinde an Katastrophen aber auch ein, wenn nicht das gemeinschafts- und identitätsstiftende Moment in vormodernen Städten.18 So ist die sogenannte Würzburger Ratschronik des 15. und 16. Jahrhunderts voll von Nachrichten über Epidemien, extreme Wetterverhältnisse und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen: Für das Jahr 1481 wurde notiert, dass es wegen des vorangegangenen strengen Winters nur wenig Wein gab, weil „hier und anderswo die Weingärten am Hang und im Tal erfroren waren“. Zudem sei im ganzen Land vielfache Teuerung bei den Getreidepreisen entstanden, was sogleich eine Hungersnot nach sich ziehen musste. Nur durch energische Eingriffe der bischöflichen Herrschaft und des städtischen Rates konnte diese gemäßigt werden. Zwei Jahre später hingegen sah die Lage ganz anders aus: 1483 „gab es ausreichend Wein und Brot, weshalb ich,“ schreibt der Chronist, „Gott Lob, Ehr und Dank sage“.19 Freilich war es so eine Sache mit dem Verhältnis von Natureinwirkung und Preisen im 15. Jahrhundert. Gleich zu Beginn der Chronik notierte der Schreiber: „Es ist ein Sprichwort, […] dass es nichts Besseres als Sterben [durch Seuchen], Krieg führen und erfrorene Weinstöcke gebe. Und das mag wohl wahr sein, denn sollte in zehn Jahren niemand sterben, würde eine solche Not in der Welt herrschen, dass jedermann sich sorgte, er müsste vor Hunger sterben“20: die Überlebenden von Epidemien als Nutznießer der durch Nachfragerückgang sinkenden Preise – ein nicht nur aus den Ereignissen der ersten Pestpandemie 1348/52 wohl bekanntes Phänomen, wie wir noch sehen werden!