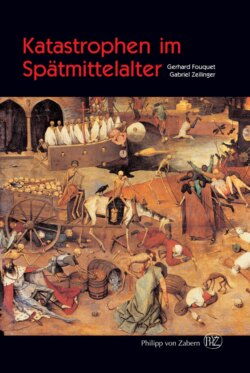Читать книгу Katastrophen im Spätmittelalter - Gerhard Fouquet - Страница 15
Basel, der Rhein und seine Nebenflüsse – Hochwasser und Eisgänge
ОглавлениеBasel lebte mit dem Rhein wie alle Städte und Dörfer, die in seinem Einzugsbereich und in dem seiner Nebenflüsse lagen. Der Fluss war ‚nützlich‘, er diente dem Transport von Menschen und Tieren, von Waren aller Art, er war die Schlagader des Handels. Man benutzte ihn auch als Kloake, in den die Abwässer direkt oder über die Zuflüsse geleitet wurden. Doch muss man sich vor wohlfeilen Bildern eines total verschmutzten Flusses hüten. Denn Fischer fristeten ihr Dasein vom Fischreichtum des Rheins, allen voran vom Salm – das Wasser schien zu kochen, wenn die atlantischen Winterlachse den Rhein hoch zu ihren Laichgebieten zogen. Die ‚Entsorgung‘ fast des ganzen Basler Stadtgebiets über den Birsig war eben ein Sonderfall, der Katastrophe geschuldet. Überdies: Auf dem Rhein führten Flößer große Holzverbände den Rhein hinunter nach Köln. Andere suchten ihr Glück an den Ufern des Stromes zu machen, Rheingold zu finden, das schon das Nibelungenlied besingt. Der Rhein war zugleich Quelle von Gefährdungen für die Anwohner: In Basel war der Fluss Ort von Bestrafungen und Hinrichtungen. Die Leichen von Selbstmördern wurden von der Brücke aus in den Fluss geworfen, der Rat ließ Diebinnen im Rhein ertränken, Gotteslästerung, Ehebruch oder Frauenraub wurden mit der Ehrenstrafe des sogenannten Schwemmens bedroht.58 In den Rhein zog es auch Menschen, die ihrem Leben ein Ende machen wollten, und im Rhein ertranken Unglückliche, die ein zufälliges, grausames Schicksal geschlagen hatte. Johannes Gast, seit 1529 neugläubiger Diakon zu St. Alban in Basel59, beobachtet in seinem nur in wenigen abschriftlichen Auszügen erhaltenen, lateinisch verfassten Tagebuch jene Misslichkeiten des irdischen Jammertales: Im Januar 1545 notiert er, dass eine schwermütige Frau, vom Teufel getrieben, sich in der Nacht in den Rhein gestürzt habe und dabei zu Tode gekommen sei. Im Juli des nämlichen Jahres ertrank im Rhein auch Siegfried, ein Dichter aus Wolfenbüttel. Er habe sich, so Gast, „unvorsichtig“ in den tiefen Fluss gewagt, „obschon er nicht zu schwimmen verstand“. Um Hilfe schreiend sei er in den Fluten untergegangen. Und im Januar 1546 sah Johannes Gast „ein leeres Schiff […] umgekehrt rheinabwärts“ auf Basel zutreiben. Als das Schiff kenterte, hätten „sich der Schiffer und der Schiffspatron“ gerettet, „während eine Frau und zwei Kinder untersanken und ertranken“.60
Wie der Birsig so führte auch der Rhein zahlreiche Hochwasser. Nicht umsonst ist die Geschichte der um 1225 erbauten Basler Holzbrücke über den Rhein als „eine Folge von Katastrophen“ bezeichnet worden.61 Und so sind denn auch die Stadtchroniken voll von diesen Schreckensgeschichten: Ende Juni 1275 beispielsweise zerstörte ein Rheinhochwasser zwei Joche der Brücke, einhundert Menschen sollen dabei ertrunken sein.62 Die ‚Größeren Jahrbücher von Colmar‘ berichten vom Rheinhochwasser am 4. August 1302: Die Fluten hätten einen Teil der Basler Brücke mit sich fortgerissen und in Breisach den Rheinübergang zerstört. In Straßburg sei das Wasser in viele Keller geströmt. Einer der Bürger hätte bei dieser Gelegenheit in seinem Gewölbe einen lucium magnum, einen kapitalen Hecht, gefangen. Einhundert Jahre später sollen bei einem Eisgang im Februar 1407 alle Brücken Basels zerstört worden sein.63 Das südliche Oberrheingebiet scheint dagegen von dem „hydrologischen ‚Gau‘“ des Jahres 1342 nicht betroffen gewesen zu sein. Es war die größte historisch bezeugte Hochwasserkatastrophe Mitteleuropas mit gravierenden Einflüssen auf die Oberflächengestaltung wie tiefen Erosionsrinnen, die selbst heute noch die Landschaft prägen.64 Die Basler und Straßburger Quellen berichten freilich von einem große[n] waßer 1343, im Jahr danach. Nach der Straßburger Chronik des Fritsche Closener kam es sogar im Juli und August jenen Jahres zu zwei ganz außergewöhnlichen Rheinhochwassern. Acht Tage lang hätte der Fluss bei der ersten Überschwemmung im Juli die Stadt drangsaliert.65
Die nachstehende Übersicht über die Wassernöte auf Rhein, Wiese, Birs und Birsig ist dagegen vornehmlich aus den nüchternen Einträgen in den Wochenausgabenbüchern des Basler Rates zwischen 1445 und 1549 gewonnen. Die erschreckend dichte Abfolge von Gefährdungen und Katastrophen besonders in den genannten Kälteperioden mit großem Schneereichtum zwischen 1475 und 1497 sowie von 1511 bis 1520 verdeutlicht sehr eindringlich diesen ständigen Kampf des Menschen gegen eine ungnädige Natur.66 Doch selbst noch in der exzeptionellen Warmphase nach 1530 blieb Basel den Launen des reißenden Stromes und seiner Nebenflüsse ausgesetzt, den Eisgängen und Hochwassern – dem großen waßer, dem großen Rhein, dem starcken Rhein. Nahezu pausenlos war an der Rheinbrücke wie auch an den übrigen Stegen über Birs, Birsig und Wiese zu reparieren. Da solche Arbeiten städtisches Geld verschlangen, haben sich Nachrichten über die Schadensereignisse in den Ausgabenbüchern des Rates erhalten. Ungebärdig gab sich nicht nur der Oberlauf des Rheins, auch viel weiter stromabwärts versetzte der Fluss seine Anwohner in Angst und Schrecken. Große Hochwasser bzw. Eisgänge hielten beispielsweise Köln in den Jahren 1489, 1491, 1496 und 1503 in Atem. Der Augenzeuge Hilbrant Suderman notierte sie in seinem Tagebuch.67 Gelegentlich sorgte die ungezügelte Natur zugleich auch für willkommene Abwechslung im täglichen Einerlei. Als 1565 in Köln ein Eisgang große Schäden verursachte, sollen nach den Aufzeichnungen des Kölner Juristen Hermann Weinsberg an einem einzigen Tag 2.000 Neugierige den Turm des Rathauses bestiegen haben: Man wollte das Schauspiel von Eis und Wasser sehen.68
Die Unbilden des Rheins machten auch manche Schifffahrt zu einer abenteuerlichen und beschwerlichen Reise. Als sich am 15. August 1480 Basler Adlige mit ihren Pferden zu einem Turnier nach Mainz einschifften, um sich auf dem bequemen Schiff mit lustvollem Spiel die Zeit zu vertreiben, gerieten sie in ein Hochwasser. Dessen riesige Verwüstungen „an ganzen Dörfern, Kirchen, Äckern, Weiden, Holzungen und Wäldern, an Leuten und Gütern“ bestaunte die illustre Gesellschaft offenbar vom Schiff aus. Ein „großer Schrecken“, so der Verfasser dieses Berichts aus dem Hausbuch der Herren von Eptingen, sei „in allen Landen“ gewesen.69 Die Chronisten übertreiben bei der Beschreibung der Rheinhochwasser keineswegs: Das direkt am Rhein liegende Neuenburg wurde nachweislich durch Hochwasserschäden katastrophalen Ausmaßes wie beispielsweise in den Jahren 1451 und 1496 sowie im Februar 1502, wo Teile des Städtchens hinweggespült wurden, ruiniert. Da halfen nur noch großzügige Abgabennachlässe von Seiten des habsburgischen Stadtherrn und finanzielle Hilfen des benachbarten Freiburg.70 Doch nicht nur der Rhein, auch andere Flüsse und Bäche hielten spätmittelalterliche Städte in Atem: Würzburg beispielsweise bedrohten die Mainhochwasser im August 1342, als unter der Gewalt der Jahrtausendüberschwemmung die Brücke einstürzte. Wasserunbilden kamen im Juni 1433 und im März 1445, im Februar 1451 mit sehr großen Schäden, im Juli 1484 sowie in den Jahren 1486/87 und 1512.71