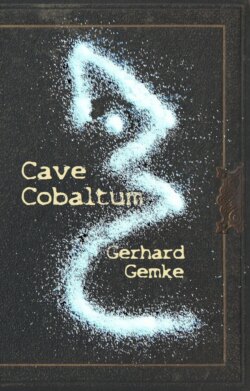Читать книгу Cave Cobaltum - Gerhard Gemke - Страница 5
3
Оглавление„Wie willst du sterben?“
Die Stimme des Alten war kaum zu hören und breitete sich in der vollkommenen Dunkelheit wie eine unsichtbare Schwingung aus. Selbst bei Licht war der Alte kaum von der steinernen Umgebung zu unterscheiden und mancher Tourist war schon nichtsahnend an ihm vorbeigeschlichen. Als er sich jetzt nach vorn beugte, schien es, als erwachte der Fels zum Leben.
Bo atmete tief und verzog keine Miene. Seit der Alte ihn zum Lord der Helldor-Kobolde ernannt hatte, war er in unregelmäßigen Abständen sein Gast gewesen, trotzdem hatte er sich nicht an diesen Anblick gewöhnt. Auch nicht an das scharfe Knacken, das die Bewegungen des Alten begleitete. Wie knisterndes Salz, das zu lange in den unbenutzten Gelenken verharrt hatte. Ein betäubender salzgetränkter Geruch ging von ihm aus.
„Der unsichtbare Tod ist schrecklich.“
Bo schwieg. Der Alte war, so wurde erzählt, über sechshundert Jahre alt, und die Gelegenheiten ihm zuzuhören würden seltener werden.
„Ich bin fast blind, aber ich höre besser als ihr alle. Ich höre das Echo, das durch das Salz läuft. Ich weiß, dass der Graf es nicht aufgegeben hat, es nie aufgeben wird. Die alten Geschichten nagen an ihm wie Ratten an einem Kadaver. Er will sich rächen und er versucht es wieder, jetzt in diesem Augenblick. Er hat einen neuen Verbündeten.“
Bo wartete regungslos, während der Alte schweigend in ein fernes Nichts starrte. Der unsichtbare Tod, der mit den strahlenden Fässern in Helldor einziehen würde.
„Er nennt es Operation Bergfrieden.“
Bo nickte. „Ihr seid euch sicher, dass der Graf dahintersteckt?“
Langsam drehte sich der Kopf des Alten, bis seine hinter den schmalen Schlitzen kaum wahrnehmbaren Augen auf Bo gerichtet waren.
„Ich weiß es. Und ich weiß, dass wir uns nicht wehren können. Nicht wie früher.“
Nicht wie früher, ergänzte Bo in Gedanken, als der alte Lord noch lebte und eine mächtige Waffe besaß.
Der Alte deutete ein Nicken an, als hätte Bo seine Gedanken laut ausgesprochen. „Niemand weiß, wo sie jetzt ist. Auch der Graf nicht. Andernfalls hätte er uns längst vernichtet.“
Bo betrachtete die verwitterten Steingestalten ringsum. Ihm war, als bewegten sie sich, als schlichen sie in den Berg hinein, die dreiunddreißig Croggs. Leise flüsterten sie, hielten inne und lauschten. Tief aus dem Fels drangen Schreie, mal lauter, mal weiter entfernt. Dann krachten Schüsse, gefolgt vom Sirren der Querschläger.
Plötzlich tauchte am Stolleneingang ein gebückter Kobold auf und hastete an den Croggs vorbei. Es war Albion, der alte Lord des Helldor-Stamms. Woher er kam? Von der Müllerin, raunten die Croggs, der schönen, und ihr Kind werdet ihr an dem Schmetterling auf ihrer Schulter erkennen, dem Mal, von der Mutter vererbt. Solche Dinge flüsterten die Croggs, während sie dem Lord ängstlich nachblickten, bis er im Dunkel der Stollen verschwunden war, um seinem Volk in der Stunde der größten Gefahr beizustehen.
Vom Weißenhaller Kirchturm wehten zwölf dumpfe Schläge herüber und waren bis hier unten zu hören. Mitternacht. 1941, das zweite Jahr des schrecklichen Krieges brach an. Die Croggs drängten sich eng zusammen und riefen ihre Namen in abgesprochener Reihenfolge in die Dunkelheit. Der letzte fehlte, der kleine Ragadisch, er war dem Lord in den Bauch des Berges gefolgt.
Ragadisch drückte sich in eine Nische, die das unermüdliche Wasser in den Salzstein gewaschen hatte. Fast zum Greifen nah kämpfte Lord Albion, richtete die Faust mit der Zauberkugel auf seine Gegner und schrie das Wort gegen das Getöse der Gewehre an. Wäre der Lord nicht gekommen, keiner seiner Leute hätte das Gemetzel überlebt. So aber stockten immer mehr Angreifer mitten in der Bewegung, versuchten unter namenlosen Schmerzen sich weiterzubewegen, bis sie schließlich zu Stein gefroren, einer nach dem anderen.
Ragadisch riss seine Augen erschrocken auf. Die Versteinerten waren Männer aus Weißenhall, er hatte sie gesehen, vor der Kirche, wenn er um ein Almosen bettelte. Aber da waren noch andere. Kobolde vom Mordent-Stamm. Schon stürmten sie in einer neuen Angriffswelle heran – jedoch ohne ihren Anführer, den sie Graf nannten. Auch sie hatten keine Chance gegen den mächtigen Helldor-Lord.
Da hörte Ragadisch ein anderes Geräusch. Ein leises Knirschen wie Salz unter einer Stiefelsohle. Hinter ihm. Fast gleichzeitig wurde er von einem Schlag auf den Schädel nach vorn geworfen. Im letzten grellen Blitz, den sein Sehnerv ihm vor der unendlichen, alles verschlingenden Finsternis durchs Gehirn jagte, sah er den Pfeil. Einen eisernen Koboldpfeil. Wessen Bogensehne er verlassen hatte, würde für immer unbekannt bleiben. Ragadisch dachte noch, wie schade es war, dass der Pfeil sich ausgerechnet in den Rücken des Lords bohrte. Dann dachte Ragadisch nichts mehr.
Schwarze Stiefel stiegen über Ragadischs leblosen Körper. Ein schwerer Mann näherte sich Albion, dem sterbenden Lord der Helldor-Kobolde.
„Albion“, sagte der Mann, „ich bin dein Freund.“
Albion versuchte mit der Hand den Pfeil in seinem Rücken zu erreichen. Er sackte noch weiter in sich zusammen, aber er klagte nicht, kein Stöhnen verließ seine Lippen. Hatte er ihn erkannt, den Bürgermeister von Weißenhall?
„Ich habe davon nichts gewusst“, flüsterte der Mann und wies mit den Augen auf das Schlachtfeld. „Ich kam, um dem Morden ein Ende zu bereiten. Du kannst mir vertrauen.“
„Hilf mir“, flüsterte Albion und streckte ihm seine blutverschmierte Hand entgegen. Darin glitzerte die Kugel. „Nimm sie und sprich das Heilende Wort.“
Der Mann trat näher und lächelte. „Das ist deine letzte Chance.“
„Ja.“ Albions Stimme war kaum mehr zu verstehen.
Vorsichtig nahm der Mann die Kugel aus den schon kraftlosen Fingern des Lords. „Und wie lautet das Heilende Wort?“
Er beugte sich tief zu Albion hinunter. Als er sich wieder aufrichtete, war das Lächeln aus seinem Gesicht verschwunden. Leise, fast sanft klang seine Stimme. „Hast du nicht eben ein anderes Wort zu meinen Leuten gesagt?“
Albion starrt Bruno Bronsky mit ausdruckslosen Augen an.
Die zweiunddreißig Croggs lauschten den näherkommenden Schritten. Sie klangen nicht nach Ragadisch. Und sie gehörten auch nicht Ragadisch. Panisch versuchten sie zu fliehen, aber Bronskys Stimme dröhnte in ihrem Rücken und das Wort brachte den Steinernen Tod. Bronsky lachte und rief es immer wieder, schrie und lachte. Und rannte an den sterbenden Croggs vorbei zum Ausgang. Lange noch hallte sein Gelächter bis in die dunklen Stollen, in denen die Todesschreie allmählich verstummten.
Als am nächsten Tag eine tief gebeugte Gestalt mit zerfurchtem Gesicht an ihnen vorbeischlich, regte sich keiner mehr. Der Graf tastete sich in den Helldor-Stollen, bis er Lord Albion fand. Und zuerst mit Erstaunen, dann mit Schrecken sah er, dass die Kugel nicht mehr in Albions Hand war. So schnell es seine gebrechlichen Knochen erlaubten, eilte Graf Kronk wieder aus Helldor hinaus. Er hatte einen bösen Verdacht. Er würde Bronsky zur Rede stellen, besser noch, er würde ihn aus dem Weg räumen. Räumen müssen. Er brauchte die Kugel.
Nur ein einziger Zeuge hatte Bronskys Mord und Kronks Besuch beobachtet. Der Zeuge war schon 1941 uralt und nicht mehr von den Salzfelsen zu unterscheiden gewesen. Jetzt schaute dieser Alte den Kobold an, den er nach Albions Tod zum neuen Lord von Helldor bestimmt hatte.
„Was gedenkst du zu tun?“
Bo erwachte wie aus einem Traum. Er starrte den Alten an. Der hatte ihm diese Szenen vor das innere Auge geschickt. Und jetzt stellte er die Frage, die Bo am meisten fürchtete, die schwerste, aber sie musste beantwortet werden. Bo zögerte.
„Warte nicht zu lange.“
Mit kaum wahrnehmbarer Geschwindigkeit glitt der Alte wieder in seine ursprüngliche Position zwischen den Felsen zurück. Bald war er nicht mehr vom umgebenden Gestein zu unterscheiden. Als seine Bewegung zum Stillstand kam, war auch Bo verschwunden. Nur die regungslosen Croggs harrten in der Dunkelheit, wie eine ewige Anklage, wie eine Armee von Kriegern, die geweckt werden wollte um Rache zu nehmen.
Jade starrte in die Dunkelheit vor ihrem Fenster. Morgen stand in aller Frühe die Fahrt nach Fleschbeck an, die Heribert Meier angeordnet hatte. Der Schlüssel in dem Couvert gehörte ausgerechnet zu dem Dienstwagen, den Jade hasste wie die Pest, bei dem die Kupplung so schlecht eingestellt war, dass sie die Karre garantiert abwürgte, noch ehe sie den Behörden-Parkplatz verlassen hatte, sehr zum Ergötzen der Kollegen. Und Kolleginnen. Angeblich war die Reparatur zu teuer und lohnte sich nicht mehr, doch Jade wurde den Verdacht nicht los, dass man sie mit Absicht unterließ. Warum war klar.
Jades Augen brannten. Sie stellte den Wecker auf halb sechs und warf den Schlüssel in ihre Handtasche. Ein paar Stunden Schlaf mussten jetzt her, dringend. Sankt Orbit schlug eins, Mittwoch vor Ostern.
Sie konnte sich nicht erinnern geschlafen zu haben und war um kurz nach fünf duschen gegangen. Noch vor Morgengrauen hatte sie den Peugeot vom Parkplatz der Behörde abgeholt und war ohne Probleme bis zur Autobahn gekommen. Ausgerechnet wenn das mal klappte, schaute kein Schwein zu. Nicht mal Anita Behrli.
Ihr Auftrag lautete, in Fleschbeck Akten aus dem Stadtarchiv zu besorgen. Normalerweise wurde für so etwas einer der Praktikanten geschickt. Die Frage lag nahe, was Meier heute vorhatte, ohne dass Jade ihm auf die Finger schauen sollte. Unter anderen Umständen wäre ein Tag außerhalb des stickigen Büros und weit weg von Meiers Achselschweiß ein Geschenk gewesen. Und tatsächlich besserte sich ihre Laune mit jedem Kilometer, den sie zwischen sich und Weißenhall brachte.
Die Fahrt verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle, sah man von den üblichen Macken des Peugeots ab. Zum Beispiel dass das Bremspedal erst reagierte, wenn man es fast bis zum Anschlag durchtrat. Aber dann bremste die Karre doch.
Fleschbeck war ein kleines Kaff, etwa 30.000 Einwohner, endlose Reihen von geranienverzierten Fenstern, ein Fußball- und ein Schützenverein, sowie ein Problemviertel mit zwölfgeschossigen Wohneinheiten – die übliche provinzlangweilige Mischung, siebzig Kilometer nördlich von Weißenhall. Jade erreichte ihr Ziel bereits gegen halb zehn und erfuhr, dass man sie nicht so früh erwartet hatte. Der Kurier mit den Akten, so wurde ihr mitgeteilt, träfe erst gegen Mittag ein. Sie könne ja solange das schöne Städtchen besichtigen. Jade war alles recht, sie hatte keine Eile. Meier hatte ja gesagt, sie könne den restlichen Tag freinehmen und den Peugeot erst morgen zurückbringen. Als ob er die Verzögerung in Fleschbeck geahnt hätte.
Jade verbrachte die Mittagsstunden in der Altstadt, die ihre spezielle Freundin Anita Behrli aus der Rechnungsprüfung sicher herzig genannt hätte, die Jade allerdings wie eine Horror-Puppenstube vorkam. Überall Zuckerbäckerstil, besonders die um die Gunst der Touristen bettelnden Restaurants. Trotzdem war der Salat mit den gebratenen Hühnchenstreifen okay und der Nachtisch-Espresso bekämpfte halbwegs Jades Müdigkeit.
Gegen 13 Uhr sagte man ihr in der Stadtverwaltung, dass der Kurier angerufen hätte. Reifenpanne. Jade wagte nicht zu fragen, ob es sich um einen Auto- oder einen Fahrradreifen handelte. Es würde wohl noch mindestens zwei weitere Stunden dauern, so wurde ihr achselzuckend mitgeteilt, bis die gewünschten Akten einträfen. Ob man Jade ein Stück Kuchen anbieten dürfe?
Jade lehnte ab und machte sich erneut auf den Weg. Diesmal nicht in die Zuckerbäckeraltstadt, sondern Richtung Problemviertel. Fast beruhigend, dass auch dieses sauber rausgeputze Städtchen eine Kehrseite besaß. Jenseits eines vierspurigen Straßenrings fanden sich die üblichen Siebzigerjahre-Bausünden, inklusive besprayter Mauern und Gestalten, die alles cool fanden, was aus amerikanischen Trash-Serien via TV in die Wohnzimmer schwappte. Manche grienten ihr offen ins Gesicht oder taxierten ihre Brüste, andere erschraken beim Anblick ihrer Narbe. Meistens hasste Jade so ein Spießrutenlaufen, aber manchmal, und in der letzten Zeit häufiger, suchte sie absichtlich diese Situationen. Sie stärkten ihre Leck-mich-Haltung. Jade genoss es, wenn einige vor ihrem Gesicht zurückwichen. Gerade die Coolen.
Nur einer war ihr unheimlich. Er war lang und dürr, trug schwarze Jeans und schwarze Lederjacke, und lehnte an einer baufälligen Mauer. Das Auffälligste an ihm war sein hervorstehendes unrasiertes Kinn, das ihm etwas Wölfisches verlieh. Seine tiefliegenden Augen starrten Jade ohne zu blinzeln an. Jade versuchte möglichst lange seinem Blick standzuhalten, gab dann aber auf und schaute zu Boden. Und ärgerte sich auf der Stelle über die Unterwerfungsgeste. Fast körperlich spürte sie sein Grinsen, als sie im Abstand von zwei Metern an ihm vorbeiging. Sie beschleunigte ihre Schritte und wagte erst an der nächsten Straßenkreuzung sich umzuschauen. Von dem Wolf war nichts mehr zu sehen.
Dafür stand sie nun vor einem Wohnblock, der sich erstaunlich von der allgemeinen Tristesse abhob. Wie eine Insel in all dem Grau-in-Grau erhob sich ein fünfgeschossiger Bau mit steil aufragendem, von Gauben mit buntbehängten Fenstern unterteiltem Dach. Über die gesamte Fassade zog sich das Bild eines riesigen Regenbogens, und davor befand sich eine Wiese mit zwei Fußballtoren, umsäumt von geschwungenen Blumenrabatten. Als dann noch lachende Kinderrufe zu hören waren und ihr von einem sonneblumenbestandenen Balkon eine Art Hobbitfrau in schottengemusterter Schürze zuwinkte, war es Jade zu viel der heilen Welt / wurde Jade die Überdosis heile Welt zu viel. Hastig drehte sie sich um und machte sich auf den Weg zurück zur Stadtverwaltung. Der Kurier mit den Akten musste inzwischen eingetroffen sein.
Dem Wolf begegnete sie nicht wieder. Noch nicht.
Jade sang während sie fuhr, was ihr so selten passierte, dass sie sich nicht an das letzte Mal erinnern konnte. Gegen halb fünf war der Kurier endlich angekommen, zu Fuß, wie Jade erstaunt feststellte. Sie hatte drei dünne Mappen in Empfang genommen, quittiert und keinen Blick hineingeworfen. Der Inhalt interessierte sie nicht. Eine Angestellte der Stadtverwaltung hatte ihr einen dünnen Kaffee und ein Stück Nusskuchen aufgeschwatzt und Jade hatte diesmal nicht abgelehnt. Während sie das trockene Zeug mit der Kaffeeplörre hinunter spülte, hatte die Angestellte, eine ungesund dürre Vierzigjährige, hektisch telefoniert und gleichzeitig eine Straßenskizze auf ein A4-Blatt gekritzelt. Hatte sie dabei den Namen Meier genuschelt? Aber warum sollte der hier anrufen?
Die Skizze lag jetzt neben Jade auf dem Beifahrersitz. Wenn sie schon das schöne Fleschbeck besuche, hatte die Dünne nach dem Telefonat gesagt, dann solle sie doch auf dem Rückweg die Südliche Alleenstraße nehmen. Gerade jetzt im Frühling und bei diesem Wetter leuchte das frische Grün an den Straßenrändern einfach bezaubernd.
„Bezaubernd, kann ich Ihnen sagen, meine Liebe!“
Jade hatte es noch nie gemocht, meine Liebe genannt zu werden, nicht von Meier noch von sonstwem. Aber gegen die Routenänderung hatte sie nichts einzuwenden, sie hatte ja mehr als genug Zeit.
Jade schaffte es tatsächlich zum zweiten Mal am heutigen Tag den Peugeot ruckelfrei vom Parkplatz zu bekommen und die Karre erst an der nächsten Ampelkreuzung abzuwürgen, sehr zum Ärger eines eiligen LKW-Fahrers. Eine Viertelstunde später verließ sie die Stadt in südlicher Richtung. Die Wegbeschreibung der Dürren taugte jedenfalls.
Jade sang jetzt aus voller Kehle. Dieser Tag hatte ihr gut getan, er war weit besser verlaufen, als sie nach der durchwachten Nacht befürchtet hatte. Die Sonne strahlte verschwenderisch und tatsächlich schien es, als ob die frischen Farben der Alleebäume das Auto, ihr Gesicht und sogar ihre Seele in Frühlingsgrün tauchten. Einmal kreuzte ein Reh die Fahrbahn, weit genug entfernt, dass Jade problemlos die Geschwindigkeit verringern konnte, auch wenn es ihr dabei wieder merkwürdig vorkam, wie tief sie das Bremspedal herunterdrücken musste.
Weiter, jetzt weiterfahren bis in den Süden, über die Alpen, übers Meer fliegen und tief im Herzen von Afrika landen. Tunesien, Sambia, Nigeria, Kongo. Sehnsuchtsnamen.
Jade sang. Und als es eine Steigung hinaufging, konnte sie sich einbilden, dass dahinter das Meer auftauchte. Jade gab Gas. Sie flog über den Gipfel und riss die Augen weit auf.
Vor ihr fiel die Straße steil bergab, etwa einen Kilometer schnurgerade, und dann, sie konnte es von weitem schon an den Warnschildern erkennen, ging es in eine scharfe Rechtskurve. Jade presste den Fuß mit aller Kraft auf das mittlere Pedal, aber die Bremse fasste nicht. Jade sang nicht mehr, sie schrie. Erst kurz vor der Kurve fiel ihr die Handbremse ein, viel zu spät und jetzt ein tödlicher Fehler. Jade riss den Hebel nach oben und hörte die Reifen quietschen als die Räder blockierten. Sie sah die frühlingsgrüne Wand auf sich zurasen. Im letzten Augenblick glaubte sie inmitten des Grüns ein grinsendes Wolfsgesicht zu sehen. Kurz bevor es im Schwarz versank.
Schwarz.
Formen werden erkennbar, etwas glänzt in der Dunkelheit, rollt auf sie zu. Es ist riesig, gläsern, durchzogen von dunkelblauen Fäden. Jade sieht es mit weitgeöffneten Augen. Die Kugel kommt näher. Jade gleitet ins Innere. Sie atmet nicht. Die blauen Fäden schlingen sich um ihre Arme und Beine, über ihre Hüften, ihre Schultern, den Hals. Und bilden vor ihr einen Tunnel. Sie wird hineingesogen, weiter, tiefer. Plötzlich weiß sie, wo sie ist.
Pass gut auf mein Kind, sagt die Frau, und Jade erkennt die vertraute Stimme. Komm ihnen nicht zu nah, warnt sie. Jade lacht. Achte auf die Unterirdischen. Nachts kriechen sie aus dem Berg, wenn die Menschen schlafen. Schon sind sie unter uns, mehr von ihnen als du glaubst. Und sie schauen in deine Augen, versenken dich in den Schlaf, nehmen dich mit auf die Reise ins Innere der Erde, sie schleppen dich in die Tiefe, wo sich die Menschen verirren, wo niemand dich retten kann. Doch wehe, wenn du fliehen willst. Dann sprechen sie das Wort, das uralte, das in der gläsernen Kugel verschlossen liegt. Dann wirst du zu Stein, wie der Schlafende Jäger, die Steinerne Agnes, der Watzmann und die Heulende Hex! Und wie die Croggs. Also hüte dich vor dem Wort, das verschlossen liegt unter blauer Flut an rundem gläsernen Ort. Sag es und alles wird Stein, dreh es und totes Gebein wird dein Diener sein.
Jade schlug die Augen auf. Es war merkwürdig hell im Zimmer und es dröhnte in ihrem Kopf. Eine grellrote Wolke aus Schmerz flutete ihr Hirn. Und inmitten der Wolke verhallte das Wort und verschwand, bevor Jade es fassen konnte. Wieder hatte sie es gehört, und doch nicht gehört. Jade atmete schnell und starrte in ein verschleiertes Nichts. Lauschte dem verklingenden Echo, bis nur noch die Erinnerung an diese Frauenstimme blieb, an Katarina, ihre Urgroßmutter. Sie hatte zu ihr gesprochen wie damals, als Jade ein kleines Mädchen war. Von den Unterirdischen, den Kobolden im Salzberg, von der Steinernen Agnes und der Heulenden Hex. Von den Croggs. All das, womit man Kinder erschreckte. Und von der Kugel hatte Katarina gesprochen, dem Wort, das verschlossen liegt unter blauer Flut an rundem gläsernen Ort.
Jade richtete sich ruckartig auf. Augenblicklich durchzuckte wieder ein stechender Schmerz ihre Schläfen. Sie schloss die Augen und wartete bis er nachließ. Die Glaskugel! Wo war sie? Im Bauch des Bären Bramabas. Jade holte tief Luft und ließ sich zurück in die Kissen fallen.
Sobald sie die Augen wieder schloss, überfiel sie mit elementarer Wucht eine andere Erinnerung. Eine grüne Wand, die sich in rasendem Tempo näherte. Das vergebliche Treten des Bremspedals von diesem verdammten Peugeot, die Handbremse als letzte Hoffnung, die quietschenden Reifen. Und das Wolfsgesicht. Jade riss die Augen wieder auf. Sie hatte einen Unfall gehabt, sie befand sich in einem Krankenhaus. Welcher Tag war heute? Warum kam denn hier niemand?
Auf dem Tischchen neben ihrem Krankenbett fand Jade eine Fernbedienung. Der Fernseher stand auf einem Bord, das dem Bett gegenüber an der Wand angebracht war. Er funktionierte.
Der Umweltminister nahm beinahe die ganze Breite des Bildschirms ein. Eine Sondersendung aus der Hauptstadt, Dienstag nach Ostern, 8.30 Uhr. Ela setzte Teewasser auf und starrte auf den Fernseher, gleich würde ihr Vater sprechen. Gestern abend war er mit dem Zug nach Berlin gefahren, zu einer wichtigen Besprechung im Umweltministerium, das war alles, was er glaubte, seiner Tochter zur Erklärung sagen zu müssen. Als sei sie mit siebzehn nicht längst erwachsen. Vor Mittwoch käme er nicht zurück, aber Ela sei doch in der Lage, sich zwei Tage selbständig zu versogen. Ela hatte nur gegähnt.
Mit einer dampfenden Tasse Tee hatte sie sich vor die Glotze gesetzt. Die Worthülsen von Edouard Forestier rieselten aus den Lautsprechern. Der Atomminister, wie Wolles langhaariger Alter ihn nannte, war angeblich ein Weggefährte von Daniel Cohn-Bendit gewesen, dem Obergrünen im Europaparlament, der bei der Pariser Mairevolution mitgemischt hatte, damals 1968. Aber Forestier hatte recht bald die Seiten gewechselt, aus Enttäuschung über den inkonsequenten Kurs der Grünen, wie er nicht müde wurde zu betonen. Wer's glaubt. Heute saß er mit seiner geschmacklosen blau-gelb-gestreiften Krawatte für die Liberalen im deutschen Bundestag und fühlte sich Guido Westerwelle eng verbunden. Herzlichen Glückwunsch.
Forestier redete ohne Punkt und Komma und Ela war schon jetzt genervt von seinen geschraubten Sätzen. Der Minister wurde umringt von einer Gruppe Anzugträger, unter denen Ela auch Jasper Reineke entdeckte, den Weißenhaller Bürgermeister. Ihren Vater. Aber plötzlich wurde Ela hellhörig. Forestier hatte einen Begriff verwendet, der erst kürzlich hier im Haus gefallen war. Jetzt wiederholte er ihn.
„Um so mehr freut es mich, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Ihnen hier und heute mitteilen zu können, dass die Operation Bergfrieden erfolgreich verläuft. Nach aufwändiger und verantwortungsvoller Prüfung haben wir den idealen Ort für die Endlagerung von schwach bis mittelstark strahlendem Atommüll gefunden. Der Salzstock Helldor nahe des bezaubernden Städtchens Weißenhall bietet optimale Bedingungen und höchstmögliche Sicherheit auch und gerade für spätere Generationen. Bereits gestern Abend hat mir der Bürgermeister von Weißenhall, mein geschätzter Kollege Reineke, die Nachricht überbracht, dass die zuständige Genehmigungsbehörde sämtliche Hürden aus dem Weg räumen konnte. Meine Damen und Herren, begrüßen wir Jasper Reineke.“
Ela vergaß ihren Tee und starrte auf den Bildschirm. Operation Bergfrieden, sie hatte sich nicht verhört. Nie würde sie die heisere Stimme des Wolfsgesichts vergessen.
Applaus. Die Herren und eine Frau klatschten routiniert und Jasper Reineke trat mit einem Papierstapel bewaffnet und stolzgeschwellter Brust an das Rednerpult.
„Sehr geehrter Herr Minister, meine Damen und Herren. Ich möchte mich zunächst herzlich für die Gelegenheit bedanken hier reden zu dürfen, und für die überaus freundliche Unterstützung des Umweltministeriums bei der Suche nach einer sicheren Lösung für eines der dringensten Probleme unseres Landes, wenn nicht der ganzen Welt.“
Ela verdrehte die Augen. So ein Gesülze war noch schwerer zu ertragen, wenn es vom eigenen Vater kam. Fehlte nur noch, dass er seine daheimgebliebene Verwandtschaft grüßte.
„Wie wir alle wissen, befindet sich die westliche Staatengemeinschaft derzeit in einer prekären Lage, eingekesselt zwischen stetig steigendem Energiehunger einerseits und der fatalen Abhängigkeit vom Öl andererseits. Gerade in dieser Situation sehen wir mit Sorge den neu entflammten Konflikt der Vereinigten Staaten von Amerika mit der Arabischen Welt. Nach der Festnahme des unter Terrorverdacht stehenden Prinzen Feisal Abu Hassan …“
Hier blickte Forestier erschrocken den Weißenhaller Bürgermeister an, der – das wusste selbst Ela – einen garantiert falschen arabischen Prinzennamen benutzt hatte.
„… eskalierte der Streit zunächst auf diplomatischer Ebene. Inzwischen aber drohen die Wüstensöhne …“ Wüstensöhne! „… damit, dem Westen den Ölhahn abzudrehen. Was für Alternativen also bleiben uns noch?“
Jasper Reineke legte eine wie er sicher meinte wirkungsvolle Pause ein und blickte ernst in die umstehenden ausdruckslosen Gesichter. Ela registrierte, dass einer der Anzugträger im Hintergrund bereits unruhig auf die Uhr schaute. Doch Jasper bekam nicht oft die Gelegenheit vor einem Millionenfernsehpublikum aufzutreten.
„Meine Dame, meine Herren, unser leider nicht ganzjährig von der Sonne verwöhntes Land muss auf zusätzliche Energiequellen zurückgreifen. Solarstrom allein, auch in Verbindung mit der unzuverlässigen Windenergie, kann den steigenden Energiebedarf einer modernen Industrienation nicht decken. Auch und gerade weil unsere weltweit hoch angesehene Automobilindustrie vermehrt auf Strom als Antriebsquelle setzt. Auf umweltfreundliche Fahrzeuge …“, Reineke strahlte in Forestiers Richtung, „… deren Batterien …“, hier musste er vom Blatt ablesen, „… mit Lithium-Ionen-Akkumulatoren arbeiten, die als Anodenmaterial Kobalt enthalten, ein Metall, bei dem in Zukunft mit einem starken Anstieg der Nachfrage zu rechnen sein wird. Der globale Bedarf an Kobalt wird bis zum Jahr 2030 um das dreifache steigen, wie ich einem Positionspapier der deutschen Industrie entnehmen kann. Aber auch auf diesem Gebiet sind wir bestens aufgestellt, denn die Weißenhaller Firma PETRUS liefert Kobalt zu unschlagbar günstigen Konditionen, bei denen selbst die Chinesen nicht mithalten können.“
Ela schüttelte den Kopf. Bitte, dachte sie, jetzt fang nicht auch noch mit der Gelben Gefahr an.
„Schon in früheren Zeiten sprach man von der Gelben Gefahr, heute ist sie präsenter denn je. Und damit komme ich zum letzten, aber wichtigsten Punkt meiner Ausführungen.“
Einer der Anzugträger drehte sich um und eilte schnellen Schritts davon.
„Um unsere Spitzenposition gegen die Konkurrenz aus Fernost behaupten zu können, gibt es nach meiner Überzeugung keine Alternative zur Atomkraft und, wie Herr Minister Forestier zuvor schon betonte …“, nichts davon hatte Forestier zuvor betont, „… zur Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Atomkraftwerke, wie sie im vergangenen Herbst von der Regierung beschlossen wurde. Das müssen, wenn sie ehrlich sind, auch die größten Bedenkenträger der Republik, namentlich die Grünen, einsehen, denn niemand will ernsthaft zurück in die Steinzeit, zu einem Leben ohne Strom. Deshalb dürfen wir nicht die Augen vor den aktuellen Problemen verschließen, getreu dem Motto: Was geht mich das an, bei mir kommt der Strom aus der Steckdose.“
Niemand lachte.
„Nein, ich möchte sogar sagen: Wir sind die wahren Grünen! Wir schaffen die Bedingungen für effiziente und umweltfreundliche Autos. Und wir haben den Immergrünen seit heute ihr schärfstes Argument geraubt. Denn wir halten die Lösung für die Archillesferse der Atomwirtschaft in Händen: Die Endlagerung des strahlenden Abfalls, jawohl! Helldor heißt die Lösung. Helldor, ein ungenutztes Salzbergwerk in meiner Heimatgemeinde Weißenhall, das seit nunmehr einhundert Jahren regelmäßig von Forscherteams untersucht worden ist. Wo sonst, frage ich Sie, haben wir über einen so großen Zeitraum verlässliche Daten über die Sicherheit einer Schachtanlage? Darum haben wir nicht den geringsten Zweifel, dass der gefährliche Abfall in Helldor unbeschadet die Zeiten überdauern kann und zukünftige Generationen sorglos durch blühende Landschaften spazieren werden, wie schon Altkanzler Helmut Kohl vorausgesagt hat. Meine Dame …“, Reineke sah sich um, auch die Dame war inzwischen gegangen, „… meine Herren, ein historischer Moment. Ich danke Ihnen.“
Ela wollte im Boden versinken. Spärlicher Applaus begleitete ihren Vater zurück zu seinem Platz in der zweiten Reihe. Mit jovialem Lächeln trat Edouard Forestier wieder ans Mikrofon.
„Lieber Herr Reineke, wir schätzen Ihre Kenntnis der internationalen Zusammenhänge und wünschen Ihnen noch eine angenehme Heimreise. Das Umweltministerium wird in Kürze zu ersten Beratungen zusammentreffen und die nötigen Schritte für das Projekt Helldor 21, wie zum Beispiel die Anbindung an das Schienennetz der Bahn und die Vorbereitung der Schachtanlage in die Wege leiten. Glück auf!“
Hier endete der Bericht von der Pressekonferenz vor dem Berliner Reichstag. Ein Moderator begann, die Aussagen der Redner mit eigenen Worten zusammenzufassen, konnte aber keine zusätzlichen Informationen über den Zeitplan der Einlagerung oder die angepeilte Menge des Abfalls bringen. Ela schaltete den Fernseher aus.
Jetzt war es also raus, offiziell. Man wollte Atommüll im Salzstock Helldor verschwinden lassen. Ela kannte sich dort bestens aus. Wie viele Weißenhaller Jugendlichen verdiente sie sich in den Sommerferien ein paar Euro mit Führungen durch die Salzstollen, die von HelldorTours organisiert wurden, einer kleinen Klitsche, die auch die Schlüssel zu dem rostigen Tor vor dem Haupteingang zur Unterwelt verwaltete, obwohl es ein offenes Geheimnis war, dass es auch andere Zugänge gab. Diese Führungen waren schaurige Events mit Gruselgarantie, was bereits mit dem Namen begann. Schon das Wort Helldor ließ besonders amerikanischen Touristen wohlige Schauer über den Rücken laufen. Und die Jugendlichen widersprachen natürlich nicht der Übersetzung als Tor zur Hölle. In Wahrheit gingen die meisten Ethymologen davon aus, dass in dem Namen das mittelhochdeutsche hall für Salz steckte. Somit konnte Salztor eine richtige Übersetzung sein. Aber die Touris fühlten sich mindestens wie in der Vorhölle, spätestens wenn sie bei schummrigen Licht etwa fünfzig Meter untertage auf die Steingestalten stießen. Merkwürdig gekrümmte, halbverwitterte Gesteinsformationen, die verblüffend menschenähnlich aussahen. In den Legenden der Gegend wurden sie die Steinernen Krieger genannt, die eines Tages wieder erwachen und Rache für ihr langes bewegungsloses Ausharren nehmen würden.
Die Jüngeren lachten über diese Geschichten und hatten die steinernen Gestalten Rolling Stones getauft, denn sie sahen den echten Stones – allen voran Mick Jager und Keith Richards – mit ihren verwitterten bemoosten Gesichtern nicht unähnlich …
Wir in Weißenhall haben die wahren Stones!
Ela schloss die Augen und konnte sie zum Greifen nah vor sich sehen.