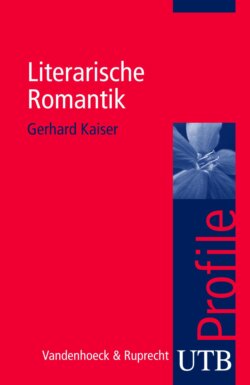Читать книгу Literarische Romantik - Gerhard Kaiser - Страница 7
ОглавлениеEinleitung
»Es träumt sich nicht mehr recht von der blauen Blume. Wer als Heinrich von Ofterdingen erwacht, muß verschlafen haben«, so der Philosoph und Literaturwissenschaftler Walter Benjamin 1927. Mit der »blauen Blume«, dem wohl bekanntesten Symbol der Romantik, und mit dem Heinrich von Ofterdingen spielt Benjamin an auf den gleichnamigen Roman Friedrich von Hardenbergs (1772-1801), der sich selbst dann den Künstlernamen Novalis zulegte. Was Benjamin damit unter dem gesteigerten Realitätsdruck in der Weimarer Republik zum Ausdruck bringen will, ist: Wer noch in den Träumen und Ideen der Romantik, jener gesamteuropäischen kulturellen Strömung, die in den 1790er Jahren beginnt und fast ein halbes Jahrhundert dauert, schwelgt, der macht sich einer unzulässigen »Weltfremdheit« schuldig. Die Zeit der Romantik, die Zeit des Romantischen also, sei endgültig vorbei.
Und doch tauchen das Romantische und mit ihm die Romantik immer wieder auf, lässt man das 20. und das beginnende 21. Jahrhundert Revue passieren. Sei es – um hier nur zwei Beispiele aus einer nicht allzu fernen Vergangenheit aufzugreifen – dass die Hippiebewegungen der 1960er Jahre und die ökologischen Bewegungen seit den 1980er Jahren, bewusst oder unbewusst, an bestimmte Aspekte der Romantik wieder anknüpfen, sei es, dass Ausstellungen zur Malerei der Romantik oder Bücher zum Thema regen Zuspruch in der kulturraisonnierenden Öffentlichkeit finden: Man denke etwa an die Caspar-David-Friedrich-Ausstellung in Essen 2002 oder an Rüdiger Safranskis unlängst erschienene erfolgreiche Abhandlung Romantik. Eine deutsche Affäre. Zudem kommt bis heute der Begriff »romantisch« im Alltag in geradezu inflationärer Weise zum Einsatz, wenn es darum geht, eine bestimmte Stimmung, eine bestimmte Situation, bestimmte Gegenstände, Landschaften oder Bilder, Romane, Filme oder Musikstücke zu charakterisieren. Kurzum: Das Bedürfnis nach »Romantischem« lässt sich nicht einfach stillstellen und die Rede vom Romantischen scheint ein steter Begleiter jener umfassenderen historischen Epoche zu sein, die zum Teil durch die Romantik selbst mitbegründet wird: der Moderne. Die Romantik ist, indem sie das Formeninventar und die Selbstreflexivität künstlerischen Ausdrucks nachhaltig erweitert und steigert, Mitbegründerin der kulturellen Moderne und zugleich, dies macht ihre Janusköpfigkeit aus, werden im Namen des Romantischen von Beginn an und immer wieder, vor allem in Zeiten von extremen ökonomischen und sozialen Veränderungsschüben, vehemente rückwärtsgewandte Einsprüche erhoben gegen die Folgen und Irritationen einer solchen Modernisierung. Diese Doppelgesichtigkeit aus Erneuerungsbestreben und Rückwärtsgewandtheit, Revolution und Reaktion, Weltveränderungsanspruch und Weltflüchtigkeit kennzeichnet das Profil der Romantik und gibt auch der literarischen Romantik ihr irritierendes und zugleich auch faszinierendes Gepräge.
Dieses Buch konzentriert sich auf die literarische Romantik und beschränkt sich zudem auf den deutschsprachigen Bereich. Doch selbst dann noch scheint das Ansinnen geradezu vermessen, in einem vergleichsweise knappen Rahmen einen einführenden Überblick geben zu wollen über einen Zeitabschnitt der deutschen Literaturgeschichte, der so reich an höchst widersprüchlichen, spannenden wie versponnenen, progressiven wie rückwärtsgewandten Tendenzen ist. Reicht doch das literarische Spektrum der Romantik – um nur einiges zu nennen – von den philosophischen Fragmenten und den literaturrevolutionierenden Romanexperimenten eines Friedrich Schlegel, Novalis, Bonaventura, den unkonventionellen und ironischen Dramen und Märchenerzählungen eines Ludwig Tieck über die »Kunstvolksdichtung« der Heidelberger Romantik, die patriotischen Schauspiele eines Achim von Arnim, die Lyrik und die Literaturgeschichtsschreibung Joseph von Eichendorffs und die phantastischen Romane und Erzählungen E.T.A. Hoffmanns bis zur katholischen Mystik der späten Texte eines Clemens Brentano oder Joseph Görres. Zudem handelt es sich um einen Zeitraum, der mit der frühen Romantik (erste Hälfte der 1790er Jahre bis 1801 mit den Zentren Jena und Berlin), der mittleren Romantik (mit den Zentren Heidelberg 1805 bis 1808 und Berlin 1809 bis 1822) und der späten, katholisch geprägten Romantik (1820/1830er Jahre mit den Zentren Wien und München) immerhin gleich drei Phasen umfasst, die auf den ersten Blick wenig miteinander gemein haben. Damit also das Ansinnen einer Einführung nicht zur telefonbuchartigen Aneinanderreihung von Namen, Werktiteln und Jahreszahlen wird, bedarf es einer Auswahl des Beispielhaften sowie einer Reduktion auf das je Charakteristische, d.h. Romantikspezifische dieser Beispiele. Im Folgenden sollen deshalb zunächst nach einem kurzen Blick auf die Begriffsgeschichte fünf wesentliche Charakteristika der literarischen Romantik vorgestellt werden. Im steten Rückbezug auf diese Charakteristika skizzieren dann die weiteren Kapitel das geistige und soziale Profil der literarischen Strömung. Dabei sollen, unter Berücksichtigung aller literarischer Gattungen, einige der exemplarischen Repräsentanten und ihre wichtigsten, in Schule und Studium immer wieder behandelten Texte vorgestellt werden.