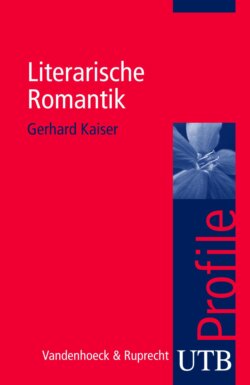Читать книгу Literarische Romantik - Gerhard Kaiser - Страница 9
Оглавление1
Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders oder: Was »romantisch« meint und wie man es sich merken kann
Wortgeschichtlich gesehen haben »romantisch« und »Roman« den gleichen Ursprung. Sie gehen auf das altfranzösische Stammwort »romanz« zurück. Mit »romanz« bezeichnete man die romanische Volkssprache im Gegensatz zur lateinischen Gelehrtensprache. Hieraus entwickelte sich dann der Begriff »romance« als Bezeichnung von zunächst in provenzalischer Sprache geschriebenen Vers- und Prosadichtungen, die ritterliche Themen aus dem Umkreis der Roland- bzw. Artussagen zu amourösen und phantastischen Geschichten verwoben. Aus ihm entstand neben der Gattungsbezeichnung »Romanze« auch der Begriff des Romans, der zunächst eine erfundene, erdichtete Prosaerzählung meinte.
Begriffsgeschichte
In diesem – meist eher negativen – Sinne für eine unwahrscheinliche, phantastische und zu Übertreibungen neigende Erzählhaltung hielt sich der Begriff bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts kam es in England und Frankreich zu einer folgenreichen Erweiterung: »Romantisch« konnten nun nicht mehr nur bestimmte Erzählungen sein, sondern – in einem durchaus positiven Sinne – alle Gegenstände, an denen Merkmale des Wunderbaren, Phantasievollen einen Abstand zum Alltäglichen einerseits und zu klassizistischen Ordnungen in der Kunst andererseits markierten (zum Beispiel »romantische« Landschaften). »Romantisch« konnte aber nun |9◄ ►10| auch die Liebe sein; etwa dann, wenn sie sich gegen gesellschaftliche Konventionen (und um den Preis des Liebestodes) behauptete. Im alltagssprachlichen Gebrauch hat sich »romantisch« bis in die Gegenwart hinein als Bezeichnung für eine Haltung oder ein Handeln behauptet, das im Gegensatz zur Rationalität und zum Realismus des »normalen« Lebens steht.
Zeitlich nähern wir uns damit den Anfängen jener literarischen Strömung, um die es hier geht und somit u.a. einem Buch von Wilhelm Heinrich Wackenroder (1773-1798) und Ludwig Tieck (1773-1853), das den Titel Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders trägt.
Fünf wesentliche Charakteristika der literarischen Romantik
Obgleich fast am Anfang der literarischen Romantik stehend, verdichten sich bereits im Titel dieser 1796 (datiert auf 1797) erschienenen Sammlung wesentliche Aspekte der Romantik. Man könnte sogar so weit gehen, und – ein wenig boshaft vielleicht – behaupten, dass wir es hier bereits mit einer Definition des »Romantischen« zu tun haben. Zum Text selbst hier ganz kurz nur so viel:
Es handelt sich um ein durch seine Erzählstruktur – der titelgebende Klosterbruder fungiert als Erzähler der meisten Stücke – verklammertes Sammelwerk von 18 Texten: kunsttheoretische Aufsätze (insbesondere über Malerei, etwa Raffael und Dürer), Briefe, Bildbeschreibungen, Prosa und Poesie, Künstlerbiographik und Essayistik. Sowohl die unsystematische Form als auch ihr Inhalt machen die Herzensergießungen zweifellos zu einem der Gründungsdokumente der deutschsprachigen Frühromantik. Dies erklärt wohl auch Goethes lebenslange Abneigung gegen das Büchlein: Noch im November 1827 bezeichnet er in einem Brief das Buch als »Infektion eines schwindsüchtigen Pfaffenfreundes« (Wackenroder war 1798 mit 24 an einem Nervenfieber gestorben).
Aber zurück zum Titel: Hier verdichten sich, wie in einem Prisma und ohne dass der Begriff des »Romantischen« fiele, doch ganz zentrale Aspekte der deutschsprachigen literarischen Romantik, so dass man sie sich mit Hilfe dieses Titels (wie in einer Art 5-Finger-Lernmethode) immer wieder vergegenwärtigen kann:
|10◄ ►11|
1. Herzensergießungen
Die Herzensergießungen verweisen auf den Gemütszustand des Erzählers sowie auf seine Erzählhaltung, die zugleich eine Lebenshaltung ist: nämlich die der Schwärmerei und des Enthusiasmus (E.T.A. Hoffmann etwa wird später seine ersten Erzählungen von einem fiktiven »reisenden Enthusiasten« erzählen lassen). Die Tradition der enthusiasmierten Rede ist natürlich nicht genuin romantisch, geht sie doch – als Gotterfülltheit, Verzückung, Inspiration – über die Genieästhetik des Sturm und Drang und über die Empfindsamkeit zurück bis auf Platon.
Und dennoch manifestiert sich im schwärmerischen Redegestus der Herzensergießungen ein bewusster Einspruch der beginnenden Frühromantik gegen den zeitgenössischen, aufgeklärten Umgang mit der Kunst, der von einer klassizistischen und rationalistischen Poetik und Ästhetik getragen wird. Stark gemacht wird das Gefühl als jene angemessene Erlebnis- und Ausdrucksweise, in der sich der Kunst im Besonderen, der Welt im Allgemeinen begegnen lässt. Als liebevolle Einfühlung und pietätvolle Andacht richtet sich die Herzensergießung gegen jene
»[k]ritischen Köpfe, welche, an alle außerordentliche Geister, als an übernatürliche Wunderwerke, nicht glauben wollen noch können und die ganze Welt gern in Prosa auflösen möchten.« (W I, 65)
Damit wird natürlich nicht nur ein spezifisches Verhältnis gegenüber der Kunst, sondern auch eine aufgeklärte Denk- und Lebenshaltung insgesamt kritisiert. Die Reden des Klosterbruders sind durchsetzt von einem Wortschatz der Innerlichkeit, der Rhetorik des Erhabenen und Sakralen, der Tradition der Empfindsamkeit und der Sprache des Herzens. So heißt es etwa in dem Abschnitt Wie und auf welche Weise man die Werke der großen Künstler der Erde eigentlich betrachten und zum Wohle seiner Seele gebrauchen müsse:
»Ich vergleiche den Genuß der edleren Kunstwerke mit einem Gebet. [ …] Der aber ist ein Liebling des Himmels, welcher mit demüthiger Sehnsucht auf die auserwählten Stunden harrt, da der milde himmlische Strahl freywillig zu ihm herabfährt, die Hülle irdischer Unbedeutendheit, mit welcher gemeiniglich der sterbliche Geist überzogen ist, spaltet, und sein edleres Innere auflöst und auseinanderlegt; dann knieet er nieder, wendet die offene Brust in stiller Entzückung, gegen den Himmelsglanz und sättiget sie mit dem ätherischen Licht; dann steht er auf, froher und wehmüthiger, volleren und leichteren Herzens, und legt seine Hand an ein großes gutes Werk.« (W I, 106f.)
|11◄ ►12|
2. eines
Das klingt ein wenig konstruiert, aber wir haben es hier mit den »Herzensergießungen« eines Klosterbruders zu tun und nicht mit der klosterbrüderlichen Sicht auf die Kunst überhaupt. Was sich hierin andeutet, das ist die vor allem für die Frühromantik bedeutsame und oft im Rückbezug auf den Philosophen Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) vollzogene Hochschätzung des Subjekts, das auf sich selbst, d.h. auf die Bedingungen seiner Möglichkeit reflektiert, und das die Welt außerhalb seiner selbst, das »Nicht-Ich«, wie es bei Fichte heißt, erst in ihrem Sosein »setzt«. Diese Hochschätzung der Individualität gilt auch und gerade für den Künstler, was sich etwa zeigt, wenn Friedrich Schlegel in seinem berühmten 116. Athenäums-Fragment (s. dazu unten) ganz in der Tradition der Genieästhetik des Sturm und Drang darauf besteht, »daß die Willkür des Dichters kein Gesetz über sich leide« (FS, 183).
3. kunstliebend
Fast untertrieben ist das schmückende Beiwort »kunstliebend«, artikuliert sich im Klosterbruder doch geradezu eine Kunstfrömmigkeit, eine Sakralisierung der Kunst, die für die Romantik prägend und konstitutiv sein wird. Bereits in einem Brief Wackenroders vom 11. Dezember 1792 an seinen Freund Tieck bricht sich diese Kunstreligiosität Bahn:
»Nur schaffen bringt uns der Gottheit näher; u der Künstler, der Dichter ist Schöpfer. Es lebe die Kunst! Sie allein erhebt uns über die Erde, u macht uns des Himmels würdig.« (W II, 101)
Der Künstler fungiert als gottähnliches Schöpferindividuum, die Kunst selbst übernimmt gleichsam die Mittlerfunktion der Kirche als autonome, sakramentale Gnadenspenderin. Dass eine solche Überschätzung der Kunst gleichzeitig erhebliche Gefahren der gesellschaftlichen Entfremdung für die beteiligten Künstler mit sich bringt, auch dieser in vollem Umfang erst bei Hoffmann entfaltete Gedanke wird erstaunlicherweise bereits im Klosterbruder angedeutet: am Beispiel des Merkwürdigen musikalischen Lebens des Tonkünstlers Joseph Berglinger. Das Schlussstück der Sammlung (das bedeutendste und umfangreichste) entwirft Konturen des romantischen Künstlers als eines Zerrissenen, die traditionsbildend bis heute sind. Es baut die bis in den Ästhetizismus des 19. und 20. Jahrhunderts wirksame Kontraststellung des geweihten Künstlers gegenüber den gewöhnlichen Menschen, den »Philistern«, in |12◄ ►13| der Weise aus, dass für das Auserwähltheitsgefühl des Künstlers gleichzeitig der Preis seiner Selbstaufopferung zu bezahlen ist. Der Überschätzung der Kunst entspricht ein elitäres Bewusstsein des Genies, das die Musik und den Künstler im Rahmen einer Kunstreligion weiht, seine Auserwähltheit und Genialität aber mit einer radikalen Asymmetrie zum Publikum bezahlt:
»Er gerieth auf die Idee, ein Künstler müsse nur für sich allein, zu seiner eigenen Herzenserhebung, und für einen oder ein paar Menschen, die ihn verstehen, Künstler seyn.« (W I, 142)
Die für die Romantik so charakteristische »Kunstliebe« zeitigt aber noch einen weiteren wichtigen Effekt. So wie der Liebende in Gedanken permanent um das Objekt seiner Liebe kreist, so kreist die romantische Literatur immer wieder um das Objekt ihrer Liebe, nämlich um die Kunst. Insofern reflektiert die romantische Literatur eben auch permanent sich selbst und macht sich selbst zum Thema ihrer Darstellungen, was sich darin niederschlägt, dass die Hauptfiguren der romantischen Erzählungen, Romane und Dramen nicht selten Künstler sind oder zumindest werden wollen.
4. und 5.: Klosterbruder
Der »Klosterbruder« erinnert bildlich an zwei Grundzüge der Romantik: Zum einen an ihre Begeisterung für das Mittelalter, jene »tiefsinnige und romantische Zeit« (N 1, 249). Die zeigt sich nicht nur darin, dass viele romantische Erzählungen und Romane (etwa Novalis’ Heinrich von Ofterdingen) im Mittelalter situiert sind, sondern auch darin, dass das Mittelalter von romantischen Autoren wie A.W. Schlegel (in seinen Berliner Vorlesungen, s. dazu unten) oder Novalis (in seiner programmatischen Studie Die Christenheit oder Europa) als positive Projektionsfläche herangezogen und konstruiert wird, wenn es darum geht, die Zustände in der aufgeklärten, aber als leidenschafts- und geheimnislos empfundenen Gegenwart zu kritisieren . Das Mittelalter wird dann im Rahmen eines dreistufigen Geschichtsschemas zum ursprünglichen »goldenen Zeitalter« stilisiert, aus dessen Paradiesen sich der Mensch der Neuzeit selbst vertrieben habe. Als dritte Stufe wird eine im Zeichen des Romantischen »wiederverzauberte« Welt in die Zukunft projiziert. Neben dieser Funktion einer vergangenheitsorientierten Gegenwartskritik entwerfen die Romantiker mit ihrem eingeschönten Bild des Mittelalters natürlich auch ein Konkurrenzprogramm zur Antikeorientierung der deutschen Klassik.
|13◄ ►14|
Zum anderen steht der »Klosterbruder« für die latente oder auch ganz offene Neigung der Romantiker, jener »nach dem Ueberirdischen durstige[n] Seelen« (N II, 750), zum Religiös-Spirituellen im Allgemeinen, zum Katholizismus (man denke an die Konversion Schlegels, die Reversion Brentanos, an den Katholizismus Eichendorffs) im Besonderen. Die Sinn- und Ordnungsverheißungen eines christlichen Weltbildes gewinnen für die Romantiker vor allem nach dem Abkühlen des frühromantischen Überschwangs zunehmend an Attraktivität. Aber schon 1799 heißt es etwa bei Novalis in Die Christenheit oder Europa:
»Es waren schöne glänzende Zeiten, wo Europa ein christliches Land war, wo Eine Christenheit diesen menschlich gestalteten Welttheil bewohnte; Ein großes gemeinschaftliches Interesse verband die entlegensten Provinzen dieses weiten geistlichen Reichs.« (N II, 732)
Bei Wackenroder geht diese neue Begeisterung für das Mittelalter und den Katholizismus, die bald von vielen Romantikern geteilt werden sollte, auf seine Nürnberg-Reise im Juni 1793 zurück. In einem seiner Reisebriefe an die Eltern schreibt er:
»Nürnberg ist eine Stadt, wie ich noch keine gesehen habe, u hat ein ganz besonderes Interesse für mich. Man kann sie, ihres Äußern wegen, in der Art romantisch nennen.« (W II, 188)
Wenn Wackenroder an dieser Stelle Nürnbergs mittelalterlich anmutende Architektur mit dem Terminus »romantisch« belegt, deutet sich in seinem Wortgebrauch bereits jene folgenreiche Bedeutungsverschiebung bzw. -erweiterung an, von der am Beginn dieses Kapitels die Rede war: von der älteren Bedeutung des Romanhaften, Wunderbaren oder auch Naturhaft-Pittoresken zum Zentralbegriff einer modernen, dem Lob des klassischen Altertums entgegengesetzten Dichtungstheorie, wie sie insbesondere von den Gebrüdern Schlegel in der Folgezeit vor allem im Athenäum propagiert wurde.
Bevor es im folgenden Kapitel genau um jene Dichtungstheorie und die Gebrüder Schlegel gehen soll, hier abschließend noch einmal die fünf zentralen Charakteristika der deutschsprachigen Romantik in der Übersicht: |14◄ ►15|
| Herzensergießungen | 1. | Aufwertung des Gefühls |
| eines | 2. | Subjektivität |
| kunstliebenden | 3. | Kunstemphase und Kunstreflexion |
| Klosterbruders | 4. | Mittelalter als gegenwartskritische Projektionsfläche |
| 5. | Neigung zum Religiös-Spirituellen, zum Katholischen |
Weiterführende Literatur
Kremer, Detlef: Romantik. 2. Aufl. Stuttgart/Weimar 2003
Safranski, Rüdiger: Romantik. Eine deutsche Affäre. München 2007
|15◄ ►16|