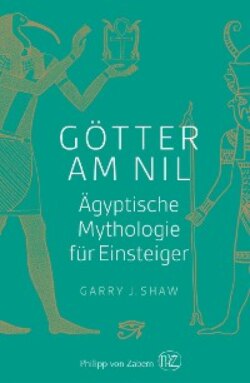Читать книгу Götter am Nil - Гэрри Шоу - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Geschaffenen
ОглавлениеDie erste Göttergeneration Jetzt lösen sich Schu und Tefnut von Atum, der sie als göttliche Flüssigkeit aus seinem Körper ausstößt – durch Niesen, Ausspucken oder Masturbation, je nach Variante des Mythos. Sie verbleiben innerhalb der Grenzen von Atums sich ausdehnender Gestalt, stecken fest im „Ballon“ der geschaffenen Welt. Doch obwohl sie nun etwas Abgesondertes sind, fehlt Schu wie auch Tefnut noch eine eigene Lebenskraft: Sie bleiben für ihr Überleben von ihrem Schöpfer abhängig. Um das zu beheben – so wie die beiden in Gestalt des „Lebens“ und der Ma’at ihrerseits Atum die nötige Kraft verliehen haben, sich von Nun zu trennen –, umarmt Atum jetzt seine zwei Kinder und gibt seinen ka, seine „Lebenskraft“, an sie weiter, womit er ihnen volle Bewegungsfreiheit und Existenz verleiht.
Als unabhängige Göttin wird Tefnut manchmal als Menschenfrau abgebildet, erscheint jedoch am häufigsten als Löwin mit Menschenleib. Ihre Rolle in der erschaffenen Welt ist ziemlich unklar; die Ägyptologen bezeichnen sie als „Feuchtigkeit“ oder „zersetzende feuchte Luft“ oder denken, dass sie als Obergrenze der Duat – des Totenreiches – in Erscheinung trat. Mit Sicherheit aber fungierte sie als Mutter aller späteren Gottheiten.
Schu (in der Mitte) trennt mit erhobenen Armen Nut als den Himmel von Geb, der als Erde unter ihr liegt.
Schu dagegen lässt sich leichter beschreiben. Typischerweise stellt man ihn als Mann mit einer Feder auf dem Kopf dar, doch konnte er auch als Löwe begegnen, genau wie seine Schwester und Frau. In Abbildungen des Kosmos steht er mit erhobenen Armen da und trennt den Himmel von der Erde in seiner Rolle als Atmosphäre. Wie die Leere in einem versiegelten Hohlraum fungierte Schu als trockener, leerer Raum innerhalb der Grenzen der geschaffenen Welt Atum – so markierte er die festen Schranken des Daseins. Indem er die Trennung zwischen oben und unten hervorbrachte und sicherstellte, formte Schu jenen Raum, in dem jetzt alles Leben und jede Bewegung existieren konnte.
Das war nicht das einzige Ergebnis der Trennung Schus und Tefnuts von Atum: Auch die Zeit entstand. Schu stand für neheh, das ägyptische Konzept der zyklischen Zeit oder der unendlichen Wiederkehr, wie sie sich etwa im Auf- und Untergang der Sonne, in der alljährlichen Überschwemmung des Nils, im Kreislauf von Geburt und Tod, Wachstum und Verwesung ausdrückt. Tefnut wiederum war djet, zum Stillstand gekommene Zeit, was alles abdeckt, das bleibend und dauerhaft ist, etwa Mumien und Steinbauten.
Nachdem es jetzt zeitliche und räumliche Ausdehnung gab, war die Bühne bereit für den ersten Sonnenaufgang und die Erschaffung der Menschheit.
Atums Einziges Auge und der erste Sonnenaufgang Schu und Tefnut wurden in den Wassern des Nun aufgezogen – der als zeugende und regenerierende Kraft galt, seiner Rolle bei der Schöpfung wegen. Dort beaufsichtigte sie Atums Einziges Auge, das der Vater ausschickte, um den Zwillingen zu folgen oder sie zu suchen. Das Auge Atums (häufiger Auge des Re genannt mit Blick auf die enge Verbindung zwischen beiden Göttern) kehrt in der ägyptischen Mythologie immer wieder. Nicht nur steht das Auge des Gottes für die Sonnenscheibe, es konnte auch den Mond oder den Morgenstern darstellen, je nachdem, um welchen Mythos es ging. Es handelt als unabhängiger Teil eines Ganzen und erscheint in dieser losgelösten Form als Verkörperung einer Göttin – häufig von Hathor, Bastet oder Mut.
Dadurch, dass Atum sein Einziges Auge auf die Suche nach Schu und Tefnut schickte, leitete er den ersten Sonnenaufgang ein. Das wäre allein nicht möglich gewesen, hätte Schu keinen Leerraum geschaffen. Deswegen sagt Schu: „Ich habe Licht aus der Dunkelheit gemacht“ und „Ich bin es, der den Himmel hell machte nach dem Dunkel“. Doch obwohl das Einzige Auge als Göttin auftrat und von Atum getrennt war, blieb die Sonnenscheibe dennoch ein Teil von ihm; weiterhin war die Sonne „Atum, der in seiner Sonnenscheibe ist“ oder Atum, der „hinausgeht vom östlichen Horizont“, oder auch, knapper gesagt, Re-Atum – das sichtbare Zeichen der Macht des Schöpfers, denn Re war der Name des Sonnengottes (und der Sonne) am Mittag, zur Zeit seiner größten Macht, und Atum am Abend, wenn er alt war. Jetzt begann (Re-)Atum seine tagtägliche Reise über den Himmel und durchquerte nachts das Jenseitsreich der Duat.
Bastet
Anfangs wurde sie als Löwin, später als Katze oder katzenköpfige Frau dargestellt, die häufig ein mit Katzen geschmücktes Sistrum hielt. Bastet (was vermutlich „die vom Salbgefäß“ heißt) trat als göttliche Mutter und Erzieherin des Königs auf.
Außerdem war sie mit der Fruchtbarkeit der Frauen verbunden, schützte die Schwangeren und auch die Toten. Als „Katze des Re“ vernichtete sie die Chaosschlange Apophis, und wie viele andere Göttinnen assoziierte man auch sie mit dem Auge des Re, weswegen sie als Res Tochter beschrieben wurde. Bastets wichtigster Kultort war Bubastis (Tell Basta) im Delta und sie war die Mutter des Gottes Mahes, der als Löwe oder löwenköpfiger Mensch auftrat.
Die Menschheit Ein Mythos besagt, dass, als die Zeit zur Rückkehr von Schu, Tefnut und dem Auge zu Atum kam, das Auge zu seinem Schrecken bemerkte, dass es durch ein neues Sonnenauge namens „das Glorreiche“ ersetzt worden war. Das unerwünschte Auge wurde so wütend, dass es vor Zorn weinte; die Tränen der Göttin schufen die Menschheit. Um ihren Schmerz zu lindern, setzte Atum sie sich auf die Stirn, wo sie „die Herrschaft über das ganze Land ausübte“. Anscheinend verwandelte sie sich in einen Uräus – eine sich aufrichtende Kobra, die Feuer auf die Feinde der Ordnung speit und die alle Pharaonen trugen.
Ähnliche Mythen bieten uns abweichende Geschichten vom Ursprung der Menschheit. In einer davon nennt Atum die Menschen das Ergebnis der „Blindheit, die hinter mir ist“, was andeutet, das Auge habe so sehr geweint, dass es seine Sehkraft verlor, wogegen in Sargtext 80 Atum von den Menschen sagt, sie seien aus seinem Auge hervorgegangen. Wieder ein anderer Mythos zeigt uns den Sonnengott weinend, weil er nach seiner Geburt einsam ist und seine Mutter nicht finden kann; diese Tränen schufen die Menschheit. Andererseits wird erklärt, die Götter seien aus dem Lächeln des Sonnengottes entsprungen oder aber aus dem Schweiß des Schöpfers (das ist nicht so abschätzig, wie es wirken mag, denn man glaubte, der Schweiß eines Gottes dufte nach Weihrauch).
Obwohl die Menschheit eine zufällige Auswirkung von Verzweiflung, Wut und Trauer seines Auges war, vollbrachte der Schöpfer ihr zuliebe vier gute Taten. Er schuf die vier Winde, die jedem den „Lebensatem“ geben; er machte die jährliche Nilschwelle, um sicherzustellen, dass es immer genug zu essen geben würde; alle wurden gleich von ihm geschaffen (alle außer dem König natürlich, der eine Kategorie für sich bildete); und er sorgte dafür, dass sich das Herz eines jeden an den „Westen“ erinnerte – ans Jenseits. Dort konnten die Menschen ihr Dasein in Gesellschaft der Götter fortsetzen. Der Schöpfer stand seinem Zufallsprodukt also durchaus nicht gleichgültig gegenüber:
Denn um ihretwillen schuf Er Himmel und Erde. Er besänftigte das Toben der Wasser und schuf die Winde, damit ihre Nüstern lebten. Sie sind Seine Abbilder, die aus Seinem Leib hervorgegangen sind, und ihnen zuliebe geht Er am Himmel auf. Für sie schuf Er Pflanzen und Vieh, Vögel und Fische zu ihrem Unterhalt … Ihretwegen schuf Er das Tageslicht … Und wenn sie weinen, lauscht Er … [Er ist es,] der bei Nacht und bei Tag über sie wacht. Lehre für König Merikare
Zusätzlich wirft ein Amunhymnus ein Licht darauf, was dieser Gott für die nichtmenschlichen Bewohner der Welt tat, und stellt fest, Amun sei „der Schöpfer des Weidelandes, das die Tiere am Leben hält … der es ermöglicht, dass die Fische im Fluss leben und die Vögel die Luft bevölkern“. Amun sorgt sogar für die kleinsten Geschöpfe, berichtet der Hymnus, denn er ist es, „der es überhaupt möglich macht, dass die Mücken leben, zusammen mit den Würmern und Flöhen, der für die Mäuse in ihren Löchern sorgt und die Käfer (?) in jedem Baum am Leben hält …“.
Apophis und sein Ursprung Jede Nacht griff seit dem Augenblick der Schöpfung Apophis, eine Monsterschlange von 120 ägyptischen Ellen Länge (rund 63 m), die für die Unordnung stand, den Sonnengott an und schürte einen Aufstand. Als Inbegriff der zerstörerischen Kräfte im Universum war Apophis der Anführer der Mächte des Chaos und musste durch die Gefolgsleute des Sonnengottes Re von dessen Barke abgewehrt werden, damit der Sonnenaufgang und die weitere Stabilität der Welt garantiert waren. Dem „Brüller“, wie Apophis auch bezeichnet wurde, fehlten Nase, Ohren und Augen, aber dennoch besaß er den Bösen Blick, der ihm die Kraft verlieh, Menschen und Götter zu lähmen. Aus diesem Grund vollzogen die ägyptischen Könige ein Ritual, bei dem sie mit einem Schläger auf das Auge des Apophis einschlugen und dadurch seinen Blick davonschleuderten.
Der Gott Atum kämpft gegen die Chaosschlange Apophis.
Trotz Apophis’ herausragender Rolle in der ägyptischen Mythologie ist sein Ursprung ziemlich rätselhaft. Es gibt nur einen einzigen, noch dazu späten Hinweis auf seine Erschaffung. In jener Darstellung entsteht er aus dem ausgespieenen Speichel der Neith. Doch während des Großteils der ägyptischen Geschichte gibt es keine überlieferte Bemerkung darüber, wie Apophis ins Dasein trat, so als hätte man ihn für irgendwie aus sich selbst erschaffen oder schon vor der Schöpfung existent gehalten.
Apophis hat es auf uns abgesehen
Anders als die Schlange Apophis, die täglich die Sonne zu zerstören drohte, stellt der Asteroid Apophis nur in größeren Abständen eine Gefahr für Erde und Mond dar. Der für 2004 vorausgesagte Einschlag auf der Erde fand bekanntlich nicht statt, aber einige kurz nach diesem (Nicht-)Ereignis angestellte Berechnungen zeigten, dass auch für 2023 und 2036 ein Einschlag möglich sei; zum Glück hat man beides seitdem als extrem unwahrscheinlich verworfen. Interessanterweise wurde der Asteroid nicht wegen seiner Bedrohung für den Fortbestand der Welt „Apophis“ genannt, sondern weil seine Entdecker Fans der Fernsehserie Stargate SG-1 waren, deren Erzbösewicht Apophis hieß.
Die Göttin Neith (Mitte) steht zwischen Isis und dem thronenden Osiris.
Die nächste Generation Schu und Tefnut zeugten die nächste Göttergeneration: Geb und Nut. Als Naturkraft bildete Nut das Himmelsgewölbe, eine durchsichtige Schranke zwischen der erschaffenen Welt und den sie umgebenden Wassern des Nun, die diese daran hinderte, auf jene hinunterzubrausen. Personifiziert erscheint sie meistens als nackte Frau, die sich mit Armen und Beinen abstützt – entweder muss man sich vorstellen, dass diese die Erde an den Kardinalpunkten berühren, oder aber, dass sie dicht beieinander bleiben und Nuts Körper zu einer schmalen Passage für die Bahnen von Sonne, Mond und Sternen machen. Was ganz ungewöhnlich für die ägyptische Kunst ist: Nut kann auch frontal dargestellt werden und den Betrachter direkt anschauen, als ob dieser in den Himmel hinaufblicken und die Göttin sehen könnte, wie sie aus der Höhe auf ihn herniederstarrt.
Geb, der Gott, der zur Erde wurde, tritt als Personifikation normalerweise in Gestalt eines grünhäutigen Menschen auf, manchmal mit Pflanzen geschmückt, der auf der Seite liegt und sich auf einen Ellbogen stützt. Wenn er steht, trägt er oft die Rote Krone von Unterägypten, allerdings ist sie manchmal durch eine Gans ersetzt – die Hieroglyphe für seinen Namen.
Der Gott Geb
Ein Mythos berichtet uns, dass Geb und Nut einander anfangs so eng umschlangen, dass Nut nicht gebären konnte; doch Schu zwang beide auseinander, so dass ihre Kinder geboren werden konnten – das erklärt elegant, warum die Luft die Erde vom Himmel trennt. Laut einem anderen Mythos, den der griechische Schriftsteller Plutarch überliefert, konnten Geb und Nut nicht in einem Bett schlafen, weil Schu sie getrennt hielt, und mussten sich deswegen heimlich treffen. Re jedoch entdeckte ihre versteckte Beziehung und belegte Nut mit einem Fluch, der sie 360 Tage im Jahr unfähig zum Gebären machte – in dieser Frühzeit der Schöpfung war das das ganze Jahr. Der weise Gott Thot (der, streng genommen, zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht geschaffen war, aber das übergehen wir einstweilen stillschweigend) bot seine Hilfe an und ging mit dem Mond Dame spielen. Da Thot ebenso gut im Spiel wie im Schreiberhandwerk ist, schlug er den Mond und gewann „ein Siebzigstel jeder seiner Erleuchtungen“. Daraus nun setzte er fünf Tage zusammen, die er dem Ende des Jahres hinzufügte, womit der Kalender auf 365 Tage kam und Nut die Chance erhielt, ihre Kinder zu gebären, und das tat sie an jedem dieser fünf Tage.
Die Kinder von Nut und Geb sind in der Reihenfolge ihrer Geburt Osiris, Horus der Ältere, Seth (der die Seite seiner Mutter durchbrach), Isis und Nephthys. In nichtgriechischen Quellen wird Horus der Ältere üblicherweise ausgelassen, und damit bleibt die traditionelle Große Neunheit (griechisch „Enneas“) Ägyptens übrig – die Gruppe aus neun Gottheiten, die für die physische Erschaffung der Welt stand.