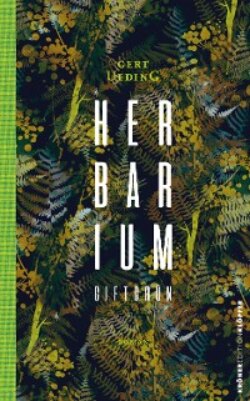Читать книгу Herbarium, giftgrün - Gert Ueding - Страница 11
4 Hinter den Kulissen
Оглавление»Es wird brenzlig, wir dürfen jetzt nicht die Ruhe verlieren.«
Der Sprecher hatte sich näher zu seinem Gesprächspartner gewandt und die Stimme gesenkt, obwohl bis zum nächsten besetzten Tisch im Lokal eine große Lücke war, sie beide außerdem in einer Nische saßen. Auf den ersten Blick zwei Geschäftsfreunde im dunkelblauen Anzug, trotz des warmen Septembertages. Sie mochten um die fünfzig sein, gepflegte Erscheinungen. Der die Warnung mit leiser Stimme ausgesprochen hatte, verriet durch fahrige Handbewegungen die Erregung, die ihn untergründig beherrschte. Er hatte rötlich blondes strähniges Haar, eine ungesunde weiße Hautfarbe und rot geränderte helle Augen und sah aus wie ein Archivar, der selten ans Tageslicht kommt.
Der andere, etwas korpulenter als sein Gegenüber, dunkelhaarig und mit einem eckigen Kinn, versuchte, beruhigend zu lachen, kniff dabei aber die braunen Augen zusammen, so dass man auch ihm eine gewisse Unruhe anmerkte, als er antwortete.
»Es ist alles auf sicheren Konten in Luxemburg, jeweils keine großen Beträge, mach dir bloß keine unnötigen Sorgen.«
»Sicher ist heute gar nichts, mein Lieber, das weißt du genau. Nicht mal mehr in der Schweiz. Aber darum mache ich mir die geringsten Sorgen. Viel zu viele Leute sind ganz oder teilweise informiert und denken sich ihr Teil. Viel zu viele!«
In seiner Stimme schwang ein panischer Unterton. »Deine Assistenten, meine auch, unsere Sekretärinnen, sogar die wissenschaftlichen Hilfskräfte haben wir schließlich eingesetzt – du ja auch. Und ohne Dr. Decker hätten wir die Aufträge gar nicht bekommen. Oder glaubst du etwa, dass ›Wiemann und Krepp‹ von sich aus auf uns gekommen wären? Auch die haben in ihren Forschungsabteilungen einige Mitwisser an unserem Unternehmen sitzen!«
»Das schadet gar nichts. Die wissen bloß von einer wissenschaftlichen Kooperation. Da schöpft niemand Verdacht. Geld gezahlt, Ergebnisse bekommen, basta!«
»Naja, schon. Ich bin auch mehr beunruhigt über unsere engeren Mitarbeiter. Werner Fink hat mich neulich abgepasst und um ein Gespräch gebeten. War sehr merkwürdig. Berichtete von finanzieller Klemme und ob er nicht so beschäftigt werden könne, dass für ihn zusätzlich zum mageren Gehalt etwas dabei rausschaut. ›Woran haben Sie denn gedacht?‹, fragte ich. ›Gutachten zum Beispiel‹, erwiderte er oder ›Beteiligung an einem Drittmittelprojekt, dann aber nicht als Universitätsangestellter.‹ Geht nicht, habe ich ihm auseinandergesetzt. Was aus Drittmitteln erwirtschaftet wird, geht an die Universität. Hat gelacht wie einer, der’s besser weiß und ist aufgestanden. ›Denken Sie an mich, wenn doch eine Möglichkeit auftaucht!‹ Sagte es und war verschwunden.«
»Das heißt noch gar nichts. Darin kann ich keine fiese Anspielung sehen. Und unter uns: das Gehalt unserer Mitarbeiter ist schäbig. Der Staat fördert doch geradezu die Selbsthilfe. Nimm auch unsere Verhältnisse! Was wird in der Wirtschaft gezahlt und was bekommen wir monatlich aufs Konto? Und wenn man den Universitäten nicht genug Forschungsmittel gibt, müssen wir uns eben anderswo umsehen.«
Das bestellte Essen kam und unterbrach das Gespräch. Man unterhielt sich über Restaurants in und um Frankfurt und darüber, dass hier in der etwas abgelegenen »Gerbermühle« mit ihrer guten Küche und diskreten Bewirtung sozusagen ideales Geschäftsklima herrsche.
Als sie ihre Rechnungen bezahlt hatten und dem Ausgang zustrebten, erhob sich an einem der hintersten Tische des langgestreckten Raumes eine Frau, wohl Mitte dreißig, hoch und schlank gewachsen, mit langen brünetten Haaren. Eine gepflegte Erscheinung im modisch geschnittenen Hosenanzug. Sie hatte Kopfhörer getragen, nahm sie ab und verstaute sie in ihrer großen Handtasche. Sie verließ mit zügigem, aber nicht eiligem Schritt den Speisesaal, trat hinaus. Das Tuckern zweier Schlepper klang vom Main herauf.
Vor der Tür des Restaurants zog sie ihr Smartphone aus der Tasche, photographierte die aushängende Speisekarte, wandte sich aber rechtzeitig zum Parkplatz um, auf dem die beiden Professoren gerade auf einen größeren BMW zusteuerten. Ein ganzes Stakkato von Klicken verriet, dass sie die beiden beim Einsteigen in einer Serie von Photos festhielt. Als der BMW rückwärts setzte, kehrte sie sich nochmals der Speisekarte zu, als wolle sie sich eine Einzelheit besonders einprägen, ging dann auf einen weißen VW-Beetle Cabrio zu, stieg ohne große Eile ein, wendete und verließ den Parkplatz im Schritttempo. 45 Minuten später konnte man das Auto auf dem weitläufigen Parkgelände des FAZ-Verlagsgebäudes einparken sehen. Die Fahrerin war noch nicht ausgestiegen, da rangierte ein blauer Passat in die Lücke neben ihr. Sie waren Kollegen, das verrieten schon die F - AZ-Zulassungsschilder an ihren Autos, und begrüßten sich freundlich.
»Hallo, Sigrid. Immer noch am selben Fall dran?« fragte der Neuankömmling, ein untersetzter, gerade noch nicht korpulenter junger Mann, den man sich eher in einer Kantinenküche als in einer Zeitungsredaktion vorgestellt hätte.
»Und wie! Ein aufschlussreiches Mittagessen, von dem ich gerade komme. Schade, dass meine Aufzeichnung noch nicht gerichtsverwertbar ist.«
»Bist du so nahe herangekommen?«
»Ist heute ja gar nicht mehr nötig. Ich saß bestimmt 15 Meter entfernt, beste Aufnahmequalität.«
»Und was jetzt?«
»Muss ich mit dem Chef besprechen. Wahrscheinlich werde ich die Informationen als Vermutung präsentieren, nach komplizierter Recherche und so … In der Art eben. Oder zunächst auf Halde legen, weiter machen und später mit einbauen, wenn ich auf verwertbare Informationen gestoßen bin, zum Beispiel von einem Informanten, der ausgestiegen oder unzufrieden oder einfach ein ›glücklicher Verräter‹ ist, wie wir die Typen nennen. Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen.«
»Ob sich das Dranbleiben lohnt?«
»Hundertprozentig! Das ist ein ganzes Netz, da sind nicht bloß hiesige Institute beteiligt. Mindestens noch die Uni Tübingen.«
»Dann viel Glück!«
Die beiden Journalisten trennten sich und steuerten das Verlagsgebäude nach verschiedenen Richtungen an.
Ihren Arbeitsplatz erreichte Sigrid Stern nach einigen Begrüßungen in Flur und Fahrstuhl. Sie fuhr den PC hoch, doch bevor sie ihre Beute sichern konnte, entdeckte sie die kleine Nachricht.
»Der Schönheit Fürstenmajestät / wenn Deine hochaufragenden Beine / über mir / den Geist betäuben und die Sinne rasend machen.«
Sie lächelte. Hans Seliger war ein verhinderter Poet, seine Preisungen ihres Körpers füllten zuhause eine ganze Schachtel, denn sie kamen zwar per Mail, doch schrieb sie sie gleich ab und löschte sie sofort. »Sozusagen aus Sicherheitsgründen«, hatte sie ihm nach seiner ersten Botschaft gesagt, die noch viel indiskreter war als die heutige, eine Reminiszenz an ihre erste Nacht. »Redaktionen leben schließlich davon, Geheimnisse zu lüften, gerade die verschlüsselten.«
Er war ihr erster Informant in der Sache, die sie gerade verfolgte, gewesen. Er hatte in der Mensa Bruchstücke eines merkwürdigen Gesprächs mitbekommen. Zwei wissenschaftliche Mitarbeiter eines benachbarten Instituts, die er vom Sehen kannte, hatten sich beschwert, dass sie trotz ungewöhnlicher Überstunden »vom Gewinn nichts sähen«, obwohl es in ihrer Hand läge, »das Ganze hochgehen zu lassen«. Seliger hatte ihr vor Monaten davon erzählt. Später war ein Kollege auf ihn zugekommen und hatte von undurchsichtigen Geschäften in einem benachbarten Institut berichtet und da hatte sie Lunte gerochen.
Sie lächelte in sich hinein. Ein wirklich gutes Team, sie beide, im Bett und auf der Jagd!
Auf den gemeinsamen Abend freute sie sich schon jetzt.
Am Morgen wachte Kersting von einem eintönig sich wiederholenden Klopfen auf, das er zunächst noch in seinen Traum hatte einbauen können (natürlich war es da Jana, die an seine Schlafzimmertür klopfte und verführerisch strahlend eintrat); dann aber verscheuchte die beharrliche Fortdauer des Geräuschs die anregenden Traumbilder.
Wer wollte so früh etwas von ihm: halb acht zeigte die Uhr auf dem Büchertischchen neben dem Bett? Und warum benutzte der unbekannte Besucher nicht die Haustürklingel? Wobei ihm im selben Augenblick einfiel, dass der kleine weiße Knopf, den man schließlich drücken musste, vor ein paar Tagen herausgefallen war und er nicht mehr ans Reparieren gedacht hatte.
Er setzte sich schnell auf, sprang, noch mit seinem Traumbild im Kopf, aus dem Bett und lief die Treppe hinunter. Eben wollte er die Haustür öffnen, da kam ihm noch rechtzeitig der Gedanke, dass die Ereignisse der letzten Tage zur Vorsicht rieten.
»Ja, bitte, wer ist da?«
Eine Frauenstimme: »Ich … also Sophie Jansen, wir haben uns …«
Kersting ließ sie gar nicht aussprechen und öffnete. Vor ihm stand mit etwas verlegenem Gesichtsausdruck die Linguistin, die ihm von Verena Roeders Interesse an sprachmystischen Spekulationen erzählt hatte.
»Oh, ich sehe … entschuldigen Sie, es ist noch sehr früh, aber seit wir über Verena gesprochen haben, komme ich innerlich nicht zur Ruhe. Ich habe die ganze Nacht über die letzte Begegnung mit ihr nachgedacht …«
»Kommen Sie nur ruhig herein, wenn Sie mein Aufzug nicht stört. Ich mache uns schnell einen Kaffee.«
Kersting führte seine Besucherin in die Wohnküche und verschwand, um Jeans und Pullover überzustreifen.
Während er am Herd hantierte, entschuldigte sich Sophie Jansen nochmals für die frühe Störung. Er beruhigte sie mit ein paar Worten.
Als sie einander gegenübersaßen, die großen Henkeltassen vor sich, ein paar Kekse hatte er auch noch gefunden, sah er sie fragend an.
»Dass Verena in meinem Seminar war, wissen Sie. Ich mochte sie, sie war eine Stütze in den meisten Diskussionen, immer gutvorbereitet, belesen weit über die Pflichtlektüre hinaus. Wenn wir uns außerhalb des Seminars trafen, also … natürlich in meiner Sprechstunde, haben wir manchmal weiter diskutiert, so engagiert war sie. Wenn sie auf irgendein neues Problem gestoßen war, wollte sie meine Meinung darüber wissen.«
Während Sophie Jansen erzählte, rutschte ihr Blick immer wieder nach oben an die Decke, was Kersting schon bei ihrer früheren Begegnung irritiert hatte, weil er ihm unwillkürlich folgte: als sei dort tatsächlich etwas zu sehen.
»Ich habe auch von allen gehört, dass sie eine außergewöhnlich fleißige, wissenschaftlich interessierte Studentin war«, warf er ein. »Das hat aber kaum etwas mit ihrem Tod zu tun?«
»Nein. Sicher nicht und auch nicht damit, dass ich Sie so früh am Morgen störe«, ergänzte sie mit etwas künstlichem Lächeln. »Was mir keine Ruhe lässt, war einer ihrer Besuche vor fast einem Jahr in meiner Sprechstunde. Sie war gerade aus der Provence zurück, wo ihre Freundin tödlich verunglückt war. Ich war eine der ersten, die sie hier aufsuchte, um davon ausführlich zu erzählen, noch vor ihren Eltern in Bremen.«
»Was hat sie beunruhigt?«
»Sie machte einen ganz widersprüchlichen Eindruck, versprach sich oft. Fast so als fühle sie sich, wie soll ich sagen, verantwortlich für den Unfall.«
»Verwunderlich ist das nicht.«
»Ja sicher. Aber der Bericht war so seltsam, oder vielmehr die Art, wie sie redete. Ihre Freundin, das wissen Sie, war von einer hohen Mauer abgestürzt, als sie ein Photo von ihr machen wollte, jede Hilfe kam zu spät. Beunruhigt haben mich bei ihrer Erzählung vor allem zwei Dinge: die detaillierte Genauigkeit, mit der sie den Hergang schilderte …«
»Nun, das war wohl Folge der Verhöre durch die französische Polizei, da wurde sie sicher wieder und wieder nach dem genauen Hergang gefragt.«
»Sollte man da nicht meinen, sie meidet es, sich nun Schritt für Schritt hier wieder das ganze Geschehen vor Augen zu führen? Mir kam es vor, als wollte sie sich rechtfertigen. Vielleicht, dass sie nicht rechtzeitig die Gefahr sah, dass die Idee für diesen Standort auf der alten Stadtmauer von ihr kam – sie behauptete zwar das Gegenteil – ich weiß es nicht.«
»Nun, diffuses Schuldbewusstsein ist in solchem Fall nicht ungewöhnlich.«
»Sie fühlte sich aber gar nicht schuldig. Das war das zweite, was mich befremdete. Sie berichtete ganz sachlich, unbeteiligt, wie man ein Ereignis schildert, das interessant ist, aber nicht persönlich berührt, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
»Könnten verdrängte Motive dafür verantwortlich sein? Wie war das Verhältnis der beiden Frauen?«
»Sie waren weitläufig verwandt, glaube ich.«
»Mochten sie sich?«
»Sonst wären sie wohl kaum miteinander in den Urlaub gefahren.«
»Sie sprachen von zwei befremdlichen Eindrücken.«
»Ja, da war noch etwas … Kaum fertig mit ihrem Unfallbericht, kam sie auf ihre sprachlichen Beobachtungen, auf die Unterschiede des Okzitanischen (das sind die in der Provence gesprochenen Sprachen), in Marseille und Nizza. Wo sie mit alteingesessenen Leuten hatte sprechen können. Da änderte sich der Ton ihrer Stimme, da war sie plötzlich ganz dabei.«
»Scheint mir auch psychologisch plausibel.«
»Mag ja sein. Aber alles zusammen genommen … Nicht bloß besorgt, fast verstört wirkte sie, als sie von einem fünfjährigen Jungen berichtete, der das Unglück mitangesehen haben müsste (er habe an einem Fenster gestanden), aber sich an nichts erinnern wollte. Komisch fand ich auch, dass sie es geradezu auffällig vermied, von dem Ehemann zu sprechen, geschweige mit ihm. Als ich sie darauf ansprach, wich sie aus, sie habe ihn brieflich gebeten, ihr eine Frist einzuräumen, sie könne ihm jetzt nicht gegenübertreten.«
»Liebe Frau Jansen, das ist doch verständlich, beides verständlich!«
»Schon. Der eigentliche Stein des Anstoßes kam zum Schluss. Um ihr Mut zu machen, doch mit dem Ehemann zu sprechen, sagte ich darauf so etwas wie: Decker, obwohl ausgefuchster Jurist, sei in der Uni als rücksichtsvoll und entgegenkommend bekannt. Und dann kam es: ›Ein wunderbarer Mann‹, entfuhr es ihr, und das mit einer – es ist nicht zu viel gesagt – Inbrunst, die mich erschreckte.«
Der Besuch von Sophie Jansen ließ Kersting etwas ratlos zurück. Warum sie ihn so frühmorgens heimgesucht hatte, war ihm auch nach ihrer Erzählung nicht plausibel geworden. Alles, was sie ihm von dem Gespräch mit ihrer Studentin mitgeteilt hatte, erschien ihm wenig verwunderlich. Vielleicht mit Ausnahme des offenbar so gefühlvollen Schlussakkords »Ein wunderbarer Mann.« Aber selbst das …
Ihm war etwas unwohl, als er noch einmal den Verlauf der letzten Stunde an seinem inneren Ohr vorbei passieren ließ.
Da störte sie ihn am frühen Morgen auf, obwohl sie sich nur flüchtig kennengelernt hatten. Und dann erzählte sie ihm eine völlig unspektakuläre Geschichte, die eigentlich nur eine Wirkung haben konnte: Verena Roeder in seinen Augen in ein Zwielicht zu setzen. Aber vielleicht war das der Zweck der morgendlichen Unternehmung? Oder mehr noch. Vielleicht hatte Frau Jansen ihm ihre Version von Verenas Tod einflüstern wollen. Eine verwirrte junge Frau in einer Lebenskrise, belastet durch ein unglückseliges, quälendes Erlebnis – möglicherweise deshalb lebensmüde?
Auf der anderen Seite hatte sie ihn daran erinnert, dass es noch einige lose Fäden gab, die er eigentlich hatte wieder aufgreifen wollen. Durch Jana war ihm der Fall Verena etwas fern gerückt. Paradox eigentlich. Denn er hätte sie ohne das Schicksal ihrer Freundin gar nicht kennen gelernt. Jansen hatte ihn auch an Müller-Riedel und den seltsamen Zettel denken lassen, den er zu enträtseln begonnen hatte. Auch an Franz Buch, den auskunftsfreudigen Assistenten, dem er trotz seines biederen Äußeren nicht recht über den Weg traute. Und durch ihn an seinen Kollegen Sautter, der inzwischen aus Berlin wieder zurück sein konnte.
Der so früh angefangene Sonntag eignete sich leider nicht dazu, diese Spuren weiter zu verfolgen.
Fast widerwillig verließ er die Küche, stieg die Treppen hinauf ins Atelier, wo der »Tanz der Prospekte« (so nannte er inzwischen das angefangene Bild von der Neckarfront) auf ihn wartete. Das große Fenster schaute auf die Weinberge nach Nordost, und er zog das rechte der drei weißen Rollos herunter, weil noch einige Strahlen der Morgensonne hereinfielen. Über einem Stuhl hingen sein Schlafanzug und der Morgenmantel. Er war alles andere als ein Ordnungsfanatiker, obwohl ihn Christa im Scherz öfter »penible« genannt hatte, doch die abgelegten Kleider störten ihn jetzt und er brachte sie ins Schlafzimmer, bevor er sich der Staffelei zuwandte.
Kersting arbeitete konzentriert, einige Details des noch fragmentarischen Bildes gewannen neue Gestalt. Auf den ineinander gespellten drei Balkonansichten auf der Rückseite des Zimmertheaters zum Neckar hin drängten sich bald Masken in taumelnder Bewegung, zwischen ihnen ein hageres Gesicht mit verschreckt blickenden Augen, die rechte Hand nach oben in die Luft greifend, wie vergeblich dort Halt suchend. Kersting überlegte einen Augenblick, ob er dem verzweifelnden Hölderlin eine Vision Suzette Gontards vor die Augen stellen sollte, entschied sich aber dagegen: nicht aus historischer Gewissenhaftigkeit heraus, es wäre einfach eine Assoziation zu viel gewesen und mehr ein literarischer denn ein malerischer Einfall.
Als das Licht schwächer wurde, brach er ab, stand eine Zeitlang ruhig vor der großen Leinwand. Hölderlins Gesicht, das einzige menschliche unter all diesen aberwitzigen Masken, kam ihm wie eine Botschaft vor. Der Roeder-Fall wirkte gleich einem Wahrheitsserum, das alle Menschen, die darin verwickelt waren, veränderte. Und nicht nur die Menschen, auch ihre Umwelt, ihre Geschäfte, ihre Wirkungen. In der Fassade der Normalität, des Alltäglichen zeigten sich Risse. Die malerische Stadt mit ihrem so seriös, so objektiv erscheinenden Wissenschaftsbetrieb verwandelte sich mehr und mehr in eine Potemkinsche Täuschung.
Kersting löste sich aus solchen Gedanken, reinigte Pinsel, Schaber und Palette. Er hatte ohne Pause durchgearbeitet und verspürte zwar heftigen Hunger, brauchte aber noch einen Übergang in die Wirklichkeit. Er grinste spöttisch über sich selber, holte das noch nicht wieder verpackte Roulettespiel aus dem Regal, schnippte den Kreisel an und brachte die Kugel auf Anhieb in die fünfhunderter Kuhle.
Jetzt stieg er zufrieden hinunter in die Küche, schnitt Zwiebeln, würfelte Knoblauch, fischte ein paar Sardellen aus der Salzlake. Ließ alles in einer Pfanne in reichlich Olivenöl leicht Farbe annehmen, brühte drei reife Tomaten, schälte ihre Haut ab und schnitt sie in kleine Würfel. Die Hälfte ließ er in die Pfanne gleiten, erhöhte die Hitze und gab mittelscharfen Paprika, Basilikumsalz, Pfeffer dazu, ließ alles leicht köcheln und rührte dabei mit dem Holzlöffel bis eine cremige, aber nicht zu glatte Sauce entstand. Inzwischen waren die Spaghetti gar geworden, er pürierte sehr grob die zweite Hälfte der Tomatenwürfel, fügte sie zur Sauce, die er vom Herd nahm, streute kleingeschnittene Basilikumblätter und (seine Zutat) den Mus von zwei kleinen, frisch gepressten Knoblauchzehen hinzu, schmeckte noch mit Salz und Pfeffer ab und setzte sich zufrieden an den Tisch, wo er schon eine Flasche Rotwein aus dem Cahors bereitgestellt hatte. Vor dem Haus gingen die Straßenlaternen an, die nun alle wieder brannten. Der Himmel hatte sich bewölkt, morgen sollte es regnen, wie die Wetter-App ihm verriet. Er freute sich auf die erste Sitzung mit Jana. Sie hatten sich auf 15 Uhr verabredet.