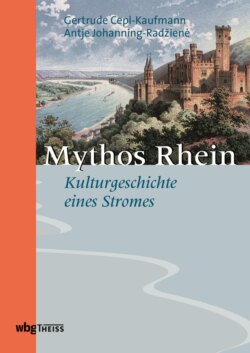Читать книгу Mythos Rhein - Gertrude Cepl-Kaufmann - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Stolze Städte und Kirchen
ОглавлениеParallel zur beschriebenen ländlichen Gemeindebildung zeichnete sich die Genese einer Bevölkerungsgruppe bestehend aus Händlern, Kaufleuten und Ministerialen ab, die nicht mehr von der Landwirtschaft lebte. Als Städte galten bislang vor allem die großen Bischofssitze Köln und Trier, in denen sich seit der Römerzeit Bruchstücke einer urbanen Kultur erhalten konnten (Abb. 4). Im Jahre 1073 wurde der Bischof von Worms von den Bürgern vertrieben und Kaiser Heinrich IV. in die Stadt aufgenommen. Dieses Ereignis kann als Beleg für das Aufkeimen eines städtisches Bewusstsein gewertet werden. Auch die Revolte der Kölner Bürger nur ein Jahr später, 1074, gegen ihren Stadtherrn Erzbischof Anno II. wie auch die Opposition der Trierer Bürger über 50 Jahre später gegen die Erhebung des Erzbischofs Albert von Montreul veranschaulichen eine Tendenz, die im 13. Jahrhundert zu einem regelrechten Kampf zwischen der zumeist kirchlich-fürstlichen Obrigkeit der Stadt und des Landes und den kommunalen Autonomiebestrebungen führte. Dennoch sind Territorialisierung und Urbanisierung nicht als Gegensätze zu begreifen, sondern als eng verzahnte Phänomene. So waren Städte und Burgen visuelle Markierungen wie auch Ausdruck des aufkommenden territorialen Denkens, während das Territorialfürstentum auf der anderen Seite die sich herauskristallisierende Sonderstellung der Städte zu nivellieren suchte.
Der Urbanisierungsschub des Hohen und vor allem des Späten Mittelalters führte dazu, dass es im Rheinland des ausgehenden Mittelalters um die 180 Orte mit Stadtrechten gab. Davon allerdings waren drei Viertel so genannte „Minderstädte“ mit weniger als 1000, teilweise sogar weniger als 500 Einwohnern. Allein Aachen, Trier und Köln mit über 10.000 Einwohnern können als Großstädte bezeichnet werden. Gemessen am europäischen Urbanisierungsgrad – als Vorreiter galt Italien – nehmen sich allerdings selbst die rheinischen Großstädte nur ‚winzig‘ aus. So zählte das ‚Stadtungetüm’ Paris um 1250 bereits über 100.000 Einwohner und in Italien finden sich allein sechs Großstädte mit mehr als 50.000 Bewohnern.16 Selbst Köln als größte deutsche Stadt mit fast 40.000 Einwohnern würde im europäischen Vergleich kaum in den Rang einer Metropole aufsteigen. Dennoch war sie es, die nicht nur den lokal orientierten, rheinischen Handel bestimmte, sondern auch führend im deutsch-europäischen Güterverkehr wurde. Neben den regen Handelsbeziehungen zu Antwerpen verfügte die einzige rheinische Stadt mit Stapelrecht über wirtschaftliche Beziehungen zu Italien und Frankreich. Bis 1267 dominierte sie selbst den Warenverkehr zwischen Deutschland und England und hatte die führende Rolle im Städtebund der Hanse inne. Erst Ende des 13. Jahrhunderts konnten Hamburg und Lübeck ihre Position gegenüber Köln verbessern, ablesbar an der gemeinsamen Gründung der deutschen Hanse in London.
Die sich hier in ökonomischer Hinsicht abzeichnende Orientierung zum Westen hin findet sich auch auf allgemeiner, kultureller Ebene wieder. Durch die mit Rudolf von Habsburg beginnende Verlagerung des Königtums nach Osten rückte das Rheinland zunehmend aus der Mittel- in eine Randlage. Damit wandelte es sich mehr und mehr von einer ‚Königslandschaft‘ zu einer königsfernen Region. Insbesondere das Niederrheingebiet öffnete sich zum Westen hin. Während die Beziehungen zum südlichen Rheinland langsam abbrachen, verstärkten die niederrheinischen Grafenhäuser ihre Verbindungen zu den Niederlanden und besetzten nicht selten die Bischofstühle in Lüttich und Utrecht. Das sich zudem ausbildende Netz verwandtschaftlicher Beziehungen führte allerdings auch dazu, dass das Rheinland zum Objekt westeuropäischer Bündnispolitik wurde, beispielsweise im Hundertjährigen Krieg zwischen England und Frankreich als Bundesgenosse, aber auch mit Blick auf die nicht abklingenden Annektionsabsichten. Während sich die Territorien am Niederrhein zunehmend dem Westen zuwandten, ließ insbesondere die Kölner Aktivität in der Reichspolitik nach.
Abb. 4: Die wirtschaftliche Blüte einer Stadt wie Köln zeigte sich in der Fassade ihrer Bürgerhäuser, dem prunkvollen Rathaus mit seinem Renaissanceturm und einem lebhaften Markttreiben. Im Gegensatz zu den häufigen Panoramadarstellungen der Stadt, in der der Kranz der Kirchen die Rheinfront bestimmt, konzentriert sich die Darstellung auf der Zeichnung von Toussyn auf das bunte Treiben auf dem „Alter Markt in Köln“um 1660.
Neben den Großstädten Köln und Trier mit 12.000 und Aachen mit 10.000 Einwohnern waren es größere und kleinere Mittelstädte, die sich wenigstens im regionalen Wirtschaftsleben etablieren konnten. So zählten zu den größeren Mittelstädten beispielsweise Wesel mit 7000 und Neuss mit 5.000 Einwohnern, während die Kategorie der so genannte kleineren Mittelstädte mit 2.000 bis 5.000 Bewohnern eine ganze Reihe von Städten umfasste: Neben Emmerich, Kleve, Rees und Kalkar sind hier z.B. Duisburg, Düsseldorf, Düren, Bonn und Koblenz zu nennen. Die Ausbildung eines kommunalen Selbstbewusstseins war aber nur in größeren Städten wie den Bischofsstädten Köln und Trier möglich, wo sich eine Autonomiebewegung abzeichnete. Zunehmend drängten reiche Kaufleute und stadtherrliche Ministeriale auf Selbstverwaltung und Selbstbestimmung. Zunächst übernahmen stadtherrliche Schöffenkollegien die Aufgaben der gemeindlichen Verwaltung, mit dem Ziel, die gemeindliche Gerichtsbarkeit, die Steuer- und Befestigungshoheit in die Hände der Bürger zu bringen. Dagegen suchten die stadtherrlichen Bischöfe Widerstand zu leisten und die Einflüsse der städtischen Gremien zu beschneiden. Während es Trier und Köln gelang, sich als autonome Städte mit Gerichtsgewalt und Verwaltungshoheit zu behaupten, mussten sich die Territorialstädte weiterhin ihrem Stadtherrn als Landesherrn unterwerfen. Ihre Stärke lag in den kooperativen Zusammenschlüssen als Landstände auf der Basis der Territorialverfassung. Im Zuge dieser landständischen Bewegung bildete sich seit dem 13. Jahrhundert zunehmend ein territoriales Solidaritätsgefühl aus, das auf eine Mitbestimmung der Stände bei der Regierung des Landes abzielte. Diese Mitregierungsansprüche, die schließlich zur Entstehung einer landständischen Verfassung und zur Einrichtung von Landtagen führte, schufen eine zweite ständische und bürokratisch agierende Macht neben der autokratischen Landesherrschaft. Die insbesondere in Köln zu beobachtende Entwicklung einer zunehmenden Ablösung der bischöflichen Stadtherrschaft zugunsten einer städtischen Selbstverwaltung bedeutete allerdings weniger ein demokratisches Partizipieren der Einwohnerschaft an den Regierungsgeschäften, als die Herausbildung einer reichen Oberschicht, die die Regierungsgeschäfte aristokratisch leitete (Abb. 5).
In der seit 1182 existierenden „Richerzeche“ versammelten sich die reichsten und vornehmsten Kölner Bürger. Sie hatten nicht nur die Markt- und Zunftaufsicht, sondern ebenfalls das Recht der Bürgermeisterwahl. Die im Rat und im Schöffenkollegium vertretenen Familien, die so genannten Geschlechter, hielten die Macht in Händen, während das Gros der Bevölkerung an den Regierungsgeschäften nicht beteiligt war. Erst 1396 kam es zum Sturz dieser „Geschlechterherrschaft“ mit einer Neuordnung der Stadtverfassung. Zukünftig ist das mächtigste Gremium der Rat der Stadt, der einmal im Jahr durch die 22 Gaffeln gewählt wurde und den Bürgermeister stellte. Obwohl hier eine Form der Demokratisierung angelegt war, da sich die Gaffeln als politische Korporationen aus den Zünften zusammensetzten, bildete sich bald wiederum eine Schicht ratsfähiger Familien heraus, in deren Händen die Regierungsgeschäfte lagen. Dies führte zu Spannungen in der Kölner Bürgerschaft, die 1481/82 und 1512/13 in innerstädtischen Unruhen gipfelten.
Abb. 5: Bevorzugtes Bildobjekt war der Kranz der Kirchen im „hilligen Köln“. Die idealisierte Darstellung erfasst das Rheinpanorama vom heutigen Bayenturm bis zur romanischen Kirche St. Kunibert. In der Bildmitte erkennt man das Rathaus, auf der rechten Bildhälfte den unvollendeten Dom, diesseits des Stromes das ländlich wirkende Köln-Deutz. Kupferstich 1616. Aus: P. Bertii commentariorum rerum Germanicarum Libri Tres, p. 502.
Neben Köln bestimmte auch Aachen das ländliche Exportgewerbe des nördlichen Rheinlands, das im Gegensatz zu den südlichen Gebieten in manchen Gewerbebereichen protoindustrielle Züge ausbilden konnte. So wie im Herzogtum Jülich und im oberbergischen Kreis Eisen gewonnen wurde, die Nordeifel von Buntmetallabbau geprägt war, so entstand in Aachen durch das Messing- und in Solingen durch das Kleineisengewerbe eine rege Geschäftstätigkeit. Die sich hier in wirtschaftlicher Hinsicht abzeichnende Nord-Süd-Zweiteilung des Rheinlandes spiegelt sich auch in der territorialen Raumordnung wider. Wie bereits beschrieben, konnten sich am Niederrhein neben Kurköln die Herzogtümer Jülich, Kleve, Geldern und Berg etablieren und zusammen mit den Herrschaften Heinsberg, Randerath, Blankenburg und Löwenberg ein eng geknüpftes Netz aus verwandtschaftlichen Beziehungen entfalten, während im südlichen Rheinland neben Kurtrier nur unbedeutende Zwergterritorien zu finden sind.
Insgesamt war es die wirtschaftliche Potenz, die in den Städten kulminierte und die zahlreichen Kulturleistungen hervorbrachte, für die nicht zuletzt die Universitätsgründungen in Köln 1388 und Trier 1473 stehen. Auch die zahlreichen religiösen Zeugnisse wie die gotischen Kirchenbauten, die Altarbilder, Heiligenfiguren und Kruzifixe trugen zum kulturellen Hochstand bei. Sie weisen auch darauf hin, dass die Abgrenzung der Bürgerschaft gegenüber der bischöflichen Stadtherrschaft keine Abwendung von der Kirche bedeutete. Vielmehr zeichnete sich das Spätmittelalter durch eine neue kirchenzugewandte Frömmigkeit aus, die sich auch in den zahllosen Stiftergeschenken und in der Heiligenverehrung wiederfand. Hungerkatastrophen, der Einbruch der Pest in der Mitte des 14. Jahrhunderts, die sich in der Folgezeit wiederholenden Pestwellen, die zu einer starken Dezimierung der Bevölkerung führten, und das große Kirchenschisma von 1378 hatten zur Folge, dass Unsicherheit und Todesfurcht das Leben bestimmten und die Bevölkerung in Passionsfrömmigkeit, Reliquienkult und Pilgerschaft ihr Heil suchte. Insbesondere Köln und Aachen zogen mit ihren Reliquien wie dem Dreikönigsschrein Scharen von Pilgern zu Prozessionen und Wallfahrten an. Ikonographisch spiegelte sich das neue religiöse Bewusstsein um Not und Leiden des irdischen Daseins in Schmerzensmann- und Pietà-Darstellungen und fand in den sich kasteienden Büßerscharen nach dem Pesteinbruch 1349 ihren übersteigerten Ausdruck. Nicht nur die Selbstkasteiung, die schließlich von der Kirche verboten wurde, auch das größte Judenpogrom des Mittelalters wurde durch die Pestwelle ausgelöst und dezimierte die Bevölkerung in Worms, Frankfurt und Mainz, den Orten mit den größten jüdischen Gemeinden im Rheinland. Mit der Aufkündigung des Bürgerrechts und der zunehmenden Gettoisierung der jüdischen Stadtbevölkerung kündigte sich bereits Jahrzehnte zuvor die nun ausbrechende gewalttätige Verfolgung an, die vor allem von den Städten ausging. Es sind allerdings nicht diese Auswüchse des religiösen Lebens, die in späteren Jahrhunderten das Interesse auf sich zogen. Vielmehr ist es die gotische Kirchen-Baukunst, die zum Inbegriff des Mittelalters wie auch einer deutschen Kunst arriviert.
Während sich das Spätmittelalter durch eine Herrschaftsverdichtung auf territorialer Basis und durch die Blüte der städtischen Kultur mit Handels- und Wirtschaftsvielfalt auszeichnete, war die als frühe Neuzeit zu bezeichnende Phase ab 1500 durch Glaubenskämpfe und Erbfolgekriege gekennzeichnet. Auch die Zeit des Ancien Régime (1648–1794) ist durch Kriege geprägt, die oftmals das Rheinland berührten, es verwüsteten und das sich nun langsam abzeichnende Ende der „stolzen Städte“ und der „Burgenherrlichkeit“ bewirkten.