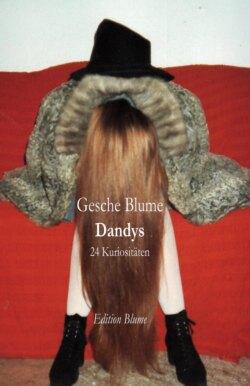Читать книгу Dandys - Gesche Blume - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Langeweile ist blau
ОглавлениеLangeweile ist blau. Man kann sie in der Mitte tranchieren, gleich einem Backhähnchen, am besten mit einem spitzen, frisch geschliffenen Messer. Je nach Jahreszeit und Witterung haben die Eingeweide der blauen Langeweile eine andere Beschaffenheit. Im Winter kriechen die Würmer etwas weiter unter die Erde, in ein oder zwei Metern Tiefe überwintern sie. Für jede Frau, die er in seinen kalten Betten liebte, entzündet Didier eine Kerze, die lässt er solange brennen, bis sie von selbst erlischt. Im Haus klebt der Fußboden vom Kerzenwachs, die Geisterstädte eines Bienenstaates bedecken die Fensterbänke. Manchmal steht eine Frau hinter ihm, während er sich an dem steinharten Boden zu schaffen macht, er dreht sich herum, ihr Gesicht ist hell im Winternebel, denn in dem alten Park erscheinen die Gesichter aller Frauen gleich. Ihre Stimmen sind ein Chorgesang. „Erinnerst du dich noch an unser altes Glück“, singen sie, und er antwortet, warum. Warum willst du mich daran erinnern. Es ist eine weiche, unsittliche Berührung. Didier hat seine Erinnerungen längst tranchiert. Frauen lebten mit ihm unter einem Dach, und er hat die meisten von ihnen schon vergessen. Auch die Frauen vergaßen schnell, nur manchmal fragten sie Didier etwas. Manchmal, wenn das Jahr zu spät kalt wurde und es noch im April schneite.
Didier friert. Er friert oft, seit er in dem alten Elternhaus lebt. Dabei war er nie zuvor von solch blendender Weiblichkeit umhüllt. Wie ein Baby nach dem Bad hüllen die Frauen ihn ein und er fühlt sich schön. Schön wie ein wieder junger, degenerierter Aristokrat, der in seinen Gemächern eine längst verflossene Geliebte empfängt. Einen Moment hält er inne. Er kann von hier auf die steinerne Terrasse des Hauses sehen, die jetzt mit Schnee bedeckt ist. Für einige Sekunden scheint auf dem runden, in der Ecke vergessenen Tisch das verrostete Metall unter einer schweren Decke Schnee aufzuleuchten. Didier erinnert sich, diesmal nicht widerwillig. Jemand im Haus wird eine Mahlzeit zubereitet haben, damit er nicht noch dünner wird. Die Frauen, denen er das achtstündige Brennen einer Kerze widmet. Doch er weiß, dass dies schon lange nicht mehr stimmt. Als Emma noch lebte, hatte er niemals die dunklen Krawatten angelegt. Er folgte den Marotten einer Frau, die nur helle Farben an ihm mochte. Als Emma starb, verlor er vorübergehend seine Manneskraft und erschien danach komplett in Schwarz. Die kurzen Affären, die Emma später noch nachfolgten, waren so beeindruckt von seiner ernsten Garderobe, dass er sich hütete, von ihr Abschied zu nehmen.
Nur die Angestellte, die ihm täglich das Essen bringt, kommt jetzt noch zu ihm. Didier verbietet seiner Putzfrau, die Gegenstände vom erkalteten Wachs zu reinigen, doch akkurat um sie herum liegt frischer Glanz.
Frühzeitig, weiß Didier, wurde er in Beschlag genommen. „Didier, mein Junge, steh auf und sag deiner Mutter, dass ihr die Brille gut steht. Didier, Lieber, schau, der neue Hut.“ Streifen Sonne fuhren wie Scanner über Didiers Gesicht. Bitte, lass die Sonnenstreifen Trosttropfen sein. Man war so nackt, wenn die Mutter im Zimmer stand, die Vorhänge auseinanderzog und den Schlaf in den Hintern trat. Mutter hatte das Baby gewaschen, in weiße, flauschige Tücher gewickelt. Der Geruch von Kamille und Rosmarin lag über ihm. Später wurde er ein schöner Mann.
Dr. Brünner hat ihm geraten, sich noch regelmäßiger untersuchen zu lassen. „Es ist notwendig“, sagt er betont, „dass Sie alle drei Wochen wiederkommen. Sie haben ein schwaches Herz, und wenn Sie es so weiter treiben, (er hatte tatsächlich weiter treiben gesagt) riskieren Sie einen verfrühten Tod.“ Ein verfrühter Tod. Selbst beim Blick auf die wechselhaften und leeren Wolken, die den Aprilschnee bringen, ein Risiko spüren. Den bald schon wässrigen Schnee riechen dürfen. Didier sinniert über den Satz des Arztes. Er hat ihn nicht allein auf Didier bezogen, sondern auch auf seine Lebensweise. Nicht nur auf seinen Körper und seine Verfassung. Didier schätzt den Körper – doch er liebt ihn nicht. Und er hasst ihn nicht. Der Tod hat für Didier dieselbe Farbe wie die Langeweile, wie Seifenblasen. Vom Schaumbad angefangen bis zu den weißen Tabletten ist der Tod etwas, das seine Vorstellung weitet, über den Körper hinaus das Materielle und Immaterielle einschließt. Warum also soll er ihn nicht riskieren. Didier entfaltet auf dem Hintergrund der blauen Langeweile ein Tableau aus Sinfonien und Chorälen, ein Lichtmeer aus Kerzen.
Bald nach der Mutter erschien seine Schwester Merlinde. Deren Bett hatte eines Nachmittags gebrannt. Merlinde hatte Glück, sie war draußen und schlief in dieser Nacht bei einer Freundin, hatte Bettzeug und Matratze von dem Holzgerüst gezogen und gesagt, ohne das würde sie nicht gehen. Die Eltern hatten die Aufsicht der Großmutter übertragen. Die hielt Sportlichkeit und Strategiespiele bei ihren Enkeln für angebracht. Draußen im Garten hatten die Temperaturen bis zum Mittag dreißig Grad erreicht. Die Häuser waren weit auseinander gebaut. Dazwischen hatten die Weizen- und Zuckerrübenfelder das Regiment. Am Himmel, der einer straffgezogenen Zudecke glich, klebte eine Sonne in der Mitte wie auf Merlindes Zeichnungen. Die Sonne lachte und hatte Strahlen. Die Großmutter zog die Vorhänge zu. Didier wollte nicht mit den achtjährigen Mädchen im Badeteich schwimmen, er wollte nicht der einzige Junge in einer blondbezopften Schar sein. „Du bist ein Sonnenverweigerer“, sagte die Großmutter und setzte die Hausarbeit fort. „Dein Großvater war ein Sportsmann. Geturnt hat er im Turnverein. Und du hast dünne Arme und Alabasterhaut. Keinen Klimmzug schaffst du damit. Eigentlich müsste dein Vater dich auf den Sportplatz scheuchen. Aber der amüsiert sich lieber mit deiner Mutter in der Stadt.“ Didier schloss die Tür. Seine Stärke waren Strategiespiele. Die Großmutter würde schon bald wieder nach ihm rufen, weil sie eine Partie starten wollte. In seinem Zimmer war es kühl, die Sonne schien nur in den frühen Morgenstunden herein. Ein wenig abgestanden war die Luft. Didier sah seine Regale nach einer Lektüre durch. Fand die Figuren vom Bleigießen an Silvester. Schüttelte Tannennadeln aus umgeklappten Heften. Groschenlektüre, hatte die Großmutter das genannt. Didier gab ihr Recht und suchte sie nach einem bestimmten System heraus, um dann immer wieder darin zu lesen. Die Tannennadeln verbreiteten einen blassen Geruch. Die Bleifiguren polterten auf den Boden und zeigten Didier die bizarre Strenge des Zufalls beim schnellen Sinken der Temperatur. Er ging zu seinem Schreibtisch. Man müsste die Formen erklären, bezeichnen und kategorisieren. Ein Modell entwerfen. Draußen schwammen die Mädchen und kreischten, Didier hörte es durch die geschlossenen Fenster. Sie kreischten, auch ohne dass Didier ihre Köpfe unter die Wasseroberfläche tunkte, auch ohne, dass er sie mit Wasserbomben bewarf. Didier entschied sich, Weihnachten zu spielen. Ein Weihnachten mitten im Sommer, mit der Hitze von Kerzen, dem Geruch von Tannen und Weihrauch und trockenen Holzscheiten. Er saß an seinem Tisch vor dem aufgeschlagenen Buch und hoffte, das Spiel durchführen zu können, solange er allein war. Er rannte ins Bad und schloss sich ein. Die Großmutter wischte unten den großen Wohnraum und würde nicht herauf in die Kinderetage kommen. Didier bearbeitete sein Gesicht gründlich und rieb sich mit Vaters Rasierwasser die Hände ein. Das roch nach Tannenzapfen. Er baute in Gedanken das Zimmer um. Versuchte, die Größe zu errechnen, die der Weihnachtsbaum haben müsste, damit er sein Zimmer maßstabsgetreu zum Wohnzimmer der Eltern füllen würde. Es gelang ihm auch nach einiger Mühe nicht. Er hatte in das Rechenbuch geschaut, das er nach den Ferien würde nutzen dürfen. Doch im Moment gab es niemanden, der ihm half. Didier stand auf und ging in das Zimmer seiner Schwester. Das leuchtete hinter den Vorhängen wie ein verlassener roter Salon. Oder wie ein Glutofen. Der wüste Haufen aus Gestalten von Stoff ließ Didier an Tierkadaver denken. Oma hatte zu ihm gesagt, alles was Augen hat, wird bei mir nicht gegessen, aber von euch und euren Eltern, und bald musst du das selbst tun, während sie den nackten Hühnern den Bauch auftrennte, und die Eingeweide in ihre Hände glitten. Didier hob eine der Stoffgestalten auf. Besser, er ließ sie ganz. Schon wenn er sie im Beisein Merlindes nur berührte, verzog sich ihr Mund. Hinter dem Stoffgestaltenhaufen stand das skelettierte Bett von Merlinde. Eigentlich kein Christbaum. Aber wenn er jetzt Kerzen auf dem Lattenrost verteilte, wäre das wie die Christnacht in der Kirche. Die Mutter hatte ein Kerzenlager in der Speisekammer, Abendbrot bei nüchterner Beleuchtung fand sie abscheulich.
Didier schlich die Treppe hinunter. Vorbei an der Großmutter, die jetzt die Sofas absaugte, gelangte er durch die Küche in die Speisekammer. Neben fünf Schüsseln mit Apfelkompott stand ein großes Paket mit Teelichtern. Etwas darüber, wenn Didier sich streckte, lagen Vorräte an langen Bienenwachskerzen. Didier nahm den leeren Wäschekorb, füllte alles Brenngut hinein, vergaß auch die Streichhölzer nicht. Achtsamkeit in Bezug auf die kindgerechte Verwahrung brennbarer Utensilien kann man Mama nicht vorwerfen, dachte Didier, während er den Korb vorsichtig in Merlindes Zimmer trug. Merlinde interessierte sich nicht für brennendes Feuer oder Kerzenlicht, sie wäre nie auf die Idee gekommen, damit etwas anzufangen. Und Didiers seltsame Momente umkurvte die Mutter im Geist wie ein Schlittschuhläufer Sand auf der Eisbahn. Didier schüttete die Teelichte auf den Boden. Das Mädchengeschrei im Garten war verstummt, hatte sich verstreut in alle Winde, auf die Felder, wo die Mädchen jetzt die Hunde der Nachbarn ausführten. Didier entzündete einige Lichte, stellte sie auf den Lattenrost, beobachtete die Wirkung im roten Licht des Vorhangs. Sie war wenig feierlich. Die Hitze im Zimmer betäubte ihn auch ohne die Kerzen, es roch weder nach Tannen, noch nach Weihrauch, so sehr Didier sich auch anstrengte. Er nahm eine Bienenwachskerze aus dem Korb und roch daran. Dann hielt er sie unter die kleine Flamme, gerade so, dass sie nicht erlosch und wartete, bis das Wachs weich genug war, um es auf das Holz zu drücken. Bald schon hatte er alle Kerzen aufgeklebt, keine war umgefallen, und sie brannten in Serie auf dem leeren Bett. Didier dachte nicht an Weihnachten, die Temperatur im Zimmer erreichte vierzig Grad Celsius und mehr. Didier schlief zwischen den Stoffgestalten seiner Schwester ein. Das blaue Licht in der Mitte der Kerzen wuchs.
Didiers anschließender Aufenthalt im Krankenhaus, das eingewickelte Gesicht, die Tabletten gegen die Schmerzen hatten ihn vom Stubenarrest entbunden. Niemand tadelte ihn für das, was er getan hatte, er bekam Unterricht im Schwimmen und Turnen, als seine Haut geheilt und vernarbt war. Der Kinderpsychologe war nett zu ihm. Er hatte eine wenig aufdringliche Art. Vieles in Merlindes Zimmer hatte man retten können. Später hatte ein plastischer Chirurg Didiers vernarbte Wange wieder vollständig hergerichtet.
Die Putzfrau fegt den Aprilschnee von der Terrasse. „Damit Sie wieder treten können. Am Ende stürzen Sie noch.“ Die Mundwinkel ihrer Tochter zucken im Verborgenen spöttisch. Jeden Tag holt sie in der unbeständigen Witterung die Mutter mit ihrem Mini ab und hofft, dass es kein Glatteis mehr gibt. Jeden Tag sieht sie hinter den hohen Terrassenfenstern den seltsamen, noch stellenweise attraktiven Mann. Ein Knochenfisch, ein Fossil. Ob ein Knochenfisch sich wohl in die Tochter seiner Putzfrau verliebt. Das Haus, von außen langweilig und dreckig, birgt im Inneren einen Schatz. Doch die graue, trübe Landschaft mit den Feldern und Grasnarben, mit den verblichenen Bauten bringt die Tochter auf den Gedanken, dass diese Dinge in die Vergangenheit gehören und dort bleiben sollten. Er hat wohl sein Gesicht zu oft in die pralle Sonne gehalten. Braune Haut galt einmal als schön. Didier hat erst spät damit begonnen, seine Haut von der Sonne tönen zu lassen. Während der Schwimm- und Turnstunden, die seiner Rekonvaleszenz – und letztlich auch seiner Rehabilitierung dienen sollten, blieb er vornehm blass – ein unangenehmer Zustand vor all den braungebrannten Sportskanonen. Doktor Babyhaut nannten sie ihn.
Der Name, erzählt er, habe ihm später Geld eingebracht. Er ließ sich von einer Agentur buchen und fotografieren, für einen Prospekt. Vierzig Hauttafeln, hieß der. Eine Provokation war er. Die Kerzen auf dem Bett seiner Schwester hatten standgehalten, sie waren nicht heruntergefallen, nicht einmal verbogen hatten sie sich. Sie hatten gehalten, bis ihr Wachs zu weit verbrannt, die Flammen zu nah an das Holz geraten waren.
Eine Frau, älter als Didier, hatte an einem grauen Donnerstag im Februar ihm in einem geduckten Büro gegenüber gesessen. „So soll das aussehen. Ein Bild von Ihnen für uns. Und für jedes weitere bezahlen wir Sie selbstverständlich. Immer, wenn Sie gebucht werden.“ Die Frau hatte zu rote Lippen, einen fast schwarzen Dutt und hohe Schultern. Didier sah das Zimmer seiner Schwester vor sich, den Nachmittag, das rote Licht, die geometrisch sortierten Kerzenflämmchen, das blaue Licht im Inneren, das Koma, nach dem er sein Gesicht eine lange Zeit nicht richtig bewegen konnte. „Wenn Sie die Serie mit mir zu Ende bringen, dann zeige ich Ihnen einen Ort, an dem Sie meinen Körper mit all seinen Macken und Finessen ablichten können. Jeden Zentimeter ausnützen können. Jeden Winkel und sein Licht kann ich Ihnen erklären. Es ist das Haus meiner Eltern. Die Häuser dort sind weit voneinander gebaut. Es steht jetzt oft für Monate leer. Meine Eltern verbringen ihr Leben viel im Ausland. Übrigens, sagen Sie, ist es eigentlich normal, dass man meistens Unangenehmes träumt. Man nimmt irgendeine Irritation des Tages mit in den Schlaf, und sie bläht sich auf zu einem amorphen, monströsen Gebilde.“
Es entstanden etliche Fotomontagen. Etliche fanden auch Eingang in Zeitgeistmagazine. Viele Male verändert, montiert, retuschiert. Didier mit den Eingeweiden eines Huhns auf der rechten Gesichtshälfte, auf blauem Hintergrund. Vor einer Küchenwand. Didier hörte auf zu studieren und schrieb sich nie wieder ein. Manchmal, wenn niemand außer ihm im Zimmer war, betrachtete er seinen Körper mit Abstand und Gleichgültigkeit. Ja, die Frauen mochten ihn. Die sahen den Körper einer Chanel-Werbung. Er trennte sich von seinen Partnerinnen jedes Mal, wenn er spürte, dass er vor Langeweile bald ein Bett würde anzünden müssen. Seine Eltern zogen in ein wärmeres Land, in die Seniorenresidenz, ins altersgerechte Wohnen.
Kerzen werden angezündet. Es summen sich die Streichinstrumente an ihren Platz, die Trommeln und Triangeln markieren die Platzhalter, rollen über den offenen Raum hinweg. Die Möbel werden unter symphonischen Klängen entstaubt, ergänzt, zurechtgerückt – solange, bis Didier das Gefühl hat, sein Eigentum zu bewohnen. An einem ähnlichen Abend kochte er einmal Huhn in Kräutersoße. Es war der letzte Abend mit Emma gewesen.
Man sagt, alles Schrift- und Bildgut sei in Bibliotheken aufbewahrt. Da sei es ganz sicher. Warum gibt es dann auch dort Feuerleitern. Und Brandschutzmaßnahmen. Und warum fehlen uns oft die wichtigen Informationen. Wenn Film- und Fotomaterial verbrennt, so die Anweisung, soll man die Luft anhalten. Eine Atemmaske aufziehen. Es betrifft alle Erdlinge. „Herr Didier, ich kenne nur einige Aufnahmen aus der Serie, die mit dem Huhn.“ Die Terrasse ist nun vollständig vom Schnee befreit und zeigt ihr glattes Granitgrau. Der Himmel trägt ein tropfend schmutziges Graublau, stößt in Wolken vor und weicht zurück. Die Schneedecke auf dem Terrassentisch sinkt langsam ein. Amseldreck fällt der Putzfrau auf den Stiel des Schneeschiebers. Sie stellt ihn in die Ecke und schließt die Tür. Didier nimmt einige Kerzen, kunstvoll gedreht in drei Farben, aus dem niedrigen Einbauschrank und steckt sie in Messingständer. „Es gibt sie noch, die Fotomontagen. Aber ich hole sie nicht mehr hervor. Sie sind wellig von Hitze.“ Ein Löffel fällt zu Boden, und es klirrt nicht, denn an der Stelle klebt Kerzenwachs.