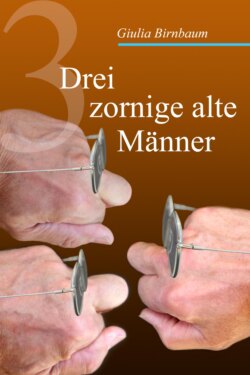Читать книгу Drei zornige alte Männer - Giulia Birnbaum - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4 / Die Gemse
ОглавлениеAm nächsten Nachmittag wollte Arnold fortsetzen, was er unter der anflutenden Betäubung nicht zu Ende gedacht hatte. Er nahm sich das Exposé des Georg Hoyer nochmals vor – nicht, weil er der Sache eine Chance gegeben hätte, sondern weil er der jungen Witwe eine Antwort schuldig war.
Er begriff, worauf ihr Mann seine Hoffnungen gesetzt hatte. Bestimmt ging es ihm nicht nur um ein einmaliges Honorar für seine Idee. Statt dessen hatte er gehofft, mit der Werbekampagne für Haruspex beauftragt zu werden – dann wären in der Tat beträchtliche Summen an sein Studio geflossen.
Arnold kannte einen Gebäudereiniger, der behauptete, er müsse sich die Häuser, die er putzen wolle, mittlerweile selbst bauen. Ebenso hatte Hoyer das Produkt, für das er werben wollte, selbst erfunden. Das war clever, hatte aber einen Haken: Wenn das Produkt den Verlag nicht überzeugt, sind alle weiteren Überlegungen hinfällig.
Er würde Anne Hoyer enttäuschen müssen. Über die Zukunft konnte man schließlich jeden Tag etwas in der Zeitung lesen. Über wirtschaftliche Sorgen und medizinische Hoffnungen. Über die Weltbevölkerung von morgen und die Mars-Mission von übermorgen. Auch über den Wolf und wann er durch die menschenleeren Städte schnüren würde. Solche Sachen.
Ein Buch, das wäre möglich gewesen, es gab wohl auch schon ein paar von dieser Art. Aber eine genießbare Zeitschrift ausschließlich mit solchem Stoff zu füllen, das war nicht vorstellbar. Nach der zweiten oder dritten Nummer musste die Zukunft den Lesern zu den Ohren herauskommen.
Er wunderte sich nicht, dass der Bernkopf-Verlag die Idee abgelehnt hatte. Es ging einfach nicht. Ob Hoyer tatsächlich einen Sprung in der Schüssel hatte – so, wie er abgetreten war? Dass ein Vorschlag abgelehnt wird, kommt alle Tage vor, das ist kein Grund, sich umzubringen.
Er rief Anne Hoyer an, zuhause, abends nach Büroschluss. Er bedauerte. Er begründete.
„Also keine Chance?“ fragte sie. „Kein anderer Verlag, der infrage käme? Keine andere Möglichkeit für das Material?“
„Ich fürchte nein.“
„Schade. Merkwürdig ist es trotzdem. Georg war ja nicht naiv.“ Ihre Stimme klang belegt. „Er war völlig überzeugt davon.“
„Was kann ich dazu noch sagen – so geht’s in der Welt. Soll ich Ihnen das Exposé zurückschicken?“
„Nein, nicht nötig,“ sagte Anne Hoyer. „Jetzt nicht mehr.“
„Wenn ich sonst etwas für Sie tun kann,“ sagte Arnold – ein schwacher Versuch, ihre Enttäuschung ein bisschen abzufedern.
Was hätte er tun können? Seine Kontakte in die Werbeszene waren ausgetrocknet. In den ersten drei, vier Jahren hatten sich noch ein paar Veteranen gefunden, die beim einstigen Lieblings-Italiener die frühen Pasta-Zeiten nachschmeckten. Wie das eingeschlagen hatte im Land der sieben Hühnchen, dass Nudeln grün sein konnten!
Sie alle erinnerten sich an das Hochgefühl, nach einer erfolgreichen Präsentation in den guten alten Intercity zu klettern und einen Bocksbeutel ins Abteil kommen zu lassen. Sie erinnerten sich aber auch an Abende, an denen sie unverrichteter Dinge auf Provinzbahnsteigen herumstanden und keinen Schutz vor dem Eisregen fanden, während der Anschlusszug auf sich warten ließ. Immer noch ließen sie sich nach dem Grappa eine Quittung geben, aber nur aus alter Gewohnheit; absetzen konnten sie nichts mehr. Vielleicht waren ihre Zusammenkünfte auch deshalb allmählich seltener geworden.
Über das Werben und Verkaufen konnte Arnold nur noch mit Benno reden. Der hatte seine ersten Kunden noch im VW-Käfer besucht, auf der Rückbank die Musterkoffer, die ihm beim Bremsen ins Kreuz schlugen. Mit den Jahren hatte er sein Sortiment erweitert und von Reprokameras bis Melkmaschinen alles verkauft, was ohne give and take nicht zu verkaufen ist. Auch er hatte Kunden jeder Sorte gegenüber gesessen. Den alten Troupiers, die wussten, wovon sie sprachen. Den Bequemen, die sich gern führen ließen. Aber auch den Neunmalklugen, die alles besser wussten und „dann eben den Scheiß kriegten, den sie haben wollten.“
Benno war vorbei gekommen, um sich Arnolds neue Zähne anzusehen („ist doch erst das Provisorium,“ sagte Arnold); er brachte Sabine eine Melone und ein ehrliches Kompliment mit: „Was für ein hübsches Kleid. Ist das Baumwolle? Steht dir wirklich gut.“ In Artigkeiten war er geübt – er zielte sie aufs Detail und fuhr gut damit.
Die beiden Freunde waren hinters Haus gegangen, saßen auf der sonnenwarmen Terrasse, schauten abwechselnd in ihren Rotwein und auf den Rasen, der jetzt nicht mehr viel Pflege brauchte. Sie hatten den Herbstanfang hinter sich, umso mehr genossen sie die Wärme, die der späte Nachmittag ihnen noch einmal spendete.
„Es ist vorbei.“ Benno kam auf seine Kundentypen zurück. „Was regen wir uns auf. Einem Arsch muss man beizeiten die Meinung sagen; rückwirkend nützt es nichts mehr. Die Frage ist, wer von den heutigen Weltmeistern als Arsch in die Geschichte eingehen wird. Anwärter gibt es genug. Ärsche im Rückspiegel – das wäre mal eine Rubrik für dieses Zukunftsmagazin.“
Arnold lachte böse. „Hoffentlich gehören wir nicht dazu.“
„Sie werden mit keinem von uns gnädig umgehen,“ sagte Benno düster. „Was meinst du denn? Die Jungen liegen auf der Lauer, die wollen auch noch ein paar Krümel vom Kuchen haben. Da kannst du froh sein, wenn du in Ruhe deine Rente verzehren darfst.“
Zwischen seinen Augenbrauen zeigte sich eine senkrechte Falte.
„Ich habe vor kurzem einen Tierfilm gesehen, aus den Alpen, oben im Schnee, in den Felsen. Da hat eine junge Gemse ihre Mutter aus dem windgeschützten Winkel vertrieben, hinter dem man den Winter am besten überlebt.“
Er verkniff das Gesicht, als fege ihm selbst gerade ein Schneesturm um die Ohren.
„Da ziehst du dich besser warm an, Junge.“ Er blickte auf. „Hallo Sabine.“
Sabine war herausgekommen, um ihnen Gesellschaft zu leisten. „Das reine Rentnerglück,“ sagte sie, als sie die beiden betrachtete, halbgehangen in ihren Sesseln. „Na, was bekaspert Ihr denn da?“ Sie hatte die Melone aufgeschnitten und servierte sie auf Tellern mit kleinen Schinkenstreifen.
„Sirup? Willst du Sirup drüber?“ fragte sie Benno.
Benno tippte mit der Gabel auf seinen Teller: „Wenn sich zwei so gut verstehen, soll man sie allein lassen.“
„Keinen Sirup?“
„Das hat er gemeint,“ sagte Arnold.
Diese Werbefuzzis meinten, was sie sagten, aber sie sagten es anders, als sie es meinten. Für Sabines Geschmack redeten sie zu eigenwillig, zu sprunghaft. Sie kam mit diesen Sprüngen nicht gut zurecht. Jeder Elektriker, jeder Anstreicher sprach vernünftiger. Sie hörte gern die tiefen Stimmen der Handwerker auf den Baustellen der Nachbarschaft; sie hatten mit Dingen zu tun, die man anfassen konnte. Von dem Unsinn, den die drei Helden draußen auf ihren Wanderungen bereden mochten, war sie weit entfernt. Sie hielt sich zurück. Das Terrain war ihr fremd, man konnte leicht ausrutschen.
„Arnie, du bist verspielt,“ sagte sie, wenn er wieder einmal einen alltäglichen Vorgang in einen verqueren Sinnzusammenhang stellte. Arnie gab das gern zu, empfahl ihr aber, die Spielerei ernst zu nehmen. Manchmal käme etwas Überraschendes dabei heraus – etwas, an das bisher niemand gedacht hätte. Auch im Absurden gäbe es eine Logik, man müsse die Dinge nur zu Ende denken. Sie hätte sich ja als Kind, wenn sie das Märchen vom Däumling hörte, auch nicht darüber gewundert, dass der kleine Kerl aus einem Fingerhut trinkt.
„Wahrscheinlich nicht,“ gab Sabine zu, aber bestimmt hätte sie darüber gelacht.
Alles eine Frage des Blickwinkels. Mit Arnold im Eisstadion war es gleichgültig, was unten auf dem Eis passierte; interessant waren die Sprechchöre ringsum auf den Rängen – „Choräle des Volkes.“ Mit Arnold war ein Picknick auf den Rheinwiesen nicht einfach ein Picknick auf den Rheinwiesen – es war „der Besuch der kaiserlichen Familie im Staatsbad.“
„Du kannst einen unglaublichen Stuss reden, Arnie,“ sagte Sabine.
„Die Vielfalt,“ wiederholte er, „hat sich im Kopf abzuspielen.“
Es war eine Berufskrankheit. Arnold und Konsorten waren durch die Themen gehüpft, wie die Märkte es brauchten. Eigentlich – hatte Arnold selbst gesagt – waren sie Marktschreier; sie boten ihre Dienste jedem an, der seine Ware an den Mann bringen musste. Das blieb für den Korffschen Haushalt nicht ohne Folgen. Der Marktschreier muss sich in die Dinge, die er verhökert, einfühlen, deshalb waren unablässig Neuheiten ins Haus gekommen: Das Haarwasser mit Rosskastanien-Extrakt stand auf Arnolds Seite des Badezimmerspiegels, die neue Kuchenmischung musste Sabine ausprobieren. Arnolds Loyalität blieb nicht auf die eigenen Kunden begrenzt: Ein Auto wurde bei AVIS gemietet und nicht sonst wo. Denn deren Slogan von der „Nummer zwei, die sich mehr anstrengt,“ war ein Geniestreich der Madison Avenue, der musste belohnt werden.
Sie kannten alles und verstanden von allem die Hälfte. Auch das räumte Arnold ein, er meinte aber, Sabine solle den Blick quer durch die Märkte nicht geringschätzen. Wenn sie nur mal einen Internisten als Beispiel nähme: So einer dringe tief in sein Sachgebiet ein und sei in seinem Spezialwissen gewiss unschlagbar, aber bei seiner Verabschiedung würde dann „sein Leben für den Blinddarm“ gewürdigt. Und das könne es ja auch nicht sein, bei diesem engen Blickfeld käme die Phantasie zu kurz.
„Habe ich nicht recht, Sabine?“
Natürlich hatte er recht. Sabine war einmal auf einer Pharma-Party neben einen alten Arzt platziert worden, der ihr während der Vorspeise von seinen Versuchen mit Katzen erzählte („immer darauf geachtet, dass sie nicht leiden“). Es war ihr nicht gelungen, das Thema zu wechseln – nein, wirklich, da waren die Werbeleute unterhaltsamer.
Andererseits, das mit der Phantasie – sie wusste nicht recht. Früher, als die Korffs noch öfter mit Arnolds Kollegen ausgingen, unterschieden sich Sabines Eindrücke erheblich von den Erinnerungen, die Arnold und die anderen Spinner dem Abend überstülpten. Witze vom Fach verstand sie ohnehin nicht; sie lachte mit, aber nur aus zweiter Hand. War sie denn in diesem angesagten Altstadtlokal mit den Essensresten an der Wand tatsächlich der Avantgarde begegnet? Sie hatte doch nur ein Stück von einer toten Kuh gegessen, auch wenn es als „Bärensteak“ serviert und gefeiert wurde.
Eigentlich wurde die ganze Stadt überhöht. Das flimmernde Bild aus Mode, Werbung, Shopping- und Gourmetadressen hatte keine Berührungsflächen mehr mit den Tagen der Sabine Korff. In ihrer Nachbarschaft wohnte kein Künstler und kein Topmodel, statt dessen rechterhand ein Bauingenieur und seine Frau – Doppelverdiener, die froh waren, wenn sie abends die Füße hochlegen konnten. Links die junge Familie eines Mannes, der bei der Krankenkasse arbeitete. „Das muss ja auch einer machen,“ hatte er zu Sabine gesagt, als müsse er sich rechtfertigen, dass er nichts Brillanteres vorweisen konnte. Er kannte Sabine schlecht. Sie wusste, wie dringend man die Platzwarte braucht, damit die Happy Few spielen können.
Sie musste nur um wenige Straßenecken gehen, um sich in einer beliebigen Industriestadt wiederzufinden: Mehrstöckige Wohnblocks, nach dem Krieg schnell hochgezogen, mit vierundzwanzig Klingelschildern an der Haustür und einer Autoverwertung hinter der Toreinfahrt. Dazwischen Getränkemärkte, Matratzenlager, ein alter Luftschutzbunker mit großzügiger Graffiti-Ausstattung.
Die Stadt rund um den Kö-Bogen war ihr fremd geworden. Sie hörte ein Feuerwerk aus Richtung Innenstadt und hatte keine Ahnung, was da los war. Das war einmal anders gewesen – früher, als sie noch dazu gehörte, als es in den Kinos noch kein Popcorn gab, dafür aber Buchhandlungen auf der Königsallee.
Vielleicht sah man ihre Stadt von außen mit anderen Augen. In Südfrankreich, ausgerechnet, war sie einmal freundlich gefragt worden: „Sie kommen vom Rhein?“ Sabine hatte den Beifall in der Frage gehört: Sie wohnte in einem friedlichen Landstrich, der von geselligen Menschen bevölkert wurde. Sie konnte ja auch nicht klagen. Es war schön, in diesem Haus im Amselgrund zu leben, an einer einladenden Adresse. Warum hatte Benno eigentlich seine neue Gefährtin nicht schon längst mitgebracht?
„Wann kommt denn eigentlich Ilka nach Düsseldorf?“ fragte sie. „Wir sind schon ganz neugierig.“
Die einzige Tochter der Korffs, Christina, hatte das Haus vor zehn Jahren verlassen und studierte, wenn man das so nennen wollte, Kunstgeschichte in München. Sabine telefonierte hin und wieder mit ihr, aber einen richtigen Herzensaustausch konnte man das nicht nennen.
Ihr fehlte Gesellschaft; sie hätte gern mal wieder ein Wort mit einer guten Freundin geredet. Das Getränkeregal im Korffschen Keller hielt seit Jahr und Tag eine Flasche Kirschwasser bereit – für Sabines fabelhafte Kirschwasser-Mädels. Großer Gott, was hatten sie für unwahrscheinliche Abende gehabt! Wie damals, als sie zu viert unterwegs waren und im Taxi die Karnevalsschlager rauf- und runtersangen. Mit dem Lohengrin, der mit dem Schwan aus der Ferne kam, waren sie am Ende der Fahrt noch nicht fertig (sie wollten zu Elsa, der lieblichen Maid), deshalb drehte der Fahrer eigens noch eine Runde um den Block. Er tat es gern, so viel Respekt hatte die Kunst verdient.
Die Truppe hatte schon lange nicht mehr den Weg zueinander gefunden. Es mochte sein, dass sie alle jetzt Dinge im Kopf hatten, die sich nicht miteinander vertrugen. Sabine hatte vor acht Jahren ihren Apothekerkittel ausgezogen, aber immer versucht, auf dem Laufenden zu bleiben, vergeblich. Eine Weile hatten sie noch miteinander telefoniert, aber nach und nach waren die Gespräche blasser geworden. Der Zunder war raus, es lohnte sich nicht mehr.
Anfang des Jahres hatte sie ihren Taschenkalender neu eingerichtet und schon wieder zwei Geburtstage streichen müssen. Diesen Verlusten stand kein neuer Name gegenüber. Wer jetzt noch nicht in ihrem Kalender stand, wollte auch nicht mehr hineinkommen. Sabine musste sich schon auf dem Platz vor ihrer alten Apotheke aufhalten, um Neues zu hören. Am besten vormittags zwischen elf und zwölf, wenn die Rentnerinnen ihre Medikamente abholten. Wenn sie mit wässrigen Augen geprüft hatten, ob man sich vielleicht von früher kannte, kam manchmal eine Unterhaltung zustande. Etwas, das sie Arnold zuhause hätte erzählen können, kam dabei nicht heraus.