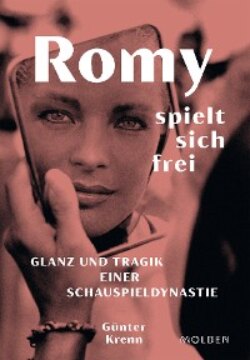Читать книгу Romy spielt sich frei - Günter Krenn - Страница 15
Ihr Mann: Karl Walter Albach
ОглавлениеWar Rosa bislang eine überzeugte Berlinerin, so erobert die Stadt, in die sie nun kommt, bald ebenfalls ihr Herz. Sie beginnt ihr Engagement am Deutschen Volkstheater am 2. März 1895 in dem Stück Ein Kind des Glücks von Charlotte Birch-Pfeiffer und wohnt mit ihren Eltern im achten Bezirk in der Strozzigasse Nr. 22. Die weiche, melodiöse österreichische Sprachmelodie geht ihr sofort ins Ohr, die stimmhaften Vokale, die oft verschwimmenden Konsonanten, alles scheint hier fröhlicher zu klingen als in Berlin, selbst wenn es anders gemeint ist. Der helle Klang ihrer Stimme rundet sich bald zum österreichischen Idiom. Den Sinn der Worte dieser neuen „Fremdsprache“ versteht sie nicht immer, doch wie so vieles wird sie es sich erarbeiten. Sie hat den Rest ihres Lebens dazu Zeit – das werden noch 85 Jahre sein.
Was ihr der neue Direktor Emmerich Bukovics als Erstes beibringt, ist, dass sie sich in der Wiener Gesellschaft schicker kleiden muss, als sie es bisher gewohnt war. Eine adäquate Adresse dafür ist das Modehaus Drecoll am Kohlmarkt 7, unweit der k. u. k. Hofzuckerbäckerei Demel. Geleitet wird das Geschäft von Johann Wilhelm Rudolf Christoph von Drecoll, einem gebürtigen Hamburger, der in Wien, Paris, Berlin und sogar New York Salons eröffnet. Er entwirft Bühnenkostüme für Burgtheaterschauspielerinnen ebenso wie Reitgewänder für Kaiserin Elisabeth. Die verschwenderisch opulente Dekoration seines Ateliers erinnert an die des Malers Hans Makart, wird dominiert von historistischem Prunk. Das Auge ist geblendet von Samt und Gold, Vasen, aus denen exotische Pflanzen wuchern. Die Vorhänge bleiben auch bei Tag geschlossen, der Maître bevorzugt künstliches Licht. Drecoll bedient Rosa persönlich, ordnet ihr nach einer ersten „Anamnese“ die Farben Blau und Weiß zu. Der Preis für zwei „Tageskleider“ übersteigt ihre Anfangs-Monatsgage, doch man findet eine Wiener Lösung. Direktor Bukovics erhöht ihr Gehalt, Maître Drecoll seinerseits gewährt einen Preisnachlass. Die junge Schauspielerin lächelt, sie ist nun endgültig in der Hauptstadt des Sich-Arrangierens angekommen.
Im Januar 1895 spricht man in Wien darüber, dass Rosas Kollegin Adele Sandrock vom Deutschen Volkstheater ans Burgtheater wechselt. Bildschön, noch weit entfernt von jenem Gepräge, das später perfekt zu den Buffo-Rollen in ihren Filmen passt, lernt Rosa sie kennen. Ihr gegenüber ist die sonst streitbare Sandrock fürsorglich, bemuttert sie fast. Launisch und mit loser Zunge prahlt sie Rosa gegenüber mit ihren Affären, darunter auch der mit einem Schriftsteller, den sie ihr mit den spöttischen Worten „Das ist mein süßer Zwerg, Herr Dr. Schnitzler!“12 vorstellt. Rosa ist überzeugt davon, dass sich zahlreiche von Sandrocks Formulierungen in der Literatur jener Epoche bei Autoren wie Schnitzler, Roda-Roda und Felix Salten wiederfinden. Das erste Treffen mit Schnitzler in Gegenwart der Sandrock macht Rosa verlegen, wiedersehen wird sie den Dichter erst ein Vierteljahrhundert später. Nach der Premiere seines Stücks Die Schwestern oder Casanova in Spa, bei der sie 1920 mitwirkt, lernt sie ihn persönlich kennen, nachdem er ihr eine Einladung zum Tee zukommen lässt. Sie betritt seine Villa in der Sternwartestraße Nr. 71 und wird von seiner Frau Olga empfangen, die ihr sofort sein Arbeitszimmer, die „Dichterklause“, mit dem Blick über das Döblinger Cottage zeigt. Schnitzler selbst kehrt von seinem Nachmittagsspaziergang zurück und tritt, wie der neugierige Gast bemerkt, erst vor sie, nachdem er Bart und Haupthaar sorgfältig arrangiert hat.
Rosas erste Tanzveranstaltung in Wien ist der Ball der Österreichischen Gesellschaft vom Weißen Kreuze in den Sophiensälen im Januar 1896, dessen Reinerlös in die Errichtung von Militärkurhäusern fließt. Fräulein Retty nimmt mit ihren Eltern daran teil und erinnert sich später an die bitterkalte Winternacht, in der die Hufe der Pferde ihres Fiakers Mühe haben, das Glatteis zu meistern. Sie selbst sitzt steif und unbeweglich darin, um ihr Kleid aus weißer Seide mit handgemalten Heckenrosen am Saum und Silbertüll nicht zu verdrücken. Am Ziel angekommen, bewundert sie den floralen Saalschmuck aus roten und weißen Rosen, aus Frühlingsblumen und Zitronenbäumchen. An diesem Tag entscheidet sich Rosas weiteres Leben, denn ihr wird ein Tanzpartner vorgestellt, der für die nächsten fünf Jahrzehnte an ihrer Seite bleiben wird. Eine Fotografie aus dem Jahr 1896 zeigt ihn in Uniform mit sorgfältig aufgezwirbeltem Schnurrbart. Sein Sohn wird später solche dekorativen Offiziere spielen, etwa 1957 in Der Kaiser und das Wäschermädel. Hochgewachsen und gutaussehend ist er, konstatiert Rosa, sein Name geht bei der Vorstellung im Hintergrundlärm unter, nicht aber seine Bitte, sich in ihre Tanzkarte eintragen zu dürfen. Besagte Karte hängt an ihrem linken Arm, nur mit Mühe kann sie sich davon lösen, das sie haltende Band zerreißt, ein anderes wird dafür geknüpft, denn der junge Mann trägt seinen Namen so oft auf dem Papier ein, bis kein Platz mehr darauf ist. Da er ihr gleich zu Beginn ein paar Mal zu oft auf die Zehen steigt, verbringt er den Abend mit der zwar tanzmäßig aber ansonsten keineswegs reservierten Dame in angeregter Konversation, bis der Morgen graut.
Rosas Mutter Käthe bittet den jungen Galan danach schicklich zum Tee, die Bekanntschaft setzt sich harmonisch fort. Mittlerweile kennt Rosa auch seinen Namen: Karl (in früheren Urkunden Carl geschrieben) Walter Albach, geboren am 21. Oktober 1870 im oberösterreichischen Windischgarsten, seine Eltern sind Dr. Heinrich Albach, k. u. k. Notar, und dessen Frau Theresia, geborene Herszan. Karl Albach ist zu jenem Zeitpunkt noch Oberleutnant in der k. u. k. Armee, wird jedoch gegen den Willen seines Vaters seine militärische Karriere bald beenden, um sein Jus-Studium fortzusetzen und als Anwalt seiner künftigen Ehefrau ein standesgemäßes Leben bieten zu können. Heinrich Albach reagiert zunächst verstimmt auf die berufliche Veränderung seines Filius, doch Walters Schwester Hilde und ihr Ehemann, Dr. Krischker, geben dem jungen Paar Schützenhilfe.
Käthe Retty hat gerade noch Zeit, ihren zukünftigen Schwiegersohn ein wenig kennenzulernen, denn ihr bleiben nur mehr wenige Monate Lebenszeit. Kurz nach dem Ball benennen die Ärzte nach einer Operation ihre diffusen Schmerzen mit der letalen Diagnose Unterleibskrebs. Mehr als Morphium bleibt nicht, um ihr die letzte Zeit so schmerzfrei wie möglich zu gestalten. In ihrer Erinnerung sind es wie zum Hohn vor allem Komödien, die Rosa in jener Zeit in Wien zu spielen hat. Es scheint ihr, dass sich sogar der Frühling in diesem Jahr beeilt, sich möglichst früh einzustellen, damit sich die Natur der Sterbenden gegenüber noch einmal freundlich zeigen kann. Familie Retty übersiedelt in die Parterrewohnung einer Villa in Hietzing, damit die Mutter ihre letzte Zeit in guter Luft verbringen kann. Zu Ostern versteckt „Kätchen“ ein letztes Mal im Garten die Ostereier für ihr Kind – wie früher, als hätte damit alles andere auch Bestand, als könnte die Routine über den fatalen Zustand hinwegtäuschen. 1896 ist Rosa 22 Jahre alt, spielt jedoch für die Todkranke noch einmal das Kind, sucht die Eier nach ihren Anleitungen, sieht, wie sich der Körper der Mutter vor Anstrengung krümmt. Der Tochter wird sich diese letzte Zeit mit ihr für immer einprägen. Die Morphiumdosen müssen bald erhöht werden. Die Mutter liegt im Halbschlummer, hat die Augen leicht geöffnet, auch wenn diese bereits stärker nach innen zu blicken scheinen. Im wachen Zustand, wenn das Betäubungsmittel nachlässt, schreit sie ihren Schmerz hinaus. An ihrem Bett sitzt die Familie, neu hinzugekommen ist der junge Offizier vom Ball, Karl Albach, der in der Nähe wohnt und bemerkt, dass es die Sterbende entspannt, wenn er leise mit seinem Säbel rasselt. Am 22. Mai 1896 beruhigt er sie zum letzten Mal auf diese Art. Eine Hand hält die ihre, die andere spielt mit dem blinkenden Kriegsgerät, mit dem er rasselt wie mit einem Kinderspielzeug. Rosa ist auf der Probe, während ihre Mutter stirbt. „Kätchen“ war noch keine 45 Jahre alt. Die Beziehung zu ihr wird der Tochter niemand mehr ersetzen können.
Anfang Dezember 1896 bringt es Rosas Popularität mit sich, dass der Hochzeitszug zur Evangelischen Kirche in der Dorotheergasse von zahlreichen Schaulustigen begleitet wird. Rosas Kollegenschaft vom Volkstheater ist anwesend, auch Direktor Bukowics gibt sich die Ehre. Rosa wird sich später an ihr lautes, impulsives „Ja“ erinnern, an das dadurch ausgelöste Gelächter in der Kirche. An der Seite ihres Vaters sitzt seine neue ständige Begleiterin Frieda Grossmüller, auch sie ist Schauspielerin und mit Rosa befreundet. Entgegen Rosas Wünschen wird es eine große, festliche Trauung, das Brautpaar muss die Kirche durch einen Seitenausgang verlassen, um der wartenden Menge zu entgehen, doch selbst das schafft die Braut nicht, ohne dass ihre Kleidung in Mitleidenschaft gezogen wird. Vierzehn Tage Flitterwochen am Lido von Venedig, der sich zu jener Zeit noch menschenleer zeigt, folgen.
Seine erste Wohnung richtet sich das junge Paar in der Strozzigasse ein. Rosas Familienname ist nun eigentlich Albach, doch sie etabliert einen gleichsam emanzipatorischen Doppelnamen und heißt bis zu ihrem Lebensende Rosa Albach-Retty. Auch ihre Schwiegertochter Magda und ihre Enkelin Romy werden sich bei der Namenswahl durchsetzen – und damit ebenfalls ein Zeichen setzen.