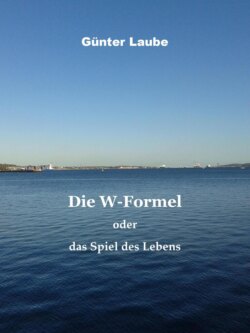Читать книгу Die W-Formel oder das Spiel des Lebens - Günter Laube - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III. Wer?
Оглавление»Damit Sie da sein können, mussten sich zunächst einmal ein paar Billionen Atome auf raffinierte, verblüffend freundschaftliche Weise zusammenfinden und Sie erschaffen. ... Warum Atome so viel Mühe auf sich nehmen, ist eigentlich ein Rätsel.«
(Bill Bryson, Eine kurze Geschichte von fast allem)
Wahrscheinlich hat sich jeder schon einmal mit dem Gedanken auseinandergesetzt, wie das Leben entstanden ist. Auch Helen Keller, die uns bereits begegnet ist, wollte dieses Rätsel lösen und beschäftigte sich damit. Zunächst im zarten Kindesalter jedoch auf allgemeiner Ebene. Den Eintragungen ihres Tagebuchs »Ich möchte über Dinge schreiben, die ich nicht verstehe. Wer schuf die Erde und die Meere und alles? Was macht die Sonne heiß? Wo war ich, ehe ich zur Mutter kam? Wie groß ist der Weltenraum? Wer hat ihn erschaffen?« sind wir bereits begegnet, und Anne Sullivan gab die entsprechenden Antworten gemäß dem damaligen Stand der Wissenschaft und Religion. Als sie aufhörte, fragte Helen: »Aber jetzt sagen Sie mir endlich - wer hat Gott geschaffen?«
Es wurde ein Pfarrer hinzugezogen.
Nun, die religiöse Seite haben wir auf unserer Reise soeben betrachtet, halten wir uns jetzt an die Wissenschaft: Im Bereich der Physik, Meteorologie, Anthropologie, Medizin, Astronomie, Geographie, Chemie, Biologie, Geologie und der Mathematik sollten in den letzten Jahrhunderten ausreichend Erkenntnisse gesammelt worden sein, um die Welt zu verstehen und zu erklären. Angefangen bei Newtons Principia von 1687: das Gravitationsgesetz und die drei Bewegungsgesetze: Dass sich alles in die Richtung bewegt, in die es gestoßen wird, und sich solange in gerader Linie bewegt, bis irgendeine Kraft es abbremst. Was uns unmittelbar zu dem dritten Gesetz führt: Zu jeder Aktion gibt es eine ebenso große, entgegengesetzte Reaktion; des Weiteren das im Jahr 1869 von Mendelejew produzierte Periodensystem der Elemente - mit dem sich heutzutage jeder Chemie-Schüler auseinander setzen muss. Damals galt es Ordnung zu schaffen in der Chemie und den Elementen, und Dmitrij Iwanowitsch Mendelejew, Professor an der Universität von St. Petersburg, hatte die goldene Idee: Bisher wurden die Elemente nach gleichen Eigenschaften wie Metall oder Gas oder nach dem Atomgewicht geordnet. Er vereinigte beide Systeme und schuf das, was wir alle aus dem Chemie-Unterricht kennen: das Periodensystem der Elemente. Was wir ebenfalls alle kennen, und zwar aus dem Physik-Unterricht, ist die wohl berühmteste Formel der Welt, Einsteins Gleichung E=mc², die 1907 das Licht der Welt erblickte, und aus der hervorgeht, dass Masse und Energie einander äquivalent sind. »Energie ist freigesetzte Materie, und Materie ist Energie, die auf ihre Befreiung wartet«, stellte Bill Bryson fest. In Fortführung und zur Ergänzung aller bisherigen Errungenschaften der Wissenschaft wurde im September 2008 die größte Maschine aller Zeiten in Betrieb genommen. Mit ihr wollen die Physiker herausfinden, was die Welt im Innersten zusammenhält. Der größte und teuerste Teilchenbeschleuniger der Welt LHC im Europäischen Teilchenforschungszentrum CERN bei Genf, in der Schweiz, ist in einem 27 Kilometer langen, unterirdischem Tunnel beheimatet. Hiermit versuchen Wissenschaftler, die Kernfragen zu lösen. Denn die Kernfragen können von einzelnen Disziplinen wie der Physik, der Biologie oder der Chemie nur zum Teil beantwortet werden.
Ohne den Sprung von einer Anzahl von Atomen hin zu einem Molekül und schließlich zu einer Zelle, also im Grunde von der anorganischen zur organischen Chemie und zur Biologie, wäre das Leben nicht entstanden. »Bio« stammt aus dem Griechischen und bedeutet »Leben«. Die organische Chemie, die Welt des Kohlenstoffs, ohne den kein Leben denkbar wäre, ist ein großes Feld, und lässt sich doch halbwegs übersichtlich strukturieren. Es gibt kettenförmige und ringförmige Kohlenstoffverbindungen, und die kettenförmigen lassen sich in fünf Gruppen aufteilen: in Paraffine, Olefine, Fettsäuren, Aldehyde und Alkohole. Und wie eng ähnliche Stoffe miteinander verwandt und doch verschieden sind, zeigt sich in einem bekannten Beispiel gerade am Alkohol: Der Ethylalkohol, C2H5OH hat nur ein Kohlenstoffatom und zwei Wasserstoffatome mehr als der Methylalkohol, CH3OH, und ist im Gegensatz zu diesem genießbar. Er entsteht durch die Vergärung von Zucker und Hefe, wir kennen es aus der Brauerei. Methylalkohol hingegen ist überhaupt nicht genießbar, er führt zur Erblindung und zum Tod.
Zu den Aldehyden zählen die Zucker, und eine bekannte Variante eines Aldehyds ist Formaldehyd. Die ringförmigen Kohlenstoffverbindungen wiederum begegnen uns täglich beim Autofahren. Benzin besteht aus mehreren Stoffen, einer ist Hexan. Es enthält sechs Kohlenstoff- und 14 Wasserstoffatome, die sich ringförmig anordnen, so wie das Benzol. Und auch andere Energieressourcen wie zum Beispiel Kohle und Erdöl sind Kohlenstoffverbindungen, die auf dem Ringprinzip beruhen. In »Chemie - Motor der Zukunft« schrieb Walter Greiling bereits in den 1960er Jahren, dass »der ganze große Reichtum an Kohlenstoffverbindungen in der Natur einmal durch den Körper von Lebewesen hindurchgegangen ist, von Lebewesen aller Art, Pflanzen, Tieren und Mikroben. Der Torf, die Braunkohlen, die Steinkohlen, das Erdöl, alles sind Reste von Leibern unzähliger Pflanzen- und Tiergenerationen.«
Es scheint eine eigene, jedoch in manchen Teilen durchaus populäre und bekannte Welt zu sein, obzwar vielfältig und komplex, doch wenn man das Prinzip kennt, wird es durchschaubar. Diese Erfahrung machte auch Helen Keller, die das Wachstum einer Pflanze live miterleben sollte: Eine Tulpenzwiebel wurde in einen Topf gesetzt und dieser in ihr Zimmer gestellt. Nach getaner Arbeit holte Helen ihre Puppe, ging in den Garten, grub sie in einem Artischockenbeet ein und erklärte der Familie: »Puppe wachsen!«
Es war nicht einfach, Helen den Unterschied zu erklären, geschweige denn begreifbar zu machen. »Man musste es der Zeit überlassen«, sagte Anne Sullivan. »Kinder wachsen nicht aus der Erde«, stellte Helen später fest und wollte wissen, wer »Mutter Natur geschaffen hat?«
Eine weitere Kernfrage wurde auch Momo gestellt, nämlich wann sie denn geboren sei, und sie sagte nach kurzer Überlegung: »Soweit ich mich erinnern kann, war ich immer schon da.« Dies ist aus wissenschaftlicher Sicht natürlich keine erschöpfende oder befriedigende Antwort, also wird geforscht. Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse:
Nach Ansicht von Wissenschaftlern liegen die Anfänge der Entstehung des Lebens, sprich der Evolution, rund vier Milliarden Jahre zurück. Auf der damals noch jungen Erde entwickelten sich in einem langen Prozess allmählich einfache Substanzen zu immer komplexeren Gebilden. Der erste Organismus, die erste Zelle entstand, und damit deutlich mehr als nur ein paar Atome oder Moleküle, denn wie wir aus dem Biologie-Unterricht noch wissen, beherrschen Zellen das Phänomen der Zellteilung. Und so kann die Geschichte losgehen.
Bis hin zur Bildung von Aminosäuren, Eiweißen, RNS und DNS war es dann nur noch eine Frage von ein paar Millionen Jahren. Macht aber nichts, wir hatten damals noch Zeit, keine Termine oder so, denn wir waren noch nicht auf der Weltbühne erschienen. Man, und das waren in diesem Fall die Zellen, musste sich nur durchsetzen.
Was Charles Darwin so formulierte: »Dass jedes organische Wesen ums Dasein kämpfen muss und großer Vernichtung ausgesetzt ist«, aber »der Kräftige, der Gesunde und Glückliche überlebt« und kann sich vermehren. Daraus ergibt sich die Entstehung der Arten, die Evolution der Lebewesen. Aller Lebewesen, bis hin zum Menschen. Was einige Zeit dauerte. Im Spiegel-Interview erläuterte Stephen Jay Gould 1998 den Lauf der Evolution: »Vor sechs Millionen Jahren gab es in Afrika ein Geschlecht von Menschenaffen, das uns hervorgebracht hat.«
Die Wiege der Menschheit liegt also in Afrika, genauer gesagt in Nordäthiopien. Die so genannte Out of Africa-Theorie findet ihr greifbarstes Indiz in dem Fund von Lucy.
Lucy? Kennen Sie nicht?
Lucy war eine junge Frau, die im heutigen Äthiopien starb und deren Skelett in einem bemerkenswert guten Zustand erhalten geblieben ist. Bemerkenswert deshalb, weil sie vor über drei Millionen Jahren gelebt hat. Sie wird zur Spezies Australopithecus afarensis gezählt, und ihre Entdecker, die Anthropologen Johanson und Gray, hörten am Abend der Entdeckung den Beatles-Titel »Lucy in the sky with Diamonds«. So kam die etwa Zwanzigjährige posthum zu ihrem Namen und wurde in der Wissenschaftsszene eine Berühmtheit. Bereits ein bis zwei Millionen Jahre vor ihr probierten die ersten Affen den aufrechten Gang aus, um ihn langfristig beizubehalten. Und genau hier wird es interessant: Der Übergang vom Affen zum Menschen. Denn mit den ersten Menschen wurde es Zeit für die berühmtesten 40 Wochen Wachstum, eindrucksvolle Bilder wurden im GEO-Heft vom Juli 2001 in Bezug zum Leben vor der Geburt gezeigt. Von einer Ansammlung von Zellen bis zum Baby und zum Kind, ein Wunder der Natur!
Die Entwicklungsstadien sind heutzutage per Ultraschall zu verfolgen, und in der Regel lässt sich so auch das Geschlecht des Nachwuchses frühzeitig erkennen - schon vor der Geburt. Auch was schadet oder nützt und den Nachwuchs an Eindrücken und Empfindungen prägt, lässt sich von Forschern nachweisen. Somit ist der Evolutionsprozess im alltäglichen Leben zu beobachten, und in der Wissenschaftsszene gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Details zur Evolutionstheorie.
Einige werden wir jetzt betrachten, um unsere Fragen zu klären: Wie hat sich der Mensch zu dem entwickelt, was er heute ist? Was macht den Menschen zum Menschen, und was unterscheidet ihn vom Tier? Und wer war der erste Mensch?
III.1. Der L-Bedarf
Heute ist Sonntag. Der große Tag. Ich habe die ganze Nacht kaum geschlafen, so aufgeregt bin ich. Am liebsten würde ich jetzt schon aufstehen, doch es ist noch zu früh. Meine Eltern schlafen noch.
Nachher geht's zum Fußball. Und es ist nicht nur ein Spiel, oh nein! Wir spielen ein Turnier. Es kommen viele Mannschaften, sogar eine aus Dänemark. Damit ist das Turnier international besetzt. Natürlich macht es mehr her, gegen die zu spielen - und erst zu gewinnen! -, als wenn man gegen die Jungs von Kleinkleckersdorf aus'm Nachbarort spielt. Die man womöglich auch noch am nächsten Tag in der Schule sieht. Aber so etwas ist international, weltmännisch, global! Ruhm, Ehre und Macht sind uns gewiss!
Doch einen Tag später geht's wieder zur Schule. Eine Klausur steht auf dem Programm, und gewisse Gedanken ziehen wieder durch meinen Kopf: Der Lehrer hatte den Gedanken schon, als er uns die Aufgaben gestellt hat ...
Müssten wir die denn jetzt nicht auch haben? In Verbindung mit den Aufgaben? Ja, jeder Schüler müsste die eigentlich haben. Das könnte doch ein Grundprinzip sein, denn auch andere Lehrer stellen ihren Schülern ähnliche Aufgaben. Immerhin gab es allein in Deutschland im Schuljahr 2005/06 667.711 Lehrer. Und wenn man im Anschluss an die Schule ein Studium beginnen möchte, kann man sich heutzutage im Internet über die Hochschulen in aller Welt informieren. Weltweit sozusagen. Wie uns Barbra Streisand im Film »Is' was, Doc?« mitteilte, fanden sich bereits 1972 1.145 höhere Bildungsanstalten in den Vereinigten Staaten.
Auch Stephen Hawking, der derzeit wohl bekannteste Physiker der Welt, ging einst zur Schule. Geboren 1942, wurde er im Alter von 35 Jahren Professor in Cambridge und lehrte lange Zeit dort, wo Jahrhunderte vor ihm Isaac Newton gewirkt hatte. Er entwickelte im Sommer 2010 eine neue Theorie, die M-Theorie. Sie sei der einzige Kandidat für eine wissenschaftliche Theorie, mit deren Hilfe man nicht nur die Wie-Fragen, sondern auch die Warum-Fragen beantworten könne.
Wir scheinen also auf einem guten Weg zu sein, um Fragen zu stellen ist man nie zu alt, selbst als berühmter Physiker nicht. Schauen wir uns also ein paar weitere Antworten der Wissenschaft an, doch beachten wir dabei, dass wir nicht zu sehr ins Abstrakte verfallen. In einer maßstabsgerechten Zeichnung unseres Sonnensystems würde die Erde von der Größe einer Erbse 300 Meter vom Jupiter entfernt sein, der Pluto gar 2.500 Meter. Das passt in kein Lexikon und keinen Atlas. Die schnellsten von Menschen gemachten Dinge sind die Voyager-Sonden 1 und 2, die mit knapp 60.000 Kilometern pro Stunde unterwegs sind. Dies alles sind Werte, denen man nicht täglich begegnet und sich ein Verständnis nur nach und nach erwerben kann. Fangen wir also ganz einfach am Anfang an, in einer Zeit, in der es noch keine Menschen gab, auch noch keine Tiere oder Pflanzen, sondern nur einige chemische Elemente, Atome und Moleküle. Das erste Leben, so eine Theorie, entstand in der Tiefsee, an Hydrothermalquellen, in warmem, alkalischem Milieu. Alles, was man brauchte, war da: Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Phosphor, Schwefel, Wasserstoff.
Im Laufe der Zeit entwickelten sich dann die ersten Organismen, schließlich einfache Tiere, höhere Tiere und eines Tages der Mensch. Doch eine genaue zeitliche Einordnung fällt schwer. So ist wissenschaftlich belegt (BdW 7/02), dass die C-14-Datierung teilweise unsicher ist. Man muss zwangsläufig dort an Grenzen stoßen, wo es zu größeren Änderungen in der Natur kam. Daher kommen unterschiedliche Wissenschaftler zu unterschiedlichen Ergebnissen, denn letzten Endes liegt dem Berechnungsmodell eine statistische Grundannahme eines linearen Verlaufs der Geschichte zu Grunde. Doch wenn sich einige Parameter in den Grundbedingungen ändern, ist dieses Modell nicht mehr zu verwenden. Oder vereinfacht ausgedrückt: Sie sind sieben Jahre verheiratet und haben in dieser Zeit drei Kinder bekommen. Wie viele Kinder haben Sie dann nach 14 Jahren? Und wie viele zur Goldenen Hochzeit? So treffen wir auch in diesem Bereich die Hasenstatistik an. Ja, mit Zahlen kann man eine Menge machen.
Als Grundgedanke erhalten bleibt im Grunde nur die Out-of-Africa-Theorie, die in verschiedenen Wissenschaftsgebieten wie der Molekularbiologie, der Biogenetik oder der Paläoanthropologie einheitlich akzeptiert wird. In Afrika entstanden die ersten anatomisch modernen Menschen - so wie wir heute immer noch geformt sind.
Doch weiter im Text: Wir sollten uns weniger um weit zurückliegende Zeiträume als vielmehr um Prinzipien kümmern. Was unterscheidet zum Beispiel den Menschen vom Tier? Sprache und die Fähigkeit zu abstraktem, symbolischem Denken gelten als Voraussetzungen für die geistigen Fähigkeiten des Menschen, »die uns vom Rest der Tierwelt abheben« (SdW April 2002).
Die Sache mit der Sprache ist klar, die mit dem Denken auch. Aber wann und wie setzte dieser Prozess ein? Die Cromagnon-Menschen sind vor 40.000 Jahren in Europa angekommen, dies gilt allgemein als gesicherte Lehrmeinung. Na also, da haben wir doch endlich einen Ansatzpunkt! Die ersten modernen Menschen, die sich bereits vom Neandertaler unterschieden. Jetzt war es nur noch eine Frage der Zeit, bis sich die Menschen so weit entwickelt hatten, um so tolle Dinge zu bauen wie Autos, Computer, Flugzeuge, Raumschiffe ... - stop! So weit sind wir noch nicht, Captain, nein Admiral, Kirk und Mr. Spock waren zwar nach Zerstörung der Enterprise mit einem Raumschiff der Klingonen per Zeitreise ins Jahr 1986 zurück geflogen, doch war es nicht ihre eigentliche Zeit. Bis sich die Menschen so weit entwickelt haben, um Raumschiffe zu bauen, mit denen man zu den Sternen fliegen kann, wird es noch ein Weilchen dauern. Aber selbst solche Kleinigkeiten wie Büroklammern herzustellen oder die Antibabypille zu entwickeln, wäre vor 10.000 Jahren wohl noch nicht möglich gewesen. Und damit haben wir das Prinzip der Evolution gefunden: Die Entwicklung geht stetig voran, vielleicht mal mit Unterbrechungen, aber generell entwickeln wir uns immer weiter, werden intelligenter, größer, stärker. Modellhaft kann man in diesem Sinne die Entwicklung eines einzelnen Menschen vom Kindesalter zum Erwachsenendasein heran ziehen und in Beziehung zur gesamten Entwicklung der Menschheit setzen.
Ein anderes Modell erlebte ich in meiner Kindheit, und damit kommen wir zurück zum Fußballturnier. Das Turnier animiert zahlreiche Eltern und Geschwister, die Spieler zu begleiten und anzufeuern. Auch mein Bruder ist dabei und guckt zu. Nach wie vor ist mein Vater der Trainer der Mannschaft, und ich nehme mir die Freiheit und hänge mich gegen Mannschaften, gegen die wir kaum eine Chance haben, nicht voll rein. Er wird schließlich deswegen nicht sauer auf mich sein, immerhin bin ich nicht der Beste des Teams und kann das Spiel allein eh nicht gewinnen.
Leider sieht es für unsere Mannschaft bald gar nicht mehr so gut aus. Bei anderen Turnieren oder Spielen waren wir deutlich besser, aber hier sind wirklich die besten des Kreises vertreten. Wir gewinnen kaum ein Spiel, oftmals lediglich an Erfahrung.
Als mein Vater mir vor dem nächsten Spiel eine neue Rolle überträgt, bin ich nicht sehr begeistert. Das Team, gegen das wir gleich spielen, zählt zu den stärksten überhaupt; was auch daran liegt, dass sie einen Typen haben, der allen anderen spielerisch haushoch überlegen und darum auch Spielmacher ist. Ein Zehner. Er ist nicht nur torgefährlich, sondern bereitet die Tore seiner Kameraden auch gekonnt vor. Und genau diesen Typen soll ich bewachen, ihn in Manndeckung nehmen. Das ist aber ganz und gar nicht nach meinem Geschmack! Wozu haben wir denn eine Abwehr? Ich spiele Mittelfeld, ich will selber stürmen und Tore schießen!
Während des Spiels verfolge ich meine Intentionen, allerdings erfolglos; wir haben keine Chance gegen diese Übermannschaft, alle Angriffe verpuffen. Dafür sind deren Angriffe umso gefährlicher, und der Zehner schießt sich allmählich ein. Bisher sind wir nur mit Glück einem Gegentreffer entgangen. Das hat mein Vater natürlich längst bemerkt und bedeutet mir, dass ich auf den Typen aufpassen und ihn decken soll! Doch ich stürme weiter fröhlich nach vorn. Ich bin schließlich eher Künstler, kein Kämpfer. Was soll schon passieren? Er wird mich deswegen nicht auswechseln, ich habe Narrenfreiheit!
Nach dem nächsten gegnerischen Angriff, den ich in sicherer Entfernung von Höhe der Mittellinie verfolge, werde ich ausgewechselt. Ich bin sprachlos. Sowas! Unerhört! Pffh, sollen die doch sehen, wie sie ohne mich gewinnen! Jetzt wird's auch nicht besser.
Doch die Höchststrafe kommt noch. Mein Vater wechselt meinen Bruder ein. Meinen Bruder! Meinen drei Jahre jüngeren Bruder, dessen Fußballerkarriere sich bislang auf den Abschnitt der Straße vor unserem Grundstück und einige Nachbargärten beschränkte. Unglaublich! Es ist der absolute Tiefpunkt. Nie wieder Fußball! Ich schmeiße sofort alles hin!
Keine Leberwurst der Welt konnte jemals beleidigter sein, als ich in diesem Moment. Ich setze mich abseits und tue so, als ob mich das Spiel nicht weiter interessiert. Ich bekomme das Grinsen des Spielmachers und der anderen Typen mit, die ob des Größen- und Altersunterschiedes kräftig frohlocken. Es riecht nach Schützenfest.
Es wird allerdings keines. Mein Vater hat meinem Bruder dieselbe Taktik mit auf den Weg gegeben wie mir. Und er beherzigt sie. So muss dereinst Berti Vogts Johann Cruyff aus dem Spiel genommen haben. Dem Zehner gelingt nichts, denn mein Bruder folgt ihm wie ein Schatten. Wenn er überhaupt noch dazu kommt, den Ball anzunehmen, ist er im nächsten Moment auch schon wieder weg. Irgendwo. Mein Bruder hatte keine klaren Instruktionen, wohin er den Ball denn schießen solle. Nur der Zehner durfte ihn halt nicht behalten.
Nach einiger Zeit ist dieser völlig genervt (klar, wer wäre das nicht?), und seine Mitspieler merken das. Sie beziehen ihn teilweise nicht mehr ein in das Spiel, bringen allein aber auch nichts Gescheites zu Stande. Deren Trainer guckt sich das nun nicht länger an und nimmt seinen Spielmacher vom Platz.
Und die Moral von der Geschicht: mein Bruder läuft und kickt da draußen auf dem Rasen rum (als sein Gegenspieler draußen war, durfte er mit nach vorne stürmen!), während ich hier sitze und dem Spiel zugucke. Gewonnen haben wir natürlich nicht, und das Siegertreppchen des Turniers musste ohne uns auskommen. Aber wir waren eines der wenigen Teams, und vielleicht das einzige, gegen das der Zehner nicht nur kein Tor gemacht, sondern auch keines vorbereitet hat. Mein Bruder hat sich gefreut, und später hat mein Vater ihn trainiert - so kam er zum Fußball. Und ich? Ja, ich hatte meine Lektion gelernt. Denn es gibt einen Lernbedarf.
Als ich nach einiger Zeit zurück vom Ego-Trip war, ging das Leben weiter. Mit Fußball war bei mir dann bald Schluss, in sportlicher Hinsicht waren jetzt Tischtennis und Judo angesagt. Vor allem letzteres war wichtig, denn in der Schule gab es die ersten Grabenkämpfe. Die Jungs waren im besten Testosteron-Alter, und nachdem ich einige Niederlagen einstecken musste, kniete ich mich tiefer rein in den Bereich des Kampfsports. Bald fing ich auch mit Bodybuilding an, in meinem Zimmer lagerten Lang- und Kurzhantelstangen, sowie verschiedene Gewichte. Auch ein Buch, in dem entsprechende Übungen gezeigt wurden, hatte ich mir gekauft. Nach Meinung des ersten Mr. Germany, Reinhard Smolana, der zwei Jahrzehnte nach diesem Triumph zum Mr. Germany over forty gekürt wurde, gehört zum Bodybuildung neben dem Training die richtige Ernährung. Dieser bemisst er sogar eine größere Bedeutung bei als dem Training: 60 zu 40. Also stellte ich auch die Ernährung entsprechend um, alles für den Muskelaufbau. Nun, dem Thema Essen werden wir später noch begegnen, für jetzt sei hervorgehoben, dass ich intensiv ins Bodybuilding einstieg, die Schule mutierte zur Randerscheinung. Die Pubertät ist eben nicht umsonst von Eltern und Lehrern gefürchtet.
Wie stellte Franz Beckenbauer dereinst fest: »Heute weiß ich, daß ich mich damals falsch verhalten habe. Aber es war die Zeit, die man »Flegeljahre« nennt. Da kommt man sich schlauer vor als alle Erwachsenen und tut die unmöglichsten Dinge, um sich selbst bestätigt zu sehen.«
Auch ich hatte nun die Phase der Flegeljahre erwischt. Doch das war nicht weiter schlimm, denn das Prinzip war doch völlig klar: Im Laufe der Evolution entstand aus einzelnen Zellen ein hochkomplexer Organismus von sehr vielen Zellen, der über ein Gehirn verfügt, durch das er letzten Endes die technischen Errungenschaften gerade des 20. Jahrhunderts hervorbringen konnte. Diese Zellen und also auch Gehirnzellen entwickeln sich also automatisch, sozusagen von allein. Man muss nur eine entsprechende Zeit warten, bis zur Zellteilung oder so. Ich hatte dieses Prinzip voll verstanden. Wir sind alle in einem Modus, in einem Automatik-Modus. Jede Zelle entwickelt sich automatisch weiter, irgendwann entstehen Pflanzen, Tiere und Menschen. Diese machen wiederum ihre eigene Evolution durch, Kinder werden größer, klüger, eines Tages Erwachsene. Dieses Prinzip wende ich sofort voll bewusst an. Immerhin macht es bedeutend mehr Spaß, sich á la »Zurück in die Zukunft« oder »Star Trek« Dinge vorzustellen und Geschichten zu überlegen, als irgendwas zu lernen, was man irgendwann sowieso kann. Die Schule ist teilweise lästig.
Gestern Abend bin ich noch mit Winnetou und Old Shatterhand durch den Wilden Westen geritten, und es scheint, dass ich noch nicht wieder ganz im Hier und Jetzt angekommen bin. Der Unterricht geht irgendwie an mir vorbei. Was natürlich nicht so gut ist. Andererseits kann eine solche Ablenkung auch nutzen, zum Beispiel beim Zahnarzt. Man konnte dort problemlos in anderen Gefilden wandeln, während der Untersuchung und etwaigen »Bohrungen«. Man durfte nur nie die Realität aus den Augen verlieren, also immer wachsam bleiben. Denn interessant wurde die Geschichte sonst in dem Moment, in dem man so vertieft war und während der Behandlung das Kriegsgeheul der Apatschen anstimmte, was bei so manchem Patienten im Wartezimmer zu akuten Fluchtgedanken hätte führen können.
Später bekam Karl May ernsthafte Konkurrenz. Als nicht mehr ganz junger Teenager versetzten mich die Sagen des klassischen Altertums von Gustav Schwab in eine noch fernere Vergangenheit als in den Wilden Westen. Zeus und Hera, Poseidon, Prometheus, Perseus, Herakles, den die Römer Herkules nannten, Dädalos und Ikaros, die Argonauten, Theseus, Odysseus und das Drama um Troja. Hades, der Gott der Unterwelt, Hermes, der Götterbote. Wer hätte nicht wenigstens schon einmal gehört von der griechischen Sage von Phaeton, der den Wagen seines Vaters, des Sonnengottes Helios, steuern wollte und abstürzte, wobei er auf der Erde ein Inferno verursachte?
In der neunten Klasse hatte sich der Modus leicht überholt. Es klappte nicht mehr so ganz mit der Automatik, war nicht mal mehr halbautomatisch. Ich schrieb immer öfter Fünfen, auch mal eine Sechs, und im Halbjahreszeugnis wurde es schwarz auf weiß dargestellt: Neben einer Fünf in Physik hatte ich sieben Vieren; »die Leistungen in Englisch sind schwach ausreichend. Die Versetzung ist nicht gesichert.«, stand im Feld Bemerkungen.
Doch Schüler sind erfinderisch! Ich erfand Ausreden, um mein Gewissen, meine Eltern und sonstige Leute zu beruhigen. Eine lautete: »Kann man für etwas bestraft werden, das man nicht gemacht hat?«
Konsequenterweise würde ein Lehrer wohl sagen: »Nein, natürlich nicht. Das wäre ungerecht.« Und genau das ist beabsichtigt, ich habe nämlich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Welchen Leser diese Anekdote an einen mittlerweile wohl oft zitierten Witz erinnert, der möge sich auch an seine Schulzeit erinnern. Dort herrschte an Ausreden wahrlich kein Mangel. Da auch diese Super-Ausrede aber irgendwann ins Leere laufen dürfte, entwickelt der clevere Schüler diverse Variationen. Schnell noch machen, bevor die Stunde anfängt, und sei es in der 5-Minuten-Pause davor, von irgendwem abschreiben (mit der Zeit entwickelt man ein Gespür dafür, wer die Aufgaben gemacht hat und einen auch abschreiben lässt), oder wenn gar nichts mehr geht, einfach dreist behaupten: »Ich habe sie vergessen« - das Heft, das Buch, meine Schulsachen. Ja, Schüler können wirklich erfinderisch sein.
Aber falsch ist es irgendwie trotzdem.
Auch als Erwachsener benutzen wir Ausreden, und eine der besten stammt aus dem Kultfilm »Blues Brothers«. Folgende Situation: Sie und Ihr Kompagnon haben mehrere Gesetze übertreten und befinden sich auf der Flucht. Die bereits etwas dauert. Mittlerweile sind die Polizeikräfte eines ganzen Landes hinter Ihnen her. Nachdem fast alle Fluchtwege zugestellt sind, bleibt Ihnen schließlich nur noch die Flucht durch einen Tunnel. Neben und über sich kubikmeterweise Stein und Erde, hinter sich Hunderte von Polizisten, bleibt nur die Flucht nach vorn. Doch der Ausgang ist noch nicht in Sicht, als sich ein Hindernis in Form einer Frau in den Weg stellt. Sie ist stinksauer und hat ein übel aussehendes automatisches Gewehr in den Händen. Und sie beweist sofort, dass sie Willens ist, es zu gebrauchen. In dem Moment mag mancher noch denken, lass sie sich austoben, irgendwann sind die Kugeln alle, und dann schnell irgendwie an ihr vorbei, bevor die ersten Polizisten da sind. Wenn man dann jedoch in Erfahrung bringt, dass die Frau berechtigterweise auf Sie sauer ist, sieht die Sache schon anders aus. Und wenn man dann noch weiß, dass sie sauer ist, weil Sie sie am Hochzeitstag haben sitzen lassen, kann man im Grunde nur noch beten, dass einen die Polizisten zuerst erreichen.
Aber wie das so ist: wenn man mal einen braucht...
Außerdem hat der Flüchtling (John Belushi) noch ein As im Ärmel: Ausreden. Ja, ganz richtig. Einen ganzen Sack voller Ausreden. Nicht nur eine, die würde die junge, echauffierte Dame mit geschätzten 1.000 Schuss pro Minute problemlos beiseite fegen. Er muss also schneller sein. Und so wurde er zum Ausreden-König: »Oh bitte, töte uns nicht! Bitte, bitte, töte uns nicht! Du weißt doch, ich liebe Dich, Baby! Ich wollte Dich nicht sitzen lassen, es war wirklich nicht meine Schuld!«
»Du mieser Mistkerl!« Bisher ist die junge Dame mit der Knarre nicht überredet, von überzeugt ganz zu schweigen. »Denkst Du, Du kannst Dich da so einfach rausreden? Du hast mich ganz einfach betrogen!«
Er setzt wieder an, seine Stimme wird in Nuancen höher, ein wenig schriller, er spricht noch schneller: »Hab' ich nicht, ehrlich! Das Benzin war alle, ich hatte 'n platten Reifen, und dann hatte ich einfach nicht genug Geld für 'n Taxi! Mein Smoking ist nicht aus der Reinigung gekommen, und ein alter Freund von außerhalb kam zu Besuch, und dann hat da jemand mein Auto geklaut; da war ein Erdbeben, und dann kam eine furchtbare Flutwelle... - wirklich nicht meine Schuld, ich schwöre es Dir!«
Nun, Bockmist bleibt Bockmist, da kann man reden, was man will. Es liegt am Gegenüber, ob die Ausrede akzeptiert wird oder nicht. Die Frau mit der Bleispritze scheint jedenfalls nicht überzeugt und zu maximal 30 Prozent überredet. Das reicht also noch nicht. Bleibt noch der Kniefall in Verbindung mit einem tiefen, treuen Hundeblick.
Das war's. Sie schmilzt dahin, möchte ihm alle Sünden der Welt vergeben. Er nimmt sie in den Arm, gibt ihr einen dicken Kuss, seinem Kumpel einen Wink und lässt sie elegant zu Boden fallen. Plumps!
Der Weg ist frei. Die Flucht kann weitergehen.
Diverse Ausreden ersann auch Ryan O'Neal als leicht zerstreut wirkender Musik-Wissenschaftler Howard Bannister in der Slapstick-Komödie »Is' was, Doc?«, in der eindrucksvoll dargestellt wurde, was eine Tasche für eine Verwirrung anrichten kann. Auf den Inhalt kommt es eben an! Genau wie sich Elemente dieses Films in späteren Komödien und Filmen wiederfinden, so auch gewisse Ausreden, denn er konnte Barbra Streisand einfach nicht widerstehen, und auf die Frage seiner eigentlich zukünftigen Frau, seit wann er denn Schaumbäder nehmen würde, antwortete: »Es kam schon so aus dem Wasserhahn.«
Meine Ausrede war zugegebenermaßen nicht ganz so einfallsreich, sondern eher intellektuell-nüchtern, denn für alle Fälle hatte ich Französisch als dritte Fremdsprache, damit konnte ich zur Not eine schlechte Note ausgleichen. Und ich hatte dort immerhin eine Zwei! In Geschichte, Chemie und Sport eine Drei - alles nicht so schlimm. Das nächste Halbjahr werde ich bestimmt auch in den übrigen Fächern besser werden.
Ich wurde es insgesamt nicht. Laut Konferenzbeschluss vom 10. Juni 1987 hatte ich nur in Sport eine Aufwärtstendenz zu verzeichnen, aus der Drei war eine Zwei geworden. Dafür war aus der Zwei in Französisch eine Drei gewachsen, die Fünf in Physik hielt sich hartnäckig, und in den restlichen neun Fächern hatte ich eine Vier. Egal, die Hauptsache war, ich war versetzt. Und das war ich, in die Untersekunda. Zehnte Klasse.
Das Schuljahr 1987/88 begann ich im Alter von fünfzehneinhalb. Eine faszinierende Zeit. Man ist schon fast erwachsen, hat jede Menge Lebenserfahrung, kann alles, weiß alles - und leidet nur bedingt an Selbstüberschätzung. Doch das merkte und lernte ich erst einige Zeit später, damals lag mir die Welt quasi zu Füßen.
Dummerweise rollte sie etwas schneller, als ich laufen konnte, und der Stoff in der Schule musste ungefähr Lichtgeschwindigkeit haben. Die Fünf in den Klausuren wurde allmählich zum Dauergast, und längst bekam ich Nachhilfe bei einem älteren Jungen aus der Nachbarschaft. Seine Eltern waren Lehrer, und er hat den Stoff (und sogar einige Lehrer) vor wenigen Jahren selbst durchgemacht. Anfangs für Mathe verabredet, dehnte sich die ganze Angelegenheit im Laufe der Zeit auch auf andere Fächer aus. Und tatsächlich, ich werde punktuell besser und verstehe so einiges, was mir bisher (auch weil ich nicht darüber nachgedacht habe), nicht klar war. Doch eines Tages komme ich mal wieder mit einer Klausur nach Hause. Es ist (mal wieder) eine Fünf. Und die Lehrerin hat schon beide Augen zugedrückt und gewissermaßen nach Punkten gesucht. Meine Eltern sind nicht sehr begeistert. Es gibt eine lebhafte Diskussion zu Hause, doch ich weiß alles besser und habe einen ganzen Rucksack voll Ausreden. Als mein Vater schließlich einzelne Aufgaben und die Antworten durchgeht - die bei objektiver Betrachtung nicht viel mit der Frage zu tun haben -, kommt mir die rettende Idee: »Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir!«, und ich äußere mich entsprechend.
Ich überspringe die nächsten Tage an dieser Stelle und komme zu einem Punkt, an dem die Stimmung wieder etwas ausgeglichener ist. Es wird beschlossen, dass meine Eltern mich ebenfalls unterstützen. Beim Lernen, bei den Hausaufgaben, vor Klausuren. Jeder geht mit mir das durch, was er kann. Quasi eine Art doppelte Nachhilfe. Doch Teenager können mitunter recht bockig sein. Zu Hause ein paar Stunden (oder Minuten) seiner Freizeit opfern ist das eine, in der Schule nicht aufpassen das andere. Die Noten wurden nur bedingt besser, und schließlich gab es auch noch richtige Nachhilfe, in einem Arbeitskurs. Pffffff! Die haben doch alle keine Ahnung. Es ist nur eine Frage der Zeit! Schließlich wäre sonst aus einem Affen nie ein intelligenteres Wesen entstanden!
Am Ende des ersten Halbjahrs konnte ich mit meinem Zeugnis keinen Blumenpott gewinnen: Auch die Drei in Sport konnte den überzeugtesten Optimisten nicht davon ablenken, und um ganz sicher zu gehen, hatten die Lehrer bei den Bemerkungen dezent darauf hingewiesen: »Die Leistungen in Englisch und Latein sind schwach ausreichend. Die Versetzung ist sehr gefährdet.« Da waren sie wieder, meine sieben Vieren - sogar in Französisch war ich schlechter geworden. Die Vieren waren allerdings das kleinere Problem. Die Fünfen in Mathe, Physik, Chemie, Biologie und Musik das größere.
Ach, was soll das alles! Es ist nur eine Frage der Zeit. Das läuft jetzt schon über Jahre, und irgendwann werde ich das schon verstehen und dann schreibe ich eine Eins. Völlig klar! Wozu brauche ich das eigentlich alles hier? Ich bin inzwischen sechzehn, und also quasi erwachsen. Die anderen sollen bloß mal zusehen und sich um ihren eigenen Kram kümmern. Ich mach, was ich will! Und ihr werdet schon sehen, es ist nur eine Frage der Zeit!
Am Ende der zehnten Klasse, nach ausgiebigen Tests gewisser Theorien und hartnäckigem Ignorieren von Aussagen meiner Eltern und Lehrer hatte mich die Wirklichkeit eingeholt. Der Konferenzbeschluss vom 23. Juni 1988 brachte folgende Ergebnisse: Französisch 6, Mathematik 5, Physik 5, Chemie 5, Biologie 5, Englisch 5, Musik 5, Kunst 4, Erdkunde 4, Geschichte 4, Deutsch 4, Latein 4, Sport 2.
Nicht versetzt.
Ich hätte es wissen müssen. Man wird also doch nicht automatisch schlauer. Diese Erfindung wäre ja auch sonst mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Deutschen Museum ausgestellt - und wäre fast unbezahlbar. Das perfekte perpetuum mobile. Ist es aber nicht. Und es ist auch irgendwie logisch, denn meine Hausaufgaben machen sich schließlich auch nicht von allein. Und überhaupt müsste man dann ja auch gar nicht in die Schule gehen. Und wir bräuchten nicht so viele Lehrer. Die viel Geld kosten. Gehen wir der Sache doch mal nach:
Im Schuljahr 2005/2006 gab es in Deutschland 667.711 hauptberufliche Lehrkräfte, von denen 150.554 in Nordrhein-Westfalen, dem einwohnerstärksten Bundesland, beschäftigt waren. Nach der Schule schließt sich ein Studium an, oder eine Ausbildung, eine Lehre. Im Sommer-Semester 2010 gab es zwei Millionen Studenten in Deutschland, dazu Professoren und andere Hochschullehrer. Von Aachen im Westen von NRW, wo es zum Beispiel an der RWTH Lehrstühle für Stadtentwicklung, Städtebau und Gebäudelehre gibt, bis nach Münster im Norden, wo an der dortigen Universität in acht verschiedenen Fakultäten ein reichhaltiges Angebot an Studiengängen zur Auswahl steht: Neben evangelischer und katholischer Religion kann man hier Jura, Wirtschaftswissenschaften, Medizin, Sprachen, Philosophie, Erziehungs- und Sozialwissenschaften oder Fächer aus dem Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Bereich studieren. Das ist ein ganz ordentliches Angebot. Und die Schüler nehmen dieses Angebot an, überall. So gab es zum Wintersemester 2010/11 allein an der Uni Hamburg über 40.000 Bewerbungen für einen Studienplatz. Und nicht zu vergessen: Jedes Bundesland besitzt ein Bildungsministerium und der Bund ebenfalls eines. Dort sitzen viele Leute, die die Bildung organisieren, Lehrpläne gestalten, den Lehrer-Bedarf ermitteln und dementsprechend Lehrer einstellen.
Nun gilt das nicht nur für Deutschland, sondern überall auf der Welt: Auch das Dschungelkind ging zur Schule - und musste sogar Hausaufgaben machen. Sehr zum Leidwesen der einheimischen Spielgenossen, die draußen herumtollten. In Indonesien gab es Lehrer aus den USA mit englisch-sprachigen Materialien. Ergänzt durch ihre Eltern, die ihnen Deutsch beibrachten, wuchsen die Kinder dreisprachig auf: Indonesisch, Englisch, Deutsch. Später kam dann noch eine vierte Sprache hinzu: Fayu, die Sprache der Eingeborenen. Nach dem Tod eines ihrer Fayu-Freunde verließ das Dschungelkind Ende 1989 West-Papua und flog in die Schweiz. Da auch Sabines Geschwister den Dschungel verließen bzw. schon verlassen hatten, und die Mutter der Dschungelkinder nun nicht mehr ihre eigenen Kinder versorgen musste, war Zeit und Platz für den nächsten Schritt: Sie begründete eine Schule für die Fayu. Bald darauf konnten die Fayu-Kinder etwas, was die Erwachsenen nicht konnten: rechnen, lesen und schreiben.
In der Tragikomödie »Wenn der Vater mit dem Sohne« tritt Heinz Rühmann alias Teddy Lemke als Ziehvater und Lehrer in Erscheinung: Für ein Kind zu sorgen, es zu lieben und groß zu ziehen, auch wenn es nicht sein eigenes ist, und es dann wieder an die Mutter abgeben zu müssen, verlieh der Geschichte einen Hauch von Tragikomödie. Ebenso hatte die Romanfigur Winnetou, die Karl May schuf, Lehrer, und zwar im Wesentlichen drei: Der erste war sein Vater, Intschu Tschuna, ermordet von Weißen aus Gold-Gier, der zweite war Klekhi-Petra, ermordet von Weißen aus Rachsucht unter Alkohol-Einfluss, und der dritte sein (Bluts-)Bruder Old Shatterhand. Letzterer allerdings eher in der Rolle eines Gebers und Nehmers, so lernten beide voneinander, was auch eine Frage des Alters war.
Es gibt also grundsätzlich Lehrer, die wir alle kennen: unsere Eltern. Und ebenso grundsätzlich besteht ein Lehrer-Bedarf, auch wenn wir dies als Kinder nicht immer einsehen mögen. Und es gibt einen Lern-Bedarf. Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir!
III.2 Der A-Modus
An diesem Punkt unserer Reise wollen wir kurz innehalten und bilanzieren: Wir haben nachvollzogen, dass es einen Lehrer- und einen Lernbedarf gibt. Des Weiteren haben wir ergründet, dass man nicht automatisch schlauer wird. Doch wie sieht es nun mit der Evolution aus? Immerhin ist es selbst bei blühender Phantasie nur schwer vorstellbar, dass der erste Mensch von einem Affen unterrichtet wurde und die ersten Vokabeltests von einem Tier korrigiert wurden, das weder schreiben, noch rechnen oder sprechen konnte.
Und wieso eigentlich der erste Mensch? Wo kam er her? Gibt es in diesem Bereich einen Automatik-Modus, gewissermaßen für die Zellen im Kleinen? Denn im Großen funktioniert der Automatik-Modus nicht, wie wir am Beispiel des L-Bedarfs gesehen haben. Also, wie kam der erste Mensch auf die Welt?
Zur Klärung dieser Frage kommen gemäß Evolutionstheorie zwei Möglichkeiten in Betracht: Er wurde von einem Affen geboren, oder ein Affe verwandelte sich quasi in einen Menschen. Wenn auch in einen eher primitiven. Und damit sind wir wieder beim Übergang vom Affen zum Menschen, denn das ist das entscheidende Kriterium, in der Wissenschaftsszene spricht man vom »Missing Link«, und in der Tat ist dies die zentrale Frage: Wie entsteht aus einem Affen ein Mensch? Und aus zwei Affen zwei Menschen? Dieser Gedankengang animiert zum mathematischen Knobeln: aus X Affen X Menschen?
Fazit: War ein Affe so weit entwickelt, dass er zu einem Menschen werden konnte, inklusive Erwerb der menschlichen Intelligenz, der Fähigkeit der Sprache, des Denkens und des Transformieren des Blutes? Oder waren es mehrere Affen, die diesen Prozess durchmachten?
Tja, eine harte Nuss, denn sowohl für die eine als auch für die andere Variante gibt es keine Beweise, sondern es stellt sich im Gegenteil die Frage, warum dieser Prozess dann heute nicht mehr vollzogen wird? Denn nur das wäre ein Beweis. Auch Affen entwickeln sich schließlich weiter gemäß Evolutionstheorie. Wenn auch nicht täglich, aber schon ein paar Mal im Jahr könnte man also eigentlich davon ausgehen, dass so ein Sprung vom Affen zum Menschen zu beobachten wäre. Bei früheren Besuchen in Zoos und Tierparks habe ich indes nie einen solchen Vorgang beobachtet oder davon gehört, und auch heutzutage ist ein derartiger Sprung dort nicht zu verzeichnen.
»Für mich war der Dschungel wie ein Zoo, nur dass die Tiere frei herumliefen«, schreibt Sabine Kuegler, doch auch sie hat nie beobachtet, wie aus einem Affen ein Mensch entstand, sondern nur, dass Tiere Nachkommen gleicher Art hervorbrachten. In Zoos und Tierparks müssten die Affen doch eigentlich weiter entwickelt sein als in freier Wildbahn. Sozusagen ein bisschen zivilisierter, doch hat noch niemand einen Beweis zur Untermauerung dieser Theorie vorgelegt.
Ein bisschen erinnert mich die Vorstellung ja an den Film »Jurassic Park«, in dem Wissenschaftler die DNS von vor Jahrmillionen ausgestorbenen Dinosauriern aus einem in Bernstein gefangenen Moskito gewinnen können und so in unserer heutigen Zeit neue Exemplare hervorzubringen im Stande sind. Denn nur Gleiches kann Gleiches hervorbringen. Zellen entstehen aus Zellen, es gilt das Prinzip der Zellteilung: Eine Zelle teilt sich in zwei andere, doch die sind der Mutterzelle ähnlich, oder wie der Lateiner sagt: »Omnis cellula e cellula«.
Dem Problem der Menschwerdung gehen weltweit zahlreiche Forscher nach, und im Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig arbeiten rund 400 Wissenschaftler aus verschiedenen Bereichen unter dem Leitmotiv: »Was macht die Einzigartigkeit des Menschen aus?«
Genetiker, Sprachforscher, Biologen, Psychologen und Paläontologen arbeiten dort interdisziplinär, und sie haben festgestellt, dass die Menschen »99 Prozent ihrer Gene mit dem Schimpansen gemein haben. Doch das ist nicht das Entscheidende. Interessant ist das eine Prozent, das sich unterscheidet, und die meisten Unterschiede finden sich in den für das Gehirn zuständigen Erbgutabschnitten«.
»98,4 Prozent der genetischen Informationen zwischen Mensch und Schimpanse sind gleich«, stellte auch Bill Bryson fest, doch ist diese Sichtweise vielleicht zu allgemein, müssen wir spezieller werden, um ein Prinzip für die W-Formel aufzudecken?
Im Alter von 13, 14, 15 Jahren, sprich in der Pubertät, begannen sich die Kinder nachhaltig zu individualisieren. Bei uns zeigte sich dass dadurch, dass ein Schüler eines Tages mit Jacke im Unterricht saß. Er zog sie einfach nicht aus. Unerhört! Das war so cool, dass wir anderen Jungs es alsbald nachmachten. Mädchen übrigens auch. Ein anderer Aspekt zeigte sich im Weg des geringsten Widerstands, eine Art »Bequemlichkeits-Weg«. Gerade soviel Hausaufgaben wie nötig, dann ab zum Cowboy-und-Indianer-spielen.
Klar, ich habe auch lieber Fußball gespielt als Latein-Vokabeln gelernt. Aber ich bin damals eigentlich nie so richtig ins Extreme verfallen. Noch nicht. Das habe ich mir für die zehnte Klasse aufgehoben. Wie wir gesehen haben. Doch zurück zum Allgemeinen und Speziellen: Die Genealogie, die Familienkunde, ist ein Wissenschaftsbereich, der die Abstammung des Menschen von seinen Vorfahren untersucht. Es ist eine spannende Geschichte, manche Menschen können ihren Stammbaum über Jahrhunderte zurück verfolgen. Doch an welcher Stelle soll da der Affe ins Spiel gekommen sein?
Helen Keller lernte zunächst in der Natur, sehr zur Freude ihrer Lehrerin Anne Sullivan, die die Natur als beste Lehrmeisterin ansah. Doch sie fürchtete sich auch ein wenig. Wie sollte sie ihr gegebenenfalls klar machen, woher das Baby, ihr Schwesterchen gekommen war? Oder andere Babys? Also wie erklären Sie einer blinden und taubstummen Siebenjährigen, woher die Menschenbabys kommen? Gelegenheit, danach zu fragen, bot sich Helen durchaus, zum Beispiel in ihrer »Warum«-Phase, die auf die Phase des Zählens folgte. Damals wurde alles gezählt, was ihr unter die Finger kam, im Haus und im Garten. So lernen Kinder. 100 Tage nach Anne Sullivans Ankunft in Tuscumbia kannte Helen bereits über 100 Wörter. Und je mehr Wörter sie kannte, um so mehr lernte sie kennen und konnte ihren Gedanken Ausdruck verleihen, sich mitteilen, die Dinge ergründen. »Warum?« wurde ihre Lieblingsfrage für über zwei Wochen, und ihre Erzieherin, ihre Mutter und ihre beiden älteren Brüder James und Simpson hatten alle Hände voll zu tun, die Fragen zu beantworten.
Mitten in ihrer »Warum?-Phase« wurde Elisabeth geboren; Leila, eine Cousine, hatte Nachwuchs bekommen. »Warum hat Leila Baby bekommen?«, wollte Helen wissen und »woher kommt das Baby?«
»Der Doktor hat Leila das Baby gegeben«, antwortete Anne Sullivan.
»Wo hat Doktor das Baby gefunden?«, lautete die nächste Frage.
»Unter dem Herzen von Leila.«
Zum Glück fragte Helen nicht weiter. Zunächst.
Doch wir fragen nun an Helens Stelle einfach mal ganz unbedarft weiter, denn wir sind schließlich erwachsen: Wenn aus einem Affen ein Mensch geworden ist, müsste dann nicht konsequenterweise dieser Mensch eine Frau gewesen sein? Müsste nicht überhaupt der erste Mensch eine Frau gewesen sein? Denn schließlich können nur Frauen Babys bekommen, und also neue Menschen auf die Welt bringen. Egal ob künstlich oder sonst wie befruchtet. Nach einer Schwangerschaft von in der Regel neun Monaten. Doch, stop! Sie meinen, die Erklärung liegt auf der Hand? Wir begegnen ihr tagtäglich in den Medien und im wahren Leben? Oh ja, ganz richtig!
In dem Artikel »Das Geheimnis Mensch« wurde im Frühjahr 2004 in der FunkUhr erläutert, wie »das Wunder des Lebens« beginnt: »Mit dem Wettlauf von 500 Millionen Samenzellen zur Eizelle der Frau«. Die Antwort, wie neue Menschen entstehen, ist also ganz einfach, nahezu trivial: Sex!
An dieser Stelle unserer Reise legen wir eine kleine Pause ein und halten noch einmal einen Rückblick: Es gibt also nicht nur keinen Beweis für die Entstehung des Menschen aus dem Affen (bzw. eines Menschen aus einem Affen), sondern die Fakten und Tatsachen sprechen allesamt gegen eine derartige Art der Auslegung der Evolutionstheorie. Ebenso wie gegen das quasi-automatische Lernen. Ein Merkmal, das gerade in unserer heutigen Zeit, in der Bildung so groß geschrieben wird, ganz offensichtlich zu Tage tritt. Und genau diese Fakten finden im Alltag längst Anwendung. Schließlich müssten Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz sonst nicht regelmäßig zur Blutspende aufrufen, sondern man könnte auch Blut von Affen nehmen, mit denen wir Menschen ja genetisch fast identisch sind. Und nach Ansicht mancher Wissenschaftler sind wir ja im Grunde nur eine Art höherentwickelte Affen. Tja, dann müsste das Blut auch eins zu eins verwendbar sein. Ist es aber nicht. Und selbst die Menschen unterscheiden sich noch einmal in vier Grundtypen bzw. Blutgruppen: A, B, AB und Null. In der Pharmazie werden verschiedene Medikamente aus menschlichem Blut hergestellt und finden unter anderem Verwendung bei Operationen. Im Blutplasma sind über 130 Eiweißarten vorhanden, von denen rund ein Viertel zu Arzneimitteln verarbeitet wird. Eine kleine interessante Randnotiz ist, dass Blutplasma gelblich aussieht, und eine grünliche Färbung dem Kundigen die Benutzung der Antibabypille verrät, während eine eher milchige Konsistenz auf ein recht üppiges - fettes - Frühstück schließen lässt.
Wie wir Eingangs des Kapitels festgestellt haben, ist »der ganze große Reichtum an Kohlenstoffverbindungen in der Natur einmal durch den Körper von Lebewesen hindurchgegangen«. Diese Erkenntnis vermittelte Walter Greiling bereits in den 1960er Jahren in dem Buch »Chemie - Motor der Zukunft«. »Der Torf, die Braunkohlen, die Steinkohlen, das Erdöl, alles sind Reste von Leibern unzähliger Pflanzen- und Tiergenerationen.«
Haben wir damit die W-Formel gefunden? Muss nicht zwangsläufig irgendjemand die ersten Lebewesen zu Stande gebracht und ihnen die Möglichkeit zur Fortpflanzung mit auf den Weg gegeben haben? Denn vom biologischen Ablauf her stammen die Dinge, von denen wir bislang dachten, dass wir, die Menschen, aus ihnen hervorgegangen sind, von uns selbst. Nachdem nun also die biologischen Tatsachen die biologischen Theorien nicht bestätigt haben, stecken wir gewissermaßen in einer Sackgasse.
»Des is' wia bei jeder Wissenschaft, am Schluss stellt sich dann heraus, dass alles ganz anders war.« (Karl Valentin)
Wir sind damit aber nicht am Ende unserer Reise angelangt, denn wenn keine unmittelbaren Details in einer Sache zu eruieren sind, dann heißt das nicht automatisch, dass es keine gibt. Vielleicht sieht man sie nur (noch) nicht. Ändern wir also unsere Perspektive, begeben wir uns vom kleinen zum großen und dann zum ganz kleinen Anschauungsobjekt: Ein Blick auf den Stundenplan belehrt uns, dass es noch andere Fächer gibt, die uns weiterhelfen können, die Welt zu verstehen: Chemie und Physik. Wenden wir unsere Aufmerksamkeit also vom Mikrokosmos hin zum Makrokosmos: Die Astronomie ist ein Teilgebiet der Physik, und gerade im 20. Jahrhundert hat sie sehr viel zur Erklärung der Entstehung der Welt beigetragen.
Also lassen Sie uns unsere Reise jetzt aus der physikalisch-chemischen Sichtweise fortsetzen. Schließlich bestehen Zellen aus Molekülen und also Atomen. Wenn man nun deren Entstehung erklären und nachvollziehen könnte, dann wäre anschließend mit Sicherheit auch eine Verbindung zu komplexeren Gebilden wie den ersten Zellen möglich. Und dann wäre es nur noch ein kleiner Schritt bis zur W-Formel, der Weltformel.
»Die Weltformel wäre damit für die Physik das, was der Globus in der Geographie ist: ein umfassender Blick auf das Ganze«, schreibt Olaf Fritsche, und damit hätten wir dann das Grundprinzip gefunden. Alles weitere wird sich dann schon ergeben.
Schauen wir also auf das Ganze, auf das ganze Universum!
III.3 Die W-Formel
Was für den Biologen die Zelle, ist für den Physiker und Chemiker das Atom. Atomos, das Unteilbare, stammt aus dem Griechischen. Mittlerweile wissen wir - seit dem 20. Jahrhundert -, dass auch das Atom durchaus teilbar ist, darauf basieren zum Beispiel die Kernwaffen, auch Atombomben genannt.
Ihr Prinzip ist die Zerlegung des Atomkerns, und zwar von mehreren Atomen, so dass in einer Kettenreaktion große Mengen von Energie freigesetzt werden können. In kontrollierter Form bringt uns die Geschichte mit der atomaren Kettenreaktion übrigens zu den Kernreaktoren, die der Stromerzeugung dienen.
Doch das ist eine andere Geschichte. Zurück zu unserem Atom. Dieses besteht aus einem Atomkern und einem oder mehreren Elektronen. Der Atomkern besteht aus positiv geladenen Protonen und Neutronen, die keine elektrische Ladung inne haben. Die Elektronen umgeben den Atomkern und sind negativ geladen, wobei die Bezeichnungen nicht wertend zu verstehen sind. Schließlich ist ein Mann nicht positiv, eine Frau negativ und ein Kind neutral. Es dient lediglich der Unterscheidung.
Anfangs ähnelte ein Atommodell dem Modell unseres Planetensystems, ein großer Kern in der Mitte - so wie die Sonne, und die Elektronen ziehen draußen ihre Bahn - so wie die Planeten. Doch beim Fortschreiten von der zweidimensionalen zur dreidimensionalen Betrachtung zeigte sich beim Atom ein etwas anderes Verhalten. Die Elektronen flitzen nämlich nicht in fest zuordnenbaren Bahnen um den Kern, sondern sind quasi mal hier mal da. Deswegen sprechen die Chemiker und Physiker bei den Elektronen auch von Aufenthaltswahrscheinlichkeiten. Die natürlich berechnet werden können. Aber das soll uns jetzt weniger beschäftigen. Entscheidend ist, dass es unterschiedlich viele Protonen und Neutronen und Elektronen geben kann, aus denen ein Atom besteht. Und dadurch kommen wir zu den chemischen Elementen, deren es auf der Erde 92 natürliche gibt. Das schwerste (mit den meisten Protonen und Neutronen und Elektronen) ist das Uran, das leichteste der Wasserstoff. Der hat genau ein Proton und ein Elektron.
Ist nicht viel, reicht aber, und in Verbindung mit Sauerstoff (acht Protonen) und einem weiteren Wasserstoffatom ergibt sich unter den geeigneten Bedingungen das berühmteste Molekül der Welt: H2O, Wasser. Und damit sind wir schon mitten im Film. Denn die Frage aller Fragen lautet: Wie entstanden aus einer Anzahl von Atomen die ersten Moleküle, die sich im Laufe der Zeit ihrerseits zu komplexeren Gebilden zusammenfanden, um letzten Endes die ersten Zellen hervorzubringen?
Wenn man einen Stein betrachtet, dann mutet es höchst unwahrscheinlich an, dass daraus irgendwann einmal ein lebendiger Organismus wird. So ist denn auch der Sprung vom Anorganischen zum Organischen nicht so einfach nachzuvollziehen, wie wir soeben in Erfahrung gebracht haben. Doch nach Ansicht mancher Wissenschaftler ist dies bei Betrachtung eines Vorganges, der sich über eine lange Dauer erstreckt, durchaus möglich. Im Prinzip ist jeder Planet mit den entsprechenden Voraussetzungen, also Entfernung zur Sonne bzw. einem Stern und dem Vorhandensein der oben angesprochenen Elemente, geeignet Leben hervorzubringen, genau wie unsere Erde, die 30.000 Lichtjahre vom Zentrum der Milchstraße entfernt ist.
Wie David und Arnold Brody in ihrem Buch »Die sieben größten Rätsel der Wissenschaft« ausführen, »ging die Erde vor 4,6 Milliarden Jahren aus der Zusammenballung von Staub und Gasen hervor.« Sie stellen die Frage, die auch wir uns soeben gestellt haben, nämlich »wie sich Leben aus Aminosäuren und RNA entwickelt haben kann, wenn diese Substanzen Produkte lebendiger Zellen sind?« Und sie liefern eine wahrscheinliche Antwort auf die Frage, der wir jetzt nachgehen, gleich mit: »Beide Komponenten waren in der Ursuppe vorhanden.«
Um diese Theorie zu überprüfen, kann wiederum ein interdisziplinärer Ansatz hilfreich sein, und man sollte meinen, dass die Wissenschaftler im 20. Jahrhundert diese Frage eingehend erörtert hätten, sie betrifft schließlich unsere Existenz. Unmittelbar. Und in der Tat, im Allgemeinen gibt es dazu zwei Theorien: Die erste verlegt den Beginn der Evolution auf die Erde und postuliert, dass das Leben sich hier gebildet hat; gemäß zweiter Theorie kam es sozusagen per Luftpost - mit Asteroiden oder anderen kosmischen Kleinkörpern aus dem All.
Letztere Theorie lässt sich leicht nachvollziehen, denn bereits heute wird gemutmaßt, dass wir Menschen durch die Raumsonden, die wir von der Erde zu (noch unbewohnten bzw. unbelebten) Planeten schicken, unzählige Bakterien dorthin befördern. Auf diese Weise würde dort also ebenfalls zumindest die Chance bestehen, dass sich langfristig lebende Organismen entwickeln. Und je mehr Raumsonden desto mehr potentielle zukünftig mit Lebensformen bevölkerte Planeten. Quasi eine Art Schneeballprinzip.
Leider bringt uns diese Theorie der Lösung unserer Ausgangsfrage nicht näher, denn zu sagen, »es kommt von draußen«, wäre nicht zufriedenstellend. Wenden wir unsere Aufmerksamkeit also Theorie Nummer eins zu: Irgendwo im Weltall muss sich dieser Prozess der Lebensentstehung abgespielt haben, also warum nicht auf der Erde? Diese Ansicht teilen derzeit die meisten Wissenschaftler - und sie verfolgen dabei alle einen gemeinsamen Ansatz in unterschiedlichen Varianten.
Die Ur-Erde, wie sie damals bestand, war eine, nun sagen wir, nicht eben lebensfreundliche Angelegenheit. Wir können froh sein, dass wir unsere Reise nur in Gedanken hierher machen, denn ansonsten würden wir ersticken. Die Atmosphäre ist unseren Lebensbedingungen noch nicht angepasst. Doch es waren bereits einige Bausteine, Elemente vorhanden, die unabdingbar für die Evolution waren.
Auch wenn es im Laufe der letzten Jahrzehnte weiterführende und ergänzende Theorien über den damaligen Zustand der Erde gegeben hat, so können wir uns dem Prinzip des Lebens anhand eines Ansatzes aus den 1950er Jahren nähern: Der Zweite Weltkrieg war vorüber, die Goldenen Fünfziger angebrochen, die Wissenschaftler konnten sich wieder ihrer friedlichen Forschung widmen. Damals herrschte die Meinung vor, dass das Leben im Ozean entstanden sei, im Ur-Ozean. Auch heute gibt es noch Forscher, die diese Ansicht teilen, andere sprechen von Meereis, Tonmineralen oder Vulkanen bzw. unterseeischen heißen Quellen. Aber das Grundprinzip, das für alle Theorien nach wie vor Bestand hat, stellte 1953 der junge amerikanische Chemiker Stanley L. Miller nach. Nach ihm und seinem Professor an der University of Chicago, Harold Urey, ging es in die Geschichte ein als das »Miller-Urey-Experiment«.
Stanley Lloyd Miller war Student bei Harold Urey an der Universität von Chicago. Er gilt als der Vater der biologisch-chemischen Evolutionstheorie des Lebens, denn er probierte einfach aus, worüber andere zuvor Theorien aufgestellt hatten: Er experimentierte mit den Stoffen, von denen angenommen wird, dass sie auf der Ur-Erde vorkamen. Die Uratmosphäre der Erde bestand aus Ammoniak, Methan, Kohlendioxid und Wasser in Form von Gas und Wasserstoff. Es herrschten viele Gewitter, und über die Zwischenstufen Formaldehyd und Blausäure entstanden schließlich die Grundbausteine des Lebens: die ersten Aminosäuren. Dies konnte Miller in seinem als »Ursuppen-Experiment« berühmt gewordenen Versuch simulieren, es bildeten sich tatsächlich Aminosäuren, nachdem er seiner Suppe einen elektrischen Funkenschlag als Nachbildung von Blitzen zugesetzt hatte. Die Grundbausteine des Lebens waren geschaffen!
Damit war der Anfang zum Eiweiß gemacht. Mit Hilfe geeigneter Katalysatoren war es nur noch eine Frage der Zeit, bis die ersten Lebewesen auf der Bildfläche erschienen. In der biochemischen Wissenschaft war es der Durchbruch, erstmals konnte schlüssig bewiesen werden, dass aus anorganischen Elementen organische Verbindungen entstehen können, die die Basis des Lebens sind. Dieser Vorgang konnte jederzeit wissenschaftlich reproduziert werden, eine Grundbedingung eines Beweises in wissenschaftlicher Hinsicht. Heutzutage wird dieses Experiment bereits von Schülern im Unterricht durchgeführt. So können sie sich anschaulich von der Entstehung der Welt, der ersten Lebewesen und schließlich des Menschen ein Bild machen. Da diesen Vorgängen beachtliche Zeiträume zu Grunde liegen, ist noch eine Menge Phantasie erforderlich, um den Prozess in allen Details nachvollziehen zu können. Doch vom Grundprinzip ist es möglich, auch wenn niemand so genau weiß, wie lange die Suppe kochen musste. Aber das soll uns an dieser Stelle nicht weiter stören, auf ein paar hundert Millionen Jahre kam es damals nicht an. Hauptsache, das Ergebnis kann sich später einmal sehen lassen!
Das Experiment wurde anschließend von unabhängigen Wissenschaftlern wiederholt, und sah im Prinzip stets gleich aus: Die bereits angesprochenen - vermuteten - Komponenten in der Uratmosphäre der Erde, Ammoniak, Wasser, Methan und Wasserstoff wurden elektrischen Funken ausgesetzt, wodurch Blitzschläge simuliert wurden. Die dann kondensierten Gase wurden in dem Urozean, was im Experiment einfaches Wasser war, aufgefangen und durch Erhitzen wiederum verdampft. Dadurch gelangten sie aufs Neue in den Kreislauf in der Atmosphäre mit ihren Blitzen. Wurde dieses in sich geschlossene System nun eine Woche unter diesen Bedingungen gehalten, bildeten sich in der wässrigen Mischung komplexe organische Verbindungen, darunter Aminosäuren, Zucker und Fettsäuren.
Am 15. Mai 1953 wurde das Experiment in der Wissenschaftszeitschrift Science veröffentlicht und erreichte so die Öffentlichkeit. Auf Grund der elektrischen Einwirkungen wurden auch Parallelen zu Frankenstein gezogen, das Thema wurde in Comics, Filmen und in Romanen aufgegriffen und verarbeitet. In den nächsten Jahrzehnten variierte Miller seine Versuchsanordnung um winzige Nuancen und perfektionierte so das Geschehen und die Theorie der präbiotisch-chemischen Evolution, dem Ursprung des Lebens. Als er 2007 starb, war das Medienecho gewaltig.
Dank Millers Arbeit war die Grundlage geschaffen, und heutzutage findet man sämtliche Details zum Miller-Urey-Experiment im Internet. Wem das alles jedoch ein wenig technisch vorkommt und Physik und Chemie nicht zu seinen Lieblingsfächern in der Schule zählte, der sei beruhigt. Mit dem Experiment befanden wir uns zwar schon ein gutes Stück in der Chemie, Physik und Biologie, doch im Leben finden sich genug Analogien für Nicht-Naturwissenschaftler. Dafür machen wir auf unserer Reise mal wieder einen kleinen Abstecher in meine Schulzeit. Dort gab es Dinge, die einen geläufigen Vergleich erlauben:
Montag Mittag. Ich bin als erster zu Hause, mein Bruder hat heute eine Stunde länger als ich. Das macht aber nichts, denn es gibt keine Reste vom Sonntag. Wir haben gestern Mittag alles aufgegessen und somit ist der eigentliche »Reste-Tag« reif für ein komplett neues Mittagsgericht. Es ist unser Lieblingsgericht: Pfannkuchen. Um genau zu sein: Eierpfannkuchen. Im Pfannkuchenessen sind wir die absoluten Champions, kurz gesagt: völlig verrückt danach. Insofern brach bei uns auch nie sonderlicher Unmut aus, wenn es keine Reste vom Sonntag gab, im Gegenteil.
Das Schöne an der Sache war - aus Kindersicht -, dass wir gar nicht viel tun mussten. Außer essen. Unsere Mutter hat den Teig schon fertig und backt, wenn wir soweit sind. Also Rad abstellen, Schulsachen auf den Schreibtisch zwecks späterer Hausaufgaben, Tasche in die Ecke, Hände waschen, fertig. Das Timing ist im Laufe der Zeit so hervorragend, dass ein Pfannkuchen genau die Zeit braucht, um fertig zu werden, in der wir einen essen. Wenn wir gleichzeitig Schulschluss hatten und dementsprechend auch etwa zeitgleich zu Hause waren, wurden zwei Pfannen zur Zubereitung benutzt. Das animierte unsere Mutter nach Erreichen des ersten Sättigungsgrades - also nach ungefähr fünf bis sechs Pfannkuchen - dazu, dass sie auch selber einmal einen aß.
Die anfangs fast streng gepflegte klassische Variante mit Apfelmus erfuhr im Laufe der Zeiten zahlreiche Variationen: mit Zimt und Zucker, Marmelade, vorrangig Erdbeer, Apfelmus und Zucker gemischt, Vanilleeis, und im fortgeschritteneren Teenageralter habe ich auch schon mal eine Banane fachgerecht eingerollt. Um richtig satt zu werden. Ja, wir haben die Pancakes stets fachmännisch bestrichen und dann zusammengerollt. Dann konnte man sie prima mit Messer und Gabel essen, nämlich in portionsgerechte Stücke schneiden.
Während des Studiums habe ich eine weitere Version in Erfahrung gebracht. Als ich eines Tages mit Freunden zu Hause war und wir uns zwischen den Vorlesungen kurz ein paar Pfannkuchen zur Sättigung machen wollten, schnitt eine Freundin Apfelscheiben in den Teig. Im ersten Moment war ich verblüfft, doch bald gab es Apfelpfannkuchen. Mit Zucker. So spart man das Apfelmus. Es schmeckte ganz gut, nur dürfen die Äpfel nicht zu wässerig sein. Das als kleiner Tipp.
Diese und weitere Varianten sind international ebenfalls bekannt: So berichtet der englische Star-Koch Jamie Oliver, dass in Amerika gerne eine Handvoll Heidelbeeren dem Teig zugesetzt wird, er selbst gibt ein Rezept für Pancakes mit Bananen-Kokos-Joghurt und Mango an, und weist darauf hin, dass bei amerikanischen Pancakes Backpulver ins Mehl gemischt wird.
Auch Thomas Lieven kannte mehrere Rezepte für die Verwendung von Eiern, Mehl und Milch, so zum Beispiel eines für brennende Eierkuchen, die er 1940 in Portugal kredenzte. Man bestreue die Eierkuchen einfach mit reichlich Zucker, gebe einen ordentlichen Schuss Rum drüber und zünde ihn an. Im Dschungel waren Pfannkuchen ebenfalls sehr beliebt, das Dschungelkind und seine Geschwister aßen sie am liebsten mit Zimt und Zucker, und in dem Heinz Rühmann-Film »Wenn der Vater mit dem Sohne« lässt sich Ulli, der Ziehsohn von Teddy Lemke alias Heinz Rühmann, von der Küchentante am Telefon Anweisungen geben und versucht Eierkuchen zu backen.
Heutzutage sind wir auf telefonische Ratschläge indes nicht mehr angewiesen, in nahezu jeder Zeitschrift findet man ein Rezept für Pfannkuchen: Es gibt sie gefüllt mit Champignons, Möhren und Zucchini, und unter dem Begriff »Asia-Pfannkuchen« mit unter anderem 300 Gramm Rinderhackfleisch mutet das ganze recht exotisch an.
Nun werden Sie sich vielleicht fragen, was hat das Pfannkuchen-Szenario mit der Evolution und der Entstehung des Menschen zu tun? Oh, eine ganze Menge. Denn wie Frank D. Braun im Vorwort des Buches »Die 100 besten Meisterköche, Restaurants, Rezepte, Weine« ausführt, sind Essen und Trinken die Basis des Lebens. Und: Hält man sich nicht an das Rezept, dann bekommt man schnell etwas ganz anderes.
Das süddeutsche Pendant lernte ich als Zwölfjähriger bei einem Besuch meiner Verwandten in München kennen. Wir fuhren raus aufs Land und kehrten zum Mittag in einem Landgasthof ein. Urbayerisch und gemütlich. Dort aß ich ein Gericht, das so lecker war, dass ich es unbedingt wieder essen wollte. Doch leider hatte ich mir den Namen nicht gemerkt. Erst viel später erfuhr ich, dass es sich eigentlich nicht um ein bayerisches, sondern um ein österreichisches Gericht handelte: Kaiserschmarren. In der Beilage der Zeit, dem ZeitMagazin, beschreibt Wolfram Siebecks im September 2007 ein Rezept und weist darauf hin, dass wir uns »im österreichischen Sektor der Hochküche befinden«. Er macht als ersten und ziemlich wesentlichen Unterschied zum Pfannkuchen aus, dass man beim Kaiserschmarren das Eiweiß vom Eigelb trennt und mittels Schneebesen in quasi festen Schnee verwandelt. Dieser Schnee gibt dem Teig die Lockerheit. Des Weiteren benutzt Wolfram Siebecks einen Backofen, keine Pfanne. Aber seine Zutaten sind genau die gleichen wie bei meinen Pfannkuchen: Eier, Mehl, Zucker, Milch, Butter oder Margarine. Zwischendurch muss der Schmarren noch zerrupft werden, damit er auch so aussieht, wie er aussehen soll. Er benutzt dazu zwei Gabeln und garniert ihn an dieser Stelle mit ein wenig Zimt. Den kenne ich auch von meinen Pfannkuchen, und damit schließt sich der Kreis, denn heute esse ich beides gern.
Eine weitere (französische) Variante sind übrigens Crêpes, wie wir sie zum Beispiel von Volksfesten kennen. Die Variante ohne Eier und Milch, nur mit Mehl, Salz, Fett oder Schmalz und Wasser führt uns hingegen nach Mexiko: Weizen-Tortillas sind ein wesentlicher Bestandteil der dortigen Küche. Weizenvollkornmehl und Dinkelmehl wiederum gelten als Bestandteile von Vollkornwaffeln.
Doch zurück zu unserem Ausgangsthema: Es bleibt festzuhalten, dass wir sehr genau zu Werke gehen müssen, denn spätestens beim Teig zubereiten sollte man wissen, was es werden soll. Dann hat man die entsprechenden Zutaten besorgt und weiß, ob man die Eier trennen muss oder nicht. Ob es ein Hauptgericht wird oder ein Dessert. In der Pfanne lassen sich nur noch Nuancen ändern, aus Pfannkuchenteig lassen sich schwerlich Tortillas machen, und für Kaiserschmarren bereitet man den Teig auch anders zu als für Crêpes oder Waffeln.
Und so ist es auch bei der Versuchsanordnung für unser Experiment zur Evolution: Würden wir zu wenig Wasser beimischen, fehlte die Basis, bei zu viel elektrischer Energie (Simulation von Blitzen) wäre die Reaktion heftiger als gesund wäre. Zuviel Ammoniak oder Methan wiederum würde das chemische Gleichgewicht durcheinander bringen. Das richtige Mischverhältnis ist also von entscheidender, ja existenzieller Bedeutung. Für die Entstehung von Leben, wie wir es kennen, sind Aminosäuren unentbehrlich, und die entstehen nun einmal nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Wenn man die nicht herstellen kann, dann wird es nichts mit dem Versuch oder Experiment. Gescheitert nennt man das dann.
Doch es hat funktioniert, auch wenn wir es im Grunde nicht sehen, sondern nur durch Rückschlüsse nachweisen können. Vielleicht war es letzten Endes aber auch gar nicht so schwierig, immerhin kann den Versuch heutzutage jeder Hobby-Chemiker nachstellen, und im Chemie-Unterricht dürfte es ebenfalls kein Problem sein. Die einzige Bedingung wäre, dass das Labor in den sieben Tagen nicht für andere Versuche gebraucht wird, da es sich ja um ein geschlossenes System handelt. »Was das Leben sonst auch sein mag, auf der Ebene der Chemie ist es erstaunlich profan: Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff, ein wenig Calcium, ein Schuss Schwefel, eine kleine Prise von ein paar anderen ganz gewöhnlichen Elementen, das ist alles, was man braucht«, bilanzierte Bill Bryson.
Wenn Sie jetzt ein wenig Hunger bekommen haben, dann ist das durchaus kein Problem. Jeder Pfannkuchen-, Crêpes- und Kaiserschmarrenesser hat meine volle Sympathie, wir können gerne eine Pause einlegen, das Kapitel ist gleich zu Ende, wir haben das Rätsel der Evolution des Lebens fast gelöst. Denn das Prinzip beim Pfannkuchenbacken ist dasselbe wie bei dem Experiment im Chemie-Labor um Aminosäuren, Fettsäuren und Zucker zu produzieren.
Allerdings stellt sich in Bezug zum Universum abschließend noch eine Frage: Wer ist der Koch?