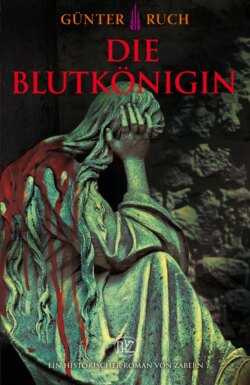Читать книгу Die Blutkönigin - Günter Ruch - Страница 17
Maura
ОглавлениеNachdem sich der römische Legat Quintus Titurius Sabinus bereits zum zweiten Mal an diesem regnerischen Tag grunzend in oder an ihr befriedigt hatte, erhielt die Sklavin Maura seine Erlaubnis, sich im Großen Fluss zu waschen. Um zu verhindern, dass die Trevererin über den Fluss floh, befahl Titurius, ihr Fußfesseln anzulegen. Damit konnte sie unmöglich schwimmen und auch nicht laufen; allenfalls kleine, trippelnde Schritte waren ihr möglich. Wenn sie die Fesseln trug, durfte sie sich wenigstens im Umkreis der Postenkette frei bewegen, das war der letzte Rest von Selbstbestimmtheit, den Titurius ihr gelassen hatte.
Die eisernen Schließen um ihre Knöchel schmerzten höllisch. Doch das ertrug sie mit unbewegter Miene. Es sah albern aus, wie sie mit den Fesseln lief. Titurius lachte, wenn er ihren Watschelgang sah. Es gab klare Regeln: Wenn sie bei Titurius im Kommandantenzelt war, brauchte sie keine Eisenfesseln zu tragen, aber einen Schritt vor dem Eingang des Zeltes endete diese Freiheit. Hinaus durfte sie nur in Fußfesseln.
So war jetzt ihr Leben.
Maura schluckte alles. Sie wollte überleben. Ihr war schnell klar geworden, dass dem römischen Legaten die Schmerzen anderer Menschen Freude bereiteten. Er war ein böser und schlechter Mensch. Sie hatte schon miterlebt, wie er Gefangene unter einem nichtigen Vorwand hatte hinrichten lassen.
Der Aufseher hatte ihr die Fußfesseln angelegt. Sie verließ das große Kommandantenzelt, das sie Prätorium nannten und das gleich neben dem Stabszelt am Kreuzungspunkt der beiden großen Lagerstraßen stand. Es regnete. Einer der kräftigen Frühsommerregen, die typisch für diese Jahreszeit und dieses Land waren. Tropfen schlugen in ihr Gesicht. Sie fühlte sich schmutzig und missbraucht, wie immer, wenn sie sich dem Lagerkommandanten hingegeben hatte. Sie fror, denn sie hatte nur das dünne römische Leibchen an, in dem Titurius sie am liebsten sah.
Sie ekelte sich vor sich selbst, vor der Beschmutzung ihres Körpers, den sie niemals wieder sauber bekommen würde, und sie fragte sich, wie weit es noch kommen musste, bis sie vielleicht doch den Mut fand, ihrem ehrlosen Leben ein Ende zu bereiten. Sie kam sich vor wie eine der römischen Lagerhuren, die das Heer selbst in den brenzligsten Situationen begleiteten und die ihren Leib für einen Scheffel Korn oder noch weniger verkauften.
Während sie das verschlammte Militärlager durchquerte, fühlte sie die begehrlichen Blicke der Soldaten auf sich ruhen, die vor und in den Zelten ihren Tätigkeiten nachgingen. Sie wussten alle, dass sie es eben im Zelt des Kommandanten mit dem Legaten getrieben hatte. Dass sein Samen in ihr war, aus ihr hinauslief, an der Innenseite ihrer Beine. Dass dieses widerliche, behaarte, geile Tier jedes Mal so viel abspritzte! Am schlimmsten war es, wenn er ihn ihr, so wie heute Morgen, in den Mund stieß. Er kam tief in ihrem Rachen, und auch wenn sich Maura anschließend die Mundhöhle mit ekelhaft bitterer Fischgalle ausspülte, wurde sie den widerlichen Geschmack seines Ergusses nicht wieder los. Doch die Alternative war der sofortige Tod. Wenn sie nicht tat, was er von ihr wollte, würde sie auf der Stelle sterben, dessen war sie gewiss. So war sein Charakter. Er genoss es, der Herr über Leben und Tod zu sein. Maura hatte von den anderen Dienerinnen schockiert erfahren, dass ihre Vorgängerin, eine eburonische Frau namens Meteriola, auf Befehl des Titurius und aus nichtigem Grund in aller Öffentlichkeit durch Erdrosselung hingerichtet worden war.
So wollte sie nicht sterben. Deshalb nahm sie Titurius’ Widerlichkeit in Kauf.
Ihre nackten Füße sanken fast bis zu den Knöcheln im kalten Schlamm ein. Sie setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen, versuchte trotz ihrer klimpernden Fesseln in einigermaßen gerader, stolzer Haltung zu gehen. Sie schaute arrogant an all den römischen Legionären vorbei, die sie mit gierigen Blicken begafften. Titurius besaß sie zwar, doch er hatte sie noch nicht gebrochen. Das spürten alle.
Sie ging die Via praetoria entlang. So nannten die Römer die eine der beiden kreuzförmig angelegten Hauptlagerstraßen. Sie führte zu einem der Tore, jenseits dessen der gewaltige Strom floss, den Kelten und Germanen gleichermaßen als heilig betrachteten. An den beiden Lagerstraßen entlang waren Dutzende großer Mannschaftszelte aufgestellt. „Caesar hat noch etwas mit diesem Lager vor“, sagten sie unter den Legionären. „Er hat es hier am Mittelrhein, knapp unterhalb der Einmündung der Mosel, strategisch angelegt“, spekulierten die Männer. Sie wetteiferten miteinander, der bessere Feldherr zu sein. Jeder hatte eine Idee, wie der Krieg gegen die Kelten und die Germanen zu führen sei. Jeder hatte seine eigene Strategie. Alle wollten die fremden Völker besiegen und unterwerfen. Maura wusste das aus den Offiziersbesprechungen.
Sie trippelte weiter. Die Via praetoria war von tiefen Furchen durchzogen und aufgeweicht, alle Mulden und Löcher waren vom Regen mit Wasser gefüllt. Der Weg zum Tor zog sich hin, denn das Legionslager maß weit mehr als tausend Schritt in der Seitenlänge und beherbergte um die fünftausend Soldaten, eine ganze Legion und die zugehörigen Hilfstruppen. Alle zusammen hatte Caesar zur Bewachung des Rheins und zur Einschüchterung der umliegenden Stämme hier im Land der unterworfenen Treverer zurückgelassen, während der Feldherr selbst mit seinen anderen Legionen im Norden Krieg führte. Auch für die Germanen auf der anderen Rheinseite setzte das große, befestigte Lager ein Zeichen.
Ohne dass Maura ihn hatte kommen sehen, kam der junge Marcus Valerius, der Militärtribun im Stab des Legaten, von hinten an ihre Seite. „Warte doch! Warte, Maura.“ Sie war froh, dass es nicht Gaius Arpinius war, der römische Ritter und Vertraute des Titurius, der keine Gelegenheit ausließ, mit ihr anzubändeln und ihr nachzustellen, obwohl sie seinem Herren, dem Kommandanten, gehörte.
Die Trevererin war schon vor zwei Jahren versklavt worden. Mehr als ein Jahr hatte sie das Lager mit einem römischen Offizier geteilt, der zur X. Legion gehörte. So kannte sie die Sprache des Feindes, das verhasste Latein, ganz leidlich, wenn auch mit starkem gallischen Akzent.
„Was wollt Ihr?“ Maura blieb stehen und stemmte die Arme in die Hüften. „Lasst mich in Ruhe! Weiß Euer Kommandant, dass Ihr mir nachstellt?“
Auch ihre Gefangenschaft und die Erniedrigung, die Sklavin und Hure eines römischen Offiziers zu sein, hatte nichts an der Ausstrahlung ihrer großen Schönheit geändert.
„Nein, Unsinn“, erwiderte Valerius verlegen. „Wieso sollte ich dir nachstellen? Im Gegenteil! Der Kommandant hat mich hinter dir hergeschickt. Ich soll aufpassen, dass du keinen Unsinn machst. Verstehst du? Du sollst nicht verloren gehen. Du hast es unserem verrückten Alten anscheinend ziemlich angetan.“
Maura zuckte ungerührt mit den Schultern.
„Soll ich ihm sagen, dass Ihr ihn einen verrückten Alten nennt?“
Valerius lachte. Er hatte noch das herzhafte Lachen eines Jungen. Soldaten, die länger im Krieg waren, lachten nicht mehr so. „Lass uns weitergehen. Die Anderen starren uns schon an“, sagte der junge Offizier unbehaglich. Er war ungefähr in Mauras Alter. Es war sein erster Einsatz. Mit seiner Berufung in die Legion erfüllte er den Traum des Vaters, der erst vor kurzem in den Stand eines Ritters erhoben worden war.
Valerius. Maura blinzelte, als wäre es wegen des Regens, und musterte ihn dabei verstohlen. Er war auf römische Art glattrasiert und hatte dunkelblonde Haare. Ihr war schon öfter aufgefallen, dass der schüchterne, ehrlich wirkende Junge mit den großen Ohren und dem schmalen Gesicht sie unauffällig beobachtet hatte, wenn er sie im Kommandantenzelt bei einer der „Offiziersbesprechungen“ sah. Maura fand diese Zusammenkünfte im Zelt des Titurius seltsam. Es war eher ein Gelage als eine militärische Besprechung. Der schüchterne Stellvertreter Cotta, die sechs jungen Militärtribunen und die Kommandanten der zehn Kohorten, die zum Legionslager gehörten, ließen sich auf transportablen Betten nieder, auf denen Titurius Decken und Felle hatte ausbreiten lassen. Sklaven und Sklavinnen trugen auf.
Der importierte Wein floss in Strömen, und es gab an Essen, was die Feldküche und die Organisationskünste der Heereslieferanten hier an der Grenze der bekannten Welt hergaben.
Maura war bei diesen Besprechungen stets dabei. Sie musste zu Füßen des Kommandanten liegen - wie ein Schoßhündchen. Titurius führte sie vor. Er war anscheinend unheimlich stolz darauf, dass er sie besaß, so wie andere Männer stolz auf ein neues Pferd waren. Er mästete sie geradezu. Seit sie der Sklavenmeister Considius in das Legionslager am Rhein gebracht hatte, war sie viel runder und fraulicher geworden, was dem Titurius bestens zu gefallen schien. Sie entfaltete ihre ganze weibliche Blüte …
„Wir sollten jetzt wirklich weitergehen, sonst …“
„Was sonst?“ Ein kleines Lächeln schlich sich in Mauras sonst emotionsloses Gesicht. Ihr war die Hilflosigkeit des jungen Militärtribunen sympathisch. „Also gut. Ich gehorche, Tribun. Gehen wir weiter.“
Der Regen wurde heftiger. „Wohin willst du eigentlich bei diesem Sauwetter?“, fragte Valerius.
Maura setzte sich wieder in Bewegung. „Ich will zum Rhein“, sagte sie und deutete auf die Porta praetoria, das Lagertor, das dem Fluss und dem germanischen Feindesland gegenüber lag. Dort hatten die Soldaten einen behelfsmäßigen Hafen angelegt und befestigt. Die von Ruderern angetriebenen, schwer bewaffneten und gepanzerten Patrouillenschiffe machten hier fest, mit denen die Römer den Rhein kontrollierten. Die Römer fühlten sich als die Herren des Flusses.
„Und was willst du da?“
„Ich will mich reinwaschen. Ich wollte mir einen Platz suchen, wo ich mich ungestört und unbeobachtet ausziehen und meinen ganzen Körper von oben bis unten säubern kann. Habt Ihr etwas dagegen?“
Valerius schluckte. „Was sollte ich dagegen haben?“, fragte der junge Offizier schüchtern. Er errötete bei der Vorstellung, dass sie sich nackt im Fluss wusch und dass er dabei auf sie aufpassen sollte. Er wechselte das Thema: „Ich finde, du kannst außergewöhnlich gut Latein. Wo hast du das gelernt?“
„Wollt Ihr das wirklich wissen, Valerius?“
„Warum fragst du das?“
„Weil Euch die Antwort vielleicht nicht gut gefallen wird.“
„Ich will es trotzdem wissen.“
„Also gut. Ich war die Sklavin eines Militärtribuns im Stab von Titus Labienus. In der zehnten Legion. Dreizehn lange Monate, bis er meiner überdrüssig wurde. Versteht Ihr, Marcus Valerius? Ich habe Eure Sprache im Bett eines römischen Offiziers gelernt.“
Valerius schwieg betroffen. Dabei wusste er genau, was es mit den keltischen und germanischen Sklavinnen auf sich hatte. Viele hochrangige Offiziere in Caesars Truppen in Gallien hatten Sklavinnen als Gespielinnen, die sie auf den Feldzügen begleiteten.
Und Maura war der Gedanke nicht unsympathisch, dass sich Valerius dabei sicher sie vorstellte.
Sie erreichten das stark gesicherte Haupttor des Lagers. Die wachhabenden Soldaten salutierten vor dem Militärtribun, der zu den ranghöchsten Offizieren des Lagers gehörte, und ließen ihn zusammen mit der Keltin Maura passieren. Dann standen beide jenseits des Haupttors, und ihnen eröffnete sich die befestigte Anlegestelle des Lagers. Der gewaltige Rhein floss vor ihnen vorbei. Es war der breiteste Fluss, den Valerius und Maura kannten. Wenn man den Rhein in seiner Mächtigkeit und Kraft sah, wurde einem bewusst, warum er sowohl von den Kelten als auch von den Germanen und sogar von den Römern als eine bedeutende Naturgottheit verehrt und gefürchtet wurde. Der Rhein war ein Gott, der manchmal böse zürnte: Der Fluss war bekannt dafür, dass er immenses Hochwasser führen konnte, das alles an seinen Ufern hinwegriss.
Soeben legte eines der kiellosen treverischen Flussboote ab. Die flachen Boote der Treverer waren mit einem großen seitlichen Ruderblatt und einem trapezförmigen Ledersegel ausgestattet. Die Treverer, die sich den Römern bisher noch immer nicht förmlich unterworfen hatten, befuhren mit ihren kleinen Segelschiffen von dreißig Fuß Länge die Mosel und den Rhein und trieben dort Kleinhandel. An Bord waren bewaffnete Männer und Handelsware: verschnürte Ballen, Amphoren mit Wein und Öl, selten etwas Besonderes.
Maura und Valerius blieben beim Flusstor des Legionslagers stehen und schauten dem Manöver auf dem Rhein zu. Durch den Regen war das Ledersegel nass, schwer und unbrauchbar geworden. Doch das bereitete dem Bootsführer anscheinend keine großen Probleme, denn das Trevererboot fuhr flussabwärts. Der Steuermann arbeitete mit aller Kraft. Das Gefährt drehte in die kräftige Strömung des Großen Flusses, der nach den zahlreichen Regenfällen der letzten Wochen braunes Hochwasser führte.
„Flussaufwärts werden die Boote manchmal von mächtigen Ochsengespannen gezogen“, sagte Valerius mit wacher Stimme, aber auch etwas belehrend. „Ich hab es schon ein paar Mal gesehen. Die Treverer sagen, dass es nicht leicht ist, den Rhein und die Mosel zu befahren. Weiter flussaufwärts wird das Tal immer enger. Dort sind unüberwindbare Stromschnellen. Und flussabwärts gibt es unzählige Sandbänke und Untiefen, der Fluss wird immer breiter, und die Ufer sind sumpfig und verschlammt.“
„Das hört sich an, als würdet Ihr davon Ahnung haben.“
„Ein Onkel von mir ist Weinhändler … bei uns in Placentia. Ich hab ihn manchmal auf seinen Handelsreisen begleitet. Wir sind meist mit dem Schiff gefahren. Es waren andere Schiffe … aber auch nicht viel größer. Zu Hause haben wir auch einen mächtigen Fluss. Er heißt Po. So breit und so gewaltig wie der Rhein ist er natürlich nicht.“
„Ihr müsst langsamer sprechen, Herr“, lächelte Maura. Sie verdrängte den Missbrauch durch den Kommandanten aus ihren Gedanken. Wenn sie diese Vorstellung nicht immer wieder einfach beiseitegeschoben hätte, hätte sie nicht weiterleben können. „Ich verstehe Eure Sprache zwar ganz gut, aber nicht, wenn Ihr so schnell sprecht. Euer Herz läuft ja über, wenn Ihr von Eurer Heimat redet!“
„Ja, meine Heimat … Ich liebe meine Heimat. Jeder Römer liebt seine Heimat.“
„Ich weiß, dass jeder Römer seine Heimat liebt. Doch wieso zerstören die Römer dann die Heimat anderer Völker?“
Auf diese Frage wusste der vom Po stammende Militärtribun keine Antwort. Maura seufzte, zuckte mit den Schultern und ging weiter. Der Militärtribun folgte ihr. Unterhalb des Legionslagers begann eine Sandbank. Dorthin strebte sie. Das Ufer war mit unzähligen grauen und weißen Kieselsteinen übersät, die der Große Strom angespült hatte. Valerius konnte Maura leicht folgen, denn sie musste wegen ihrer Fußschellen sehr langsam und vorsichtig gehen. Sie wollte offenbar außer Sichtweite des Haupttores und der zahlreichen Soldaten sein, die dort zu tun hatten.
„Als ich noch ein junges Mädchen war, hat mir meine Amme Muriel unzählige Geschichten über den Großen Fluss erzählt“, sagte Maura, während sie so anmutig wie möglich über die Kieselsteine balancierte. „Geschichten über böse Wesen, die im Fluss hausen und über Zauberschätze am Grund des Flusses. Tausend Geister und Dämonen sind in diesem Fluss. So sagen es jedenfalls die Stimmen unserer Ahnen.“ Sie schaute fragend, als sie Valerius’ erstauntes Gesicht sah. „Ihr wundert Euch, dass ich eine Amme hatte?“
„Bei uns in Placentia hatten nur hochgestellte Frauen eine Amme. Ich weiß das deswegen so genau, weil meine Großmutter Amme bei einer reichen etruskischen Adeligen war und uns Kindern immer von dem Luxus im Haus ihrer Milchkinder erzählt hat.“
„Ja, wirklich?“ Maura verstand nicht alles, was Valerius ihr erzählte. Aber sie mochte den Klang seiner Stimme. Sie gingen weiter flussabwärts, und weder sie noch ihr Begleiter merkten, dass die Soldaten am Hafentor des Legionslagers hinter ihnen her lachten, obszöne Gesten und respektlose Bemerkungen machten.
„Wie war das bei euch? Hatte bei euch jeder eine Amme?“
„Nein, es war wie bei Euch in … Wie habt Ihr gesagt?“
„Placentia, Maura. Placentia heißt meine Heimatstadt.“
„Es war bei uns wie bei Euch in Placentia. Adelige Frauen hatten Ammen.“
„Dann bist du eine Adelige“, stellte Valerius verwundert fest. Sie kamen jetzt an eine mit Gebüsch und Pappeln bewachsene Uferstelle. Dort bildete der Fluss eine kleine Bucht, wo sie von den Soldaten nicht mehr gesehen werden konnten.
„Es ist ganz egal, was ich einmal gewesen bin“, erwiderte Maura. Plötzlich lag eine Härte in ihrem Tonfall, die Valerius erschreckte. Die Trevererin schaute ihn durchdringend an. „Jetzt bin ich jedenfalls eine Sklavin. Ich bin die Hure eines Römers. Wisst Ihr, was Adel bei uns bedeutet?“
Valerius zuckte mit den Schultern. Er fühlte sich unbehaglich und schuldig.
„Es bedeutet Ehre. Doch ich habe meine Ehre verloren.“
„Nein, das hast du nicht“, erwiderte der junge Römer mit Nachdruck. „Du hast mehr Ehre in dir als die meisten anderen Menschen, die ich hier in Gallien kennengelernt habe.“
„Zu viel des Lobes“, sagte Maura bitter. Dann begann sie, ihr Kleid abzustreifen. Sie schaute Valerius dabei genau in die Augen. „Ihr wisst doch, warum Euer Kommandant Euch hinter mir hergeschickt hat?“
„Um auf dich aufzupassen“, sagte Valerius mit belegter Stimme, während Maura ihre vom Regen durchnässte Tunika von den Schultern streifte. Darunter war sie splitternackt. Dem jungen Römer stockte der Atem.
„Er will angeben. Euer Kommandant ist ein Aufschneider. Er will, dass Ihr meinen nackten Körper seht und dass Ihr neidisch seid, weil er diesen Körper besitzen kann, wann immer er will.“
Maura ging zum Rhein hinab.
„Also, seht her! Macht, was Euer Kommandant von Euch will! Schaut mich an!”
Die Keltin zeigte ihre nackte Schönheit. Der Körper der jungen Sklavin erschien Valerius wie eine lebendig gewordene Statue der Venus Aphrodisia. Der in seiner Heimat verehrten Schönheits- und Fruchtbarkeitsgöttin. „Kommt! Erinnert Euch an den Befehl Eures Kommandanten. Ihr sollt auf mich aufpassen und in meiner Nähe bleiben. Ich könnte trotz meiner Ketten versuchen, davonzuschwimmen.“
Maura begann sich zu waschen, bückte sich langsam, schöpfte Wasser. Wie weiß ihre Haut war und wie rot das Haar! In seinen wildesten Träumen hatte er sich Maura nicht so schön vorgestellt. Valerius war unfähig, den Blick von ihr zu wenden. Sie schämte sich offenbar nicht im Mindesten vor ihm - ganz im Gegenteil.
Der Fluss musste eisig kalt sein. Sie ging so weit in das Wasser der kleinen verborgenen Bucht hinein, dass sie bis zu ihrem Schoß in den Fluten stand. Sie war nach römischer Sitte zwischen den Schenkeln glattrasiert, so dass Valerius ihre Scham sehen konnte. Ihre Brustwarzen waren wegen der Kälte und des Regens steil aufgerichtet, der ganze Körper schien von einer Gänsehaut überzogen zu sein. Valerius hatte Mühe, seine Erregung zu kontrollieren. Er spürte, dass Maura Recht hatte. Der Kommandant wollte ihn in Versuchung führen. Sicher hatte der Alte sein Interesse für die Trevererin bemerkt. Er machte sich lustig über ihn. Er führte ihn vor. Die Soldaten lachten doch schon über ihn! Langsam stieg Hass in ihm auf. Hass für alles, was Titurius Maura antat. Ein tiefer und wilder Hass, wie er ihn zuvor nicht gekannt hatte. Ein Hass, der mit diesem seltsamen Land Gallien zu tun haben musste.
Valerius spürte, dass sich irgendetwas in ihm verändert hatte. Ohne nachzudenken folgte er der Trevererin in den Rhein, umarmte ihren nassen Körper, seine Hände wollten überall gleichzeitig sein, seine Lippen bedeckten ihr Gesicht, ihre Schultern, ihre Brüste.
Maura schloss die Augen und ließ Valerius ein paar Momente gewähren, ehe sie ihn von sich stieß. „Weg! Du bringst uns beide in Lebensgefahr! Wenn Titurius das sieht, bringt er mich um, und dich schickt er in ein Todeskommando!“