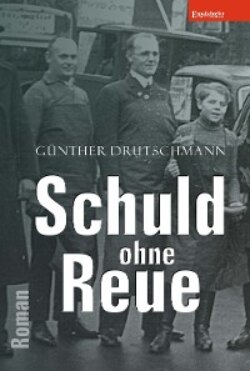Читать книгу Schuld ohne Reue - Günther Drutschmann - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Jahr 1913
Оглавление1.
Die Küche war blitzeblank. Kindergeschrei drang aus irgendeinem Zimmer der Wohnung.
Anna stürmte in die Küche und murmelte:
»Es kocht, oh je, oh je.« Dann lüftete sie den Deckel.
Michael blätterte seine Zeitung um und hieb sie mit der Hand glatt. Ein Geräusch, das stets anzeigt, wie sehr der Mensch doch Herr seiner Zeitung ist.
Die Schranktüre des Küchenschranks knarrte, als sie geöffnet und wieder geschlossen wurde.
Teller klapperten und fanden erst Ruhe, als sie ihren Platz auf dem Tisch fanden. Besteck schepperte. Michael legte seine Zeitung zusammen und schaute auf die Uhr. Dann sah er Anna an.
«Na, wie ist es? Es dauert heute ziemlich lange, bis wir zu Abend essen können.«
Anna stach mit einem Messer in die Kartoffeln und meinte lakonisch.
»Du bist heute zu früh vom Dienst erschienen.«
Michael schlug seine Zeitung wieder auf und meinte nur. »Hm, hm.«
Er hatte einen ausgeprägten Ordnungssinn. Die Mahlzeiten mussten pünktlich erfolgen, er hasste Nachlässigkeiten. Das war gegen die heilige Ordnung.
Die Kinder stürmten in die Küche, der fünfjährige Peter als ältester der Kinderschar voran, ihm folgend die vierjährige Wilhelmine, genannt Minchen und der dreijährige Wolfgang, genannt Wolfi. Im Schlafzimmer der Eltern schlief der Jüngste der Schar, der gerade geborene Franz.
Anna setzte die Kinder auf ihre Stühle und ermahnte sie, brav zu sein. Michael schaute stirnrunzelnd auf die Unruhe neben sich und die Kinder verstummten langsam. Nur Minchen hampelte noch etwas herum. Michael war stolz auf seine gut geratenen Kinder, sowie er stolz auf seine Familie war.
»Minchen, hampele nicht so herum und sitz stille«, ermahnte er sie stirnrunzelnd.
Minchen schien das nicht zu stören und turnte weiter auf ihrem Stuhl herum. Michael stand wortlos auf, ging zu ihr hin und verabreichte ihr zwei kräftige Ohrfeigen, das es nur so klatschte. Sie begann zu heulen und die anderen beiden schauten erschreckt und stumm auf ihre Teller.
»Ich sage euch das nur einmal«, meinte Michael. »Danach bekommt ihr, was ihr verdient.«
Die Buben hatten das schon frühzeitig verstanden nur Minchen tanzte immer wieder aus der Reihe. Sie war mit ihren vier Jahren ein aufgewecktes Mädchen, das eine sehr gute Auffassungsgabe besaß, allerdings auch ein recht ungezügeltes Temperament. Das hatte sie von Michael geerbt, der schnell aufbrausen, sich aber auch wieder genauso schnell beruhigen konnte.
Minchen hatte sich von dem Schreck erholt und trocknete ihre Tränen. Sie sah den Vater böse an.
»Du bist böse«, meinte sie trotzig.
Die Buben erstarrten, Michael ebenso. Anna erwiderte schnell.
»Minchen lass das, sei still und halte den Mund.«
Michael stand schweigend auf, ging zu Minchen und zerrte sie von ihrem Stuhle. Er schleifte sie auf seinen Platz, legte sie über sein Knie und begann, auf sie einzuschlagen. Anna stand stumm daneben, es hatte jetzt keinen Sinn, dazwischen zu fahren. Sie missbilligte auch Minchens Verhalten auf das Entschiedenste, aber mit dieser Prügelei war sie nicht einverstanden.
Michael schlug hart zu und Minchen heulte ab und zu auf, dann weinte sie ziemlich heftig. Blut floss aus ihrer Nase.
Anna sah das und sagte jetzt resolut zu Michael. »Nun ist es genug, sie blutet aus der Nase, willst du sie umbringen?«
»Sie muss lernen, gehorsam zu sein, alle Kinder müssen das.«
Er versetzte ihr noch einige Hiebe und ließ von ihr ab. Anna nahm sie bei der Hand und führte sie ins Kinderzimmer. Sie wischte ihr das Blut ab, zog ihr das Nachthemd an und legte sie in ihr Bett. Sie weinte leise und sah trotzig auf die andere Seite des Raumes, als Anna ihr einen Gute-Nacht-Kuss geben wollte.
Was soll man mit diesem Kind anfangen, dachte Anna, sie ist ein Trotzkopf und hat den harten Schädel ihres Vaters. Wolfi ist zwar ein kleiner Schreihals, aber wie Peter gut zu lenken. Peter ist der ruhigste und ausgeglichenste der kleinen Schar. Ob sie das im naheliegenden Kindergarten bei den Schwestern im Böhmerklösterchen lernt. Mit Sicherheit nicht, die Schwestern sind lieb und achten auf Disziplin.
Anna war keine zärtliche Mutter und achtete wie Michael bei der Erziehung auf Gehorsam und Disziplin. Wer nicht gehorchte, konnte schon einmal auch von ihr eins hinter die Löffel bekommen. Aber die harte Prügelei von Michael gefiel ihr nicht. Anna hatte noch zwei Schwestern und zuhause war es auch streng zugegangen, aber geschlagen hatte der Vater sehr selten. Michael schlug bei der kleinsten Gelegenheit zu, sehr wahrscheinlich war es bei ihnen zuhause in dem kleinen Nest auch so zugegangen.
Die Bauern haben kein Feingefühl, sinnierte sie. Die schlagen direkt mit der Mistgabel zu.
Anna mochte das bäuerliche Leben nicht, sie fühlte sich als Städterin und war sehr stolz darauf. Ihr Vater war königlicher Postillion[4] gewesen, stolz und sehr selbstbewusst. Die Mutter stand vor der Heirat in Dienst als Hausmädchen bei einer gräflichen Familie. In ihrem Elternhaus wurde sehr auf Formen geachtet, man sprach hochdeutsch und das verlangte Anna auch von ihren Kindern. In diesem Punkt sah sie sich einig mit Michael, der ebenfalls ein einwandfreies Hochdeutsch sprach.
Michael war ein guter Kerl, aber in punkto Kindererziehung unerbittlich. Dieses Thema sorgte für die ersten größeren Spannungen in der jungen Familie. Er verlange von seiner Frau und den Kindern absoluten Gehorsam. Die Kinder konnte er durchprügeln, Anna jedoch nicht. Sie war resolut, selbstbewusst und wusste sich ausgezeichnet zu wehren. Sie versuchte, ihren Michael auf etwas sanftere Bahnen zu lenken. Mit recht magerem Erfolg.
Er war von Hause aus zu patriarchalisch eingestellt, das konnte man aus dem Bauernschädel nicht mehr herausbekommen, so verstädtert er auch sonst inzwischen war.
Sie überließ Mine ihrem Schmerz und Trotz und ging in die Küche zurück. Dort herrschte eisiges Schweigen. Die Buben senkten die Köpfe und aßen schweigend. Auch Michael sagte kein Wort.
Anna nahm die beiden Kinder an der Hand und führte sie ins Kinderzimmer. Sie ermahnte sie, nur recht brav zu sein und keinen weiteren Lärm mehr zu machen. Die Buben wuschen sich, zogen mit Annas Hilfe ihr Nachtzeug an und verschwanden ohne Murren ins Bett. Minchen war inzwischen eingeschlafen, ihre geschlagenen Wangen glühten.
Anna schaute noch einmal nach dem kleinen Franz und kehrte in die Küche zurück.
Michael hatte es sich auf dem kleinen Küchensofa bequem gemacht und rauchte eine Zigarre. Er sah in die Zeitung, las aber nicht. Er wusste, dass Anna mit dem Geschehenen nicht einverstanden war.
Diese begann abzuwaschen. Er hörte das Geräusch von klappernder, im Wasser versinkender, blubbernder Tellern und Schüsseln.
»Nun Anna«, sagte er plötzlich, »was war heute Abend wieder hier los. Keine Disziplin, mein Vater hätte solch ein Verhalten bei uns Kindern nicht geduldet. Was Minchen da sagte ist Meuterei. Wo kommen wir da hin, wenn wir solch ein Verhalten durchgehen lassen.«
»Du hast ja Recht«, sagte Anna, »aber musst du das Kind derart durchprügeln. Glaubst du, damit ihren Trotz zu brechen?«
»Mein Vater«, begann Michael wieder, wurde aber von Anna sofort unterbrochen. »Dein Vater war ein Bauer und drosch mit dem Dreschflegel auf euch Kinder. Ihr habt zu sechsen oder achten um den Tisch gesessen und aus einer Schüssel gegessen, während die Hühner unter dem Tisch herumliefen. Hier und heute ist das anders. Wir sind in der Stadt und da herrschen andere Regeln. Wir wohnen in einem gutbürgerlichen Haus. Was denken Silberseins unten von uns, wenn sie die Kinder schreien hören.«
»Die schlagen auch ihre Kinder«, entgegnete Michael trotzig.
»Das tun sie nicht«, erwiderte Anna. »Erst kürzlich sprach ich mit Frau Silberstein über das Thema. Ihr Mann schlägt die Kinder nicht und ist gegen Prügel in der Kindererziehung.«
»Das können sich bessere Leute leisten, einen gewissen Liberalismus«, sagte Michael trotzig.
»Wir sind auch keine Muschkoten oder Bauerntrottel. Du bist königlich preußischer Beamtenanwärter, steht kurz vor dem Aufstieg in eine gesicherte Beamtenkarriere. Außerdem bist du kein gefühlloser Mensch, aber ihr Männer mit eurer Ehre. Ich will nicht, das unsere Kinder zu hirnlosen Untertanen des Kaisers erzogen werden.«
»Hast du das auch von dieser Silberstein. Wir sind eine christliche Familie und ich behandele meine Kinder in der christlichen Tradition meiner Familie. Diese Juden können sich ein Außenseitertum leisten, wir nicht.«
»Was hat das Judentum mit der Erziehung zu tun?«, fragte Anna, »Sie sind gute Deutsche wie wir auch. Er ist Rechtsanwalt und Oberleutnant der Reserve. Worin unterscheidet sich seine Bürgerlichkeit von der Unseren?«
»Eben das es Juden sind, die sich immer abgegrenzt haben. Ihnen fehlen unsere christlichen Werte und daher können sie sich manches leisten, was wir nicht können. Außerdem sind sie steinreich.«
Michael zog erregt an seiner Zigarre.
»Eine Frau hat zu gehorchen und keine eigene Meinung zu haben. Dein Platz ist in der Küche, der Kirche und bei den Kindern. Diese hast du im christlichen Geist zu erziehen nach den Prinzipien, die in Preußen Gültigkeit haben und nicht in Jerusalem. Unser Staat ist aufgebaut auf Befehl und Gehorsam, wie beim Militär. Wir alle haben zu gehorchen, und der Gehorsam beginnt in der kleinsten Zelle der Gesellschaft, in der Familie. Wir haben zu gehorchen und nicht zu fragen. Und das hast du unseren Kindern beizubringen, damit sie gute Untertanen des Kaisers werden und den Platz in der Gesellschaft einnehmen, der ihnen von Gott zugewiesen ist.«
Anna hielt einen Augenblick innen, dann meinte sie.
»Ich kenne meinen Platz und habe auch nichts dagegen. Ich kümmere mich gerne um die Kinder, die Küche und gehe gerne in die Kirche. Dein Vater hat deine Mutter noch durchgeprügelt, wenn sie nicht gehorchte. Aber das, lieber Michael, ist bei uns vorbei. Deine Mutter hatte keine eigene Meinung, ich habe sie schon und ich vertrete sie auch. Da lasse ich mir von dir nicht den Mund verbieten. Und solltest du mich einmal schlagen, verlasse ich sofort mit den Kindern die Wohnung.«
Michael merkte, dass Anna nun wirklich böse war. Auch wenn er ein harter Bauernschädel war, er liebte seine Frau und wollte sie nicht verlieren. Außerdem hatte er sich nach Trotzen Art schon wieder beruhigt.
»Reg dich nicht auf«, Anna, meinte er begütigend, »natürlich werde ich dich nie schlagen. Wo denkst du hin.«
»Das will ich auch hoffen«, entgegnete sie nun etwas milder gestimmt. Michael stand auf und gab ihr einen Kuss. »Lassen wir es erst einmal dabei bewenden. Ich springe schnell zum Alex herüber und hole mir einen Krug Viez (Apfelwein) und wir machen uns einen gemütlichen Abend.«
Anna nickte.
Als Michael nach kurzer Zeit von der winzig kleinen Kneipe ihrem Haus gegenüber zurückkehrte, saß sie schon im Wohnzimmer, einem mittelgroßen Raum. Als Tempel der Bürgerlichkeit war hier alle Anstrengung in der Einrichtung konzentriert worden. Ein längliches niederes Buffet stand an einer Wand, ein Esstisch mit den entsprechenden Stühlen, ein schönbezogenes Sofa mit einem kleinen Tisch davor und zwei Sesseln mit einer Stehlampe. Das Haus war seit einiger Zeit mit elektrischem Strom ausgestattet. Eine Nähmaschine stand am Fenster, das mit sehr schönen Gardinen ausgestattet war. Am Boden ein hübscher Teppich. Alles sehr sauber und mit viel Geschmack eingerichtet. An einer Wand hing ein Bild des Kaisers in großer Uniform mit Helm, daneben ein Bild, das einen schönen Sonnenblumenstrauß darstellte. An der anderen Wandseite tickte eine schöne Wanduhr. Auf dem Wohnzimmertisch lag eine schöne Decke und in der Mitte ein schöner Blumenstrauß.
Michael stellte den kleinen Krug auf den Beitisch und schenkte sich ein Glas Viez ein. Dann setzte er sich auf das Sofa direkt unter seinem obersten Kriegsherrn und zündete sich eine Zigarre an. Genüsslich zog er daran und trank einen Schluck Viez dazu. Die Nähmaschine ratterte. Anna nähte alles für die ganze Familie, sie kleidete alle sehr gut ein. Sie nähte auch für andere Leute, Silbersteins unten zum Beispiel und alle lobten ihre ausgezeichnete Arbeit.
Sie ist eine gute Frau, dachte Michael, wenn auch etwas aufmüpfig. Aber da werde ich sie nicht mehr ändern können. Trotzdem bin ich sehr zufrieden, eine bessere hätte ich nicht bekommen können.
Er ist ein guter Mann, trotz seines Temperaments und Dickkopfs, dachte Anna, meines ist auch nicht ohne. Und schlagen würde er mich nie, das weiß ich. Da ist er anders wie sein Vater. Einen besseren Mann als ihn hätte ich nicht bekommen können. Er sorgt für die Familie und treibt sich nicht in Kneipen herum, wie das bei vielen der Fall ist. Außerdem ist er ehrgeizig, er wird es noch zu etwas bringen.
Michael nahm den Paulinus, das Bistumsblatt der Diözese und begann, darin zu lesen. Die Nähmaschine ratterte fröhlich, der Zigarrenrauch stieg an die Decke und die Atmosphäre wurde friedlich und entspannt. Ein schönes Bild zum Ausklang des Tages.
Am nächsten Morgen musste Michael früh zum Dienst. Anna wartete mit den Kindern, bis Michael fertig war und in seiner schmucken Postuniform von dannen zog. Danach machte sie die Kinder fertig und unter Führung von Peter wanderten sie in den nahegelegenen Kindergarten. Solche Aufgaben konnte man dem fünfjährigen Jungen mit ruhigem Gewissen anvertrauen. Mine hatte sich wieder beruhigt und folgte willig ihrem Bruder. Anna ermahnte sie nochmals, recht brav zu sein. »Ob es viel helfen wird?«, sagte Anna.
Anschließend kümmerte sie sich um den kleinen Franz, danach räumte sie die Wohnung auf. Es klingelte und Annas jüngere Schwester trat ein. Anna hatte noch zwei Schwestern und bei der Namensgebung wendeten die Eltern ein einfaches Prinzip an: die Älteste hieß Maria, die Mittlere unsere Anna, und die Jüngste Anna-Maria. So mussten sich die Eltern nicht viele Namen merken.
Anna-Maria war noch unverheiratet und unterstützte ihre Schwester etwas im Haushalt. Anna nahm den Korb und machte sich auf ihre Einkaufstour. Alle Geschäfte, die sie täglich aufsuchte, lagen im Viertel und nicht weit von der Wohnung entfernt. Zudem lag die Metzelstraße ganz nahe am Stadtzentrum.
Zuerst zum Bäcker Becker am Kirchenplatz, der sehr gutes Brot und Brötchen buk. Sie überquerte den Justizplatz, auf der rechten Seite lag das Verlagsgebäude der Trierischen Zeitung, ihm gegenüber das Justizgebäude. Das Schwarzbrot des Bäckers war stadtbekannt und er hütete das Rezept wie sein Augapfel. Anna schwatze etwas mit der Bäckersfrau und zog weiter. Sie hasste den Klatsch und bei all ihrer Freundlichkeit hielt sie immer auf eine gewisse Distanz.
In dem kleinen Michgeschäft Elis in der Johannisstraße kaufte sie etwas Käse, danach ging es weiter zum Metzger Werland in der Nagelstraße. Dieser machte die besten Fleisch- und Wurstwaren der ganzen Stadt. In dem kleiner Laden war immer sehr viel Betrieb, viele Menschen kauften dort ob der guten Ware ein. Anna erstand etwas Wurst für das Abendbrot.
Sie musste genau rechnen. Michaels kleines Postgehalt reichte gerade so, ihr Zuverdienst sicherte der Familie ein ausreichendes Auskommen, bei dem auch noch etwas übrig blieb fürs Sparen und einige kleine Extras. Michael aß seit einiger Zeit in der Postkantine zu Mittag, so dass sie nicht mehr zweimal am Tage warm kochen musste. Das Abendessen gestern stellte eine Ausnahme dar. Anna war sehr erfinderisch im Ersinnen einfacher, aber doch sehr schmackhafter Gerichte. Sie war eine exzellente Köchin, das hatte sie von ihrer Mutter gelernt, die darin große Meisterschaft besaß. Wer zum Sparen gezwungen ist, muss erfinderisch sein. Fleisch kam nur am Sonntag auf den Tisch, unter der Woche gab es fleischlose Gerichte, Eintöpfe, Kartoffelschnittchen mit einer schönen Bohnensuppe, Himmel und Erde mit Apfelmus, Waffeln mit einer Suppe, Mehlklösse mit Apfelmuss, Fisch mit Kartoffeln und Gemüse. Samstags den obligatorischen Eintopf.
Das Gemüse bezogen sie saisonweise aus Michaels kleinem Garten, den er seit einiger Zeit gepachtet hatte. Es war sein Hobby und er liebte es sehr. Anna ließ ihm sein Spielzeug, besser als in Kneipen herumhängen. Der Garten hatte den Nachteil, dass man entweder überhaupt nichts oder alles auf einmal bekam, je nach Jahreszeit.
Den Schluss ihrer Einkaufsrunde bildete stets der kleine Lebensmittelladen Efferts, der am Anfang der Metzelstraße in einem Eckhaus und nur einige Minuten von Annas Wohnung entfernt lag. Mit Frau Efferts schwatzte sie noch dies und das, kaufte das Notwendigsten für den Tag und kehrte gegen elf Uhr in die Wohnung zurück. Anna-Maria hatte schon mit den Vorbereitungen für das Mittagessen begonnen. Anna trug die Vorräte in die Speisekammer und nahm ihrer Schwester den Kochlöffel ab. Diese kümmerte sich jetzt um den kleinen Franz, wickelte ihn neu und schäkerte etwas mit ihm herum.
Anna-Maria war ein hübsches Mädchen, Anfang zwanzig mit einem lieben Gesicht und guter Figur. Eine gute Köchin war sie nicht, aber sehr kinderlieb und kam mit Annas Sprösslingen bestens aus. Sie war Anna eine große Hilfe, sie entlastete sie im Haushalt, so dass sie genügend Zeit für die Schneiderei besaß.
Gegen zwölf Uhr kehrten die Kinder aus dem Kindergarten nach Hause zurück. Das Essen wurde aufgetragen. Vor dem Essen jedoch betete Anna mit ihnen, sie sprachen zusammen ein Tischgebet. Anna war sehr fromm, in ihrer Jugend gehörte sie mit ihrer älteren Schwester der Marianischen Kongregation an. Früh lehrte sie die Kinder das Beten. Morgens und abends betete sie mit ihnen. Sie ging regelmäßig mit Michael zur Sonntagsmesse, mitunter in der Woche alleine in die Abendmesse oder eine Andacht. Im Mai gestaltete sie im Wohnzimmer ein schönes Altärchen, auf das sie auch eine Statue des heiligen Antonius von Padua stellte, den sie sehr verehrte. Diese Statue war schon sehr lange in ihrer Familie und galt als sehr wertvoll. Wenn sie ein frisches Brot anschnitt, machte die zuerst ein Kreuzzeichen mit dem Messer. Es sollte ein Zeichen sein und Gott bitten, immer für das tägliche Brot zu sorgen.
»Schwatzt nicht herum«, ermahnte sie die Kinder, »bei Tisch wird nicht so viel geredet. Minchen sitzt gerade, Wolfi kaspere nicht herum.«
Die Kinder gehorchten ihr aufs Wort. Sie erzog sie im Geiste des Gehorsams gegen die Eltern, aber nicht mit rohen Mitteln wie Michael. »Ich komme aus einer zivilisierten Familie und um ein Kind zur Disziplin zu erziehen, muss ich es nicht durchprügeln.«
Nach dem Essen brachte Anna-Maria die Kinder ins Kinderzimmer zu einem kleinen Mittagsschläfchen. Der kleine Franz war bereits versorgt. Die Kleinen ließen sich gerne von ihr hinlegen und hörten begeistert zu, wenn sie ihnen ein kleines Lied vorsang. Anna-Maria besaß eine schöne Stimme. Schnell schliefen die Kleinen ein.
Zwischenzeitlich hatte Anna in der Küche mit dem Abwasch begonnen. Heißes Wasser wurde auf dem großen Kohlenherd in einem großen Topf warmgemacht. Die Wohnung besaß kein Badezimmer, Samstag holte Anna eine große Wanne hervor und badete alle Kinder in der Küche. Danach wusch sich Michael und am Ende sie selbst. Die Wohnung besaß zwar kein Badezimmer, aber eine Toilette. Das war schon ein großer Fortschritt. In vielen Häusern gab es das noch nicht, sondern Gemeinschaftstoiletten für mehrere Mietparteien entweder auf dem Hof oder in einem Zwischengeschoss.
Anna-Maria kehrte aus dem Kinderzimmer zurück und half nun Anna. Sie kehrte die Küche, während Anna das Geschirr wegräumte. Zusammen tranken sie danach eine Tasse Kaffee.
»Ich muss später noch zu Silbersteins runter«, meinte Anna, »kannst du noch solange bleiben?«
»Klar«, erwiderte Anna-Maria, »Mutter braucht mich erst später.«
Nach einer Stunde begann es sich im Kinderzimmer zu regen. Wolfi der kleine Schreihals protestierte lautstark wegen irgendetwas. Als Anna ins Zimmer eintrat, warf er sich gerade schreiend zu Boden. Anna hob ihn auf und gab ihm einen Klapps zwischen die Ohren.
»Hör auf du Schreihals, es wird Zeit für den Kindergarten.«
Sie machte die Kinder fertig und kurze Zeit später zogen sie wieder los. Anna-Maria begann, einige Kindersachen zu flicken. Sie war wie ihre Schwester eine gute Näherin.
Anna packte einige Kleidungsstücke und schickte sich an, nach unten zu gehen. Ein klein wenig beklommen war ihr schon zumute wegen des Lärms von gestern Abend. Über ihnen wohnten ein älteres Ehepaar, die beide schwerhörig waren, aber Silbersteins sicher nicht. Gerade ihnen gegenüber wollte sie sich keine Blöße geben. Anna war nicht der Mensch, der vor unangenehmen Dingen zurückschreckte. Sie gab sich einen Ruck, nickte ihrer Schwester zu und verschwand.
Anna klingelte an der Wohnungstüre und wurde von dem Hausmädchen in den Salon geführt. Rachel saß dort und schäkerte mit ihrem jüngsten Kind herum. Im Gegensatz zu Anna war sie eine zärtliche Mutter. Als Anna eintrat, gab sie dem kleinen Jungen einen Kuss und übergab ihn der Obhut des Mädchens, das mit ihm den Raum verließ. Dann gab sie Anna die Hand.
Diese legte die Sachen auf einen Stuhl und meinte. »Ich hoffe, wir haben Sie gestern Abend nicht allzu sehr gestört. Es ging hoch her bei uns, da Michael unsere Mine nach seinen Maßstäben disziplinieren wollte. Sie wissen, dass ich kein Freund davon bin.«
»Ach Frau Trotz«, lächelte Rachel, »wir haben kaum etwas gehört.«
Diese reichen Leute können sich eine gewisse Überheblichkeit nicht ablegen, dachte Anna, in dem Punkt hat Michael Recht. Aber diese Silberstein ist ansonsten eine passable Person.
Rachel bot Anna einen Stuhl an und beide begutachteten die Sachen, die Anna mitgebracht hatte. Der Salon war großbürgerlich eingerichtet, wie es sich für ein reiches Haus gehörte.
Die reiche Nachbarin war mit Annas Arbeit sehr zufrieden und gab ihr den ausgemachten Lohn und weitere Kleidungsstücke, die bearbeitet werden sollten. Anna wollte sich nicht länger aufhalten und hatte auch keine Lust zu weiteren Gesprächen. Mit einigen verbindlichen Worten verabschiedete sie sich.
Inzwischen waren die Kinder aus dem Kindergarten zurück und brachten noch einen weiteren Jungen mit. Es war Hahns Bub, der Sohn des Verlegers der Trierischen Zeitung, ein netter Junge, der mit Peter sehr befreundet war. Er wohnte nur wenige Schritte von ihnen entfernt. Peter erbat sich etwas Straßenurlaub: »Bis sechs Uhr, hörst du, nicht länger«, meinte Anna und der Junge nickte. Beide verschwanden mit einem Ball auf die Straße, um am Justizplatz damit zu spielen. Anna sah diese Freundschaft gerne, natürlich stand der Verleger der Zeitung gesellschaftlich höher als sie, aber Bubs Vater hatte nichts gegen die Freundschaft seines Sohnes mit Peter, ja er sah das sogar sehr gerne.
Zwischenzeitlich versorgte Anna-Maria die anderen Kleinen und machte sich zum Weggehen fertig. Anna bedankte sich bei ihr und sie vereinbarten das Nötigste für den nächsten Tag. Dann entschwand die Schwester.
Auf der Treppe begegnete sie Michael, der müde vom Dienst heimkehrte. Sie grüßten sich freundlich wechselten einige Worte miteinander und jeder ging seines Weges.
Michael betrat seine Wohnung, die Kinder hüpften herum. Er nahm sich Minchen vor und ging mit ihr ins Kinderzimmer.
»Wenn ich diesen Ungehorsam noch einmal von dir höre, gibt es weitere Schläge. Ein Kind hat zu gehorchen, hat Vater und Mutter zu ehren, hast du das Verstanden?«
»Nein«, entgegnete Minchen trotzig und erhielt prompt zwei Ohrfeigen.
»Treibe es nicht zu weit Wilhelmine«, warnte Michael, »ich habe heute nicht viel Geduld. Ich kann solange auf dich einprügeln, bis du es verstehst.«
Anna erschien in der Türe und sah die kritische Situation.
Michael stand vom Stuhl auf. »Ich habe nicht viel Zeit, muss mich umziehen, heute Abend ist Chorprobe. Mine, ich höre nachher ein »Entschuldige Papa« oder du wirst etwas erleben, darauf kannst du dich verlassen.«
Michael verließ den Raum und ging ins Schlafzimmer, um sich die Vereinsuniform anzuziehen. Die Zeit drängte.
Im Kinderzimmer sprach Anna auf ihre Tochter ein. »Ich habe nun genug von deinen Ungezogenheiten. Wenn du nicht folgst, kommst du ins Heim, dann wollen wir dich nicht mehr haben. Überlege dir das gut. Ich höre heute Abend die Entschuldigung, sonst ist hier was los.«
Sie verließ den Raum und überließ Mine ihrem Trotz. In der Küche bereitete sie das Abendbrot vor. Kurze Zeit später erschien Michael und setzte sich auf seinen Platz. Peter erschien von seiner Spieltour, »Abend Papa« und wusch sich die Hände. Michael grüßte freundlich zurück, Peter war sein Lieblingskind.
Anna rief die Kinder, Wolfi erschien, danach Minchen. Peter sah die kritische Situation und gab der Schwester einen freundschaftlichen Stoß. »Reize Papa nicht weiter«, raunte er an der Türe.
Mine ging zu Michael hin und sagte leise: »Entschuldigung Papa.«
»Ist gut«, erwiderte diese, »setzt dich auf deinen Platz. Peter sage das Abendgebet.«
Peter sprach ein kurzes Gebet und das Abendessen konnte seinen Lauf nehmen. Viel gesprochen wurde nicht mehr, Mines Trotz lastete noch etwas auf der Runde. Die Stimmung entspannte sich, als Michael kurze Zeit später aufstand, Anna einen Kuss gab, seine Mappe und Mütze nahm, den Kindern zunickte und verschwand. Er war zufrieden, er hatte Minchens Trotz gebrochen. Kinder brauchen eine harte Hand, nur so lernen sie Gehorsam.
Zuhause nahm der Abend den gewohnten Gang. Papa hatte die Mahlzeit vorzeitig aufgehoben. Normalerweise durfte kein Kind aufstehen, wenn die Eltern nicht die Erlaubnis dazu gaben. Die Kinder halfen Anna beim Abräumen des Tisches und gingen danach ins Kinderzimmer. Hier nahm sich Peter die Geschwister vor, vor allem Minchen.
»Wenn Papa etwas sagt, haben wir zu gehorchen, du auch Minchen, auch du Wolfi, auch wenn du ein Schreihals bist. Minchen lass die Faxen. Das reizt Papa nur und wir bekommen es alle ab. Reiß dich zusammen.«
Minchen nickte, auf Peter hörte sie. Anna kam ins Zimmer und sah sofort die Situation. Sie nickte Peter aufmunternd zu, ihrem Großen, der auch ihr Lieblingskind war.
»Fertigmachen zum Bettgehen«, ertönte es jetzt von ihr und die Kinder begannen die gewohnten Rituale.
Der Probenraum des 1903 gegründeten Post-Männerchors lag nicht weit von Michaels Wohnung entfernt, im Gebäude des Hauptpostamtes. Vor dem weitläufigen Haus traf er seinen Schwiegervater Bernhard Bläsius, den pensionierten Postillion und beide gingen nach kurzer Begrüßung in den Probenraum. Hier waren schon mehrere Sangesbrüder versammelt, man begrüßte sich und schwatzte noch etwas herum.
Der Dirigent erschien und mahnte alle, ihre Plätze einzunehmen. Jeder wusste, wohin er gehörte. Der Chor war ungefähr hundert Mann stark, davon heute ungefähr sechzig anwesend und hatte in der Region einen guten Ruf. Es dauerte eine Weile, bis alle auf ihren Stühlen saßen. Michael besaß eine gute Baritonstimme, er saß neben seinem Schwiegervater, mit dem er sich sehr gut verstand. Durch den Postmännerchor, dem er 1904 sofort nach seinem Eintritt in den Postdient beitrat, hatte er Anna kennengelernt. Michael und Bernhard verstanden sich von Anfang an gut und so ergab es sich, dass sie auch privat miteinander verkehrten.
»Meine Herren, darf ich um Ruhe bitten. Wir haben nicht viel Zeit und noch viel zu tun.«
Dirigenten in aller Welt und zu allen Zeiten sprechen so.
»Wir wollen die Stücke probieren, die wir anlässlich des Kaiserbesuches vortragen wollen. Ihr wisst, wir haben die hohe Ehre, dem Kaiser eine Probe unseres Könnens vorzustellen.«
Michael war in diesem Augenblick stolz, diesem Chor anzugehören, erstens weil er gerne sang, zum anderen, weil er dem geliebten und verehrten Kaiser sehr nahe sein würde. Welch eine große Auszeichnung .
Nach einigen Lockerungsübungen begannen sie, das Programm durchzusingen. Aber schon beim ersten Lied stockte es. Der Dirigent schüttelte missbilligend den Kopf.
»Männer, was singt ihr da? Singt ihr nach Noten oder nach was. Richtige Noten, aber nicht in der richtigen Reihenfolge. Der Kaiser wird sich alle Haare bei dem Singsang ausreißen.« Dies war natürlich stark übertrieben, aber bei allen Dirigenten der Welt so üblich.
Die Chormitglieder waren nicht überrascht, sie kannten das Repertoire ihres Chefs.
Was wurde nun geübt? Gutes deutsches Liedgut, von der Heimat, dem Walde, dem guten Mond, der so stille geht, das Ännchen von Tharau und vieles mehr. Lassen wir den Chor in Ruhe weiterüben, damit sie den hochverehrten Kaiser mit ihrer Sangeskunst erfreuen können.
Nach ungefähr zwei Stunden war die Probe beendet. Der Chor zerfiel nun in viele Einzelgruppen, die noch etwas herumstanden und redeten. Langsam löste sich die Versammlung auf. Ein Teil des Chores ging nicht nach Hause, sondern in das nahegelegene Vereinslokal »Zur Kiste«, ein gutbürgerliches Speiselokal mit einer Schwemme. Dort traf man sich nach kurzem Weg gerne zu einem Glas Bier.
»Na Michael«, fragte sein Schwiegervater, »wie geht es so auf der Post und zuhause?«
Sie saßen mit vier oder fünf Sangesbrüdern an einem Tisch, jeder ein Glas Bier vor sich, außer Michael, der lieber Viez trank. Die Zigarren qualmten.
»Auf der Post geht es gut. Ich bin seit vier Wochen nicht mehr im Außendienst. Mein Chef ist endlich damit einverstanden, dass ich als Anwärter für den einfachen Postdienst im Beamtenverhältnis vorgesehen bin. Ich mache jetzt mehrere Praktika im Innendienst, um zu sehen, wo ich am besten einzusetzen bin. Zurzeit bin ich im Telegraphenamt. Ist nicht schlecht, aber mir schwebt eine Schreibtischarbeit vor.«
»Recht hast du«, sagte sein Tischnachbar, »der Schreibtisch ist immer das Beste. Sie haben sich lange Zeit gelassen, bis sie dich weiterförderten.«
»Das bin ich auch ein bisschen Schuld. Wenn ich die Beamtenlaufbahn einschlagen will, verdiente ich am Anfang weniger als Angestellter. Die Ehre, dem Staat zu dienen, verlangt das von mir. Ich habe inzwischen eine große Familie und deshalb zögerte ich die Entscheidung auch etwas heraus. Natürlich wollte mich mein Chef auch nicht gehen lassen.«
»Als Beamter hast du aber mehr Vorteile«, mischte sich sein Schwiegervater ein, »du bis unkündbar, bekommst später eine Pension und wirst dann auch mehr verdienen. Du hast gute Chancen für den mittleren Dienst.«
»Soweit bin ich noch lange nicht«, schmunzelte Michael, »wenn alles gutgeht, werde ich zum ersten April nächsten Jahres als Postschaffner in das Beamtenverhältnis übernommen. Hoffentlich kein Aprilscherz«
Die Runde lachte, fast alle waren im Beamtenverhältnis.
»Bis zum mittleren Dienst wirst du aber noch viel büffeln müssen. Der Weg dahin ist lang und beschwerlich«, meinte ein anderer Sangesbruder.
»Michael schafft das schon«, kam ihm sein Schwiegervater zu Hilfe.
»Ich nehme etwas Unterricht bei einem alten Lehrer, der früher Annas Lehrer war. Du kennst ihn Bernhard, es ist der Lehrer Wagner. Er hilft mir vor allem in Deutsch und gibt mir den letzten Schliff, aber auch in Geschichte, Staatsbürgerkunde und Geografie.«
Die anderen nickten. Da saßen sie nun in der Schwemme der Kiste, ein rustikal eingerichteter großer Schankraum, Angehöriger der Post, stolz auf ihre Stellung, bei der Behörde zu arbeiten, im Staatsdienst, einen Zipfel der Krone des Kaisers mittragend. Der Biedersinn stand ihnen im Gesicht geschrieben. Auf der Jakobsleiter der Ämterhierarchie saßen sie auf verschiedenen Stufen und waren zufrieden mit ihrem Los. Dass sie politisch nichts zu sagen hatten, störte sie nicht. Sie sahen diese Ordnung als gottgegeben an und lebten in der Überzeugung, dass in Berlin schon das Richtige gemacht werde. Der Politik, die das Kaiserreich in den letzten Jahren steuerte, stimmten sie zu. Auf die Arbeiterschaft und die Sozialdemokratie sahen sie herablassend, diese standen außerhalb des Gesellschaftssystems. Der Glanz und das Gloria des preußischen Militärsystem, dieses absoluten Obrigkeitssystem, das keinen Widerspruch duldete, wurde von ihnen mitgetragen, kritiklos hingenommen. Sie gehorchten gerne, war dieser Gehorsam doch mit solch schönen Attributen wie Ehre und Vaterland, mit blinkenden Uniformen und schillernder Wehr, mit schönen Orden, Fahnen und Glockenklang versüßt. Jeder hatte seinen Platz und so gut es geht auszufüllen. Sie hielten diese Ordnung für unerschütterlich und sie selbst Garanten dieser Stabilität. Das diese Ordnung im Inneren brüchig war, sahen sie nicht, dass in Berlin ein gefährlicher außenpolitischer Kurs der Isolation gesteuert wurde, bemerkten sie ebenfalls nicht.
Alle Reformversuche der letzten Jahre wurden von einer ultrakonservativen Adelskaste verhindert. Reichskanzler von Bethmann-Holweg hatte ernsthaft versucht, liberalere Töne in die Gesellschaft zu bringen, so zum Beispiel die Abschaffung des Drei-Klassenwahlrechts in Preußen. Alles vergebens, die ultrakonservativen Kräfte wussten jeden noch so kleinen Absatz zu verhindern.
Es gibt ein schönes Bild aus jenen Tagen. Es zeigt den Kaiser mit seinen Söhnen auf dem Weg zum Kirchgang. Es liegt so viel Aufgeblasenheit und Arroganz in diesem Bild, schaut, uns gehört Deutschland, wir haben hier das Sagen und können machen was wir wollen. Unsere Postler an den Tischen an jenem Abend trugen dieses System mit und gaben ihm Halt und Stabilität. Um welchen Preis, das sollte sich noch zeigen.
Worüber sprechen Männer am Stammtisch. Natürlich über Politik und nachdem Michaels Postkarriere abgehandelt war, widmete sie sich diesem Thema.
»Hast du das in der Zeitung über Zabern gelesen«, fügte Michaels Tischnachbar Karl an. »Merkwürdige Geschichte, ein junger Leutnant macht jagt auf die Elsässer und das Militär deckt das.«
»Bei uns steht das Militär über allem«, erwiderte Michael, »da gibt es nichts zu deuteln. Wo kommen wir dahin, wenn wir uns von den Wackesen beleidigen lassen.«
Die anderen nickten.
»Das Ganze wird von der Linkspresse aufgebauscht, so wie damals die Geschichte dieses ulkigen Hauptmannes von Köpenick«, warf Bernhard in die Runde. »Elsass-Lothringen ist Reichsland und die Wackesen haben sich unseren Gebräuchen zu fügen.«
»Jetzt wollen sie auch noch dem Reichskanzler ans Zeug«, meinte Sangesbruder Paul.« Das sind alles diese Sozis. Was heißt hier das zivile Rechte verletzt wurden. Dieser Schuster beleidigte das Militär und da mussten die draufschlagen. Soll ja auch der Kronprinz in einem Telegramm gesagt haben.«
»Dafür bekommen aber jetzt einige Postler Schwierigkeiten, die das an die Presse weitergegeben haben. Ein unerhörter Vorgang, wo bleibt das Amtsgeheimnis«, ereiferte sich Karl.
»Ich sagte doch, es ist eine Hetzkampagne der Linkspresse«, meinte Bernhard.
»Der Reichskanzler ist mir sowieso viel zu weich, zu liberal«, sagte Michael und zog an seiner Zigarre, »will Reformen und das Ständerecht in Preußen ändern. Was soll das. Jeder auf seinem Platz, das ist meine Meinung. Und ansonsten, jeder der gedient hat weiß, dass ein Befehl vor Gewehr absoluten Vorrang hat. Wenn dieser Wackes den Leutnant auslachte, beleidigte er unseren Kaiser und da war es nur richtig, dass er eines aufs Maul bekam. Wer sich jetzt aufregt sind die Hungerleider und vaterlandslosen Gesellen.«
Die Runde nickte zustimmend. Der Wirt brachte frisches Bier und Viez.
Michael ergriff wieder das Wort.
»Was heißt hier, wir haben nichts zu sagen. Was soll das. Schaut euch Frankreich an, eine sogenannte Republik. Haben da die kleinen Leute mehr zu sagen? Dort wird auch alles von oben entscheiden. Und was für Entscheidungen, denkt mal an die Gesetze der Trennung von Kirche und Staat oder die Dreyfuss-Affäre[5]. Hier wurde vom Militär, also von den eigenen Leuten, ein Hauptmann verleumdet. Dieses Unrecht wurde bis in die höchsten Kreise gedeckt. Das ist für mich Anarchie.«
»Der Mann war zudem Jude«, warf ein Sangesbruder ein.
»Jude oder nicht«, konterte Michael, »das ist nicht das Hauptproblem. Sondern die offensichtliche Deckung eines Justizskandals. Bei uns in Preußen gibt es gar kein Unrecht, hier geht alles seinen ordentlichen Gang. Und diese Wackesen haben unseren Leutnant beleidigt und bekamen eines aufs Maul.«
»Aber auch in großbürgerlichen Kreisen regt sich Widerstand«, bemerkte Bernhard.
»Diese Geldsäcke glauben, mitreden zu müssen, nur weil sie so viel Geld haben. Bei uns regiert die durch Tradition und Stand gewachsene Obrigkeit, es zählt nicht der Reichtum, sondern die gesellschaftliche Stellung. Und das ist gut so, nur weil einer Geld hat, hat er noch lange keinen Anspruch auf politische Macht«, erhitzte sich Michael.
»Rege dich nicht auf Michel«, nahm Friedrich das Wort. »du hast ja Recht. Das sind Wichtigtuer, die glauben, jetzt draufschlagen zu können und dem Kaiser und der Regierung zu schaden. Das sind diese Zeitungsfritzen, die immer Stimmung machen wollen.«
Sangesbruder Friedrich war ein schweigsamer Mensch und da er jetzt sprach, hörten ihm alle mit großer Aufmerksamkeit zu. Zudem hatte er eine höhere Stellung, war Oberpostsekretär und das zählte etwas in der Runde.
»Richtig Friedrich«, pflichtete Michael ihm bei. »Ich lasse auf unseren Kaiser nichts kommen. Er ist mein Vorbild und was er sagt, ist für mich Gesetzt. Für uns alle, die dem Staat dienen. Wir alle haben gedient und beim Militär Disziplin und Gehorsam gelernt. Das hat Preußen großgemacht. Und wenn es mal losgeht, werden wir es ihnen allen zeigen, vor allem wegen unserer Disziplin. So erziehe ich auch meine Kinder. In der Kinderstube muss die gleiche Ordnung herrschen wie auf dem Kasernenhof.«
»Das es in Preußen kein Unrecht gibt, ich weiß nicht, gerade du Michael müsstest das doch wissen, als Mitglied der Marianischen Bürgersolidarität[6]. Diese Schikanen der protestantischen Obrigkeit gegen uns katholische Rheinländer. Denk mal an die Fronleichnamsprozessionen, die immer wieder von der Stadtverwaltung schikaniert werden«, nahm Karl das Wort.
»Das sind alte Kulturkampfgeschichten, heute ist das anders. Ich kann Glaube und Staat sehr gut miteinander vereinbaren. Ich gehorche Gott und der gottgegebenen Obrigkeit, und Kaiser wie Papst repräsentieren diese für mich. Aber ich sage es noch einmal, auf den Kaiser lasse ich nichts kommen«, entgegnete Michael.
»Leute, trinken wir aus, es ist schon spät«, mahnte Bernhard.
»Diese Pensionäre«, lachte Karl, »haben die meiste Zeit und mahnen zur Eile.«
»Ein Pensionär lieber Karl, hat niemals Zeit«, schmunzelte Bernhard.
»Aber du hast Recht«, meinte Karl,« es wird Zeit, morgen ist wieder früh Tag.«
Wir wollen uns nun einem Ereignis zuwenden, dass die Trierer 1913 beschäftigte. Die Stadt entschloss sich zum Bau einer zweiten Moselbrücke, die Ende Oktober fertiggestellt wurde. Die Stadtverordneten einigten sich auf den Namen »Kaiser-Wilhelm-Brücke«. Nicht zuletzt sah man darin eine Möglichkeit, den Kaiser zu einem offiziellen Besuch nach Trier zu locken.
Und tatsächlich: Am vierzehnten Oktober 1913 gab sich Wilhelm II. die Ehre und weihte die nach ihm benannte Brücke ein. Es war ein außerordentlicher Tag für die ganze Stadt. "Die Simeonstraße und der Hauptmarkt waren eine einzige via triumphales", notierte ein euphorisch gestimmter Zeitzeuge. "Die Häuser im Girlandenschmuck, mit Teppichen, Wappen, Kränzen, Blumen reich geschmückt, mit Fahnen und Wimpeln geziert, vollendeten ein Bild, wie es schöner und erhebender wohl selten dem kaiserlichen Herrn geboten wird."
Als der Zug Wilhelms um halbzehn Uhr eintraf, läuteten in der ganzen Stadt die Kirchenglocken. Nachdem er das Band durchschnitten hatte, schritt der Kaiser zusammen mit Oberbürgermeister Albert von Bruchhausen und umrahmt von einem Spalier zylinderschwenkender Honoratioren bis hinüber nach Pallien und wieder zurück.
Wilhelm nutzte die Gelegenheit, um die antiken Bauwerke Triers zu besichtigen. Im Amphitheater wohnte er von einer extra errichteten Loge aus einer turnerischen Darbietung von Trierer Schülern bei. Diniert werden sollte im Palais Walderdorff, der damaligen Dienstwohnung des Regierungspräsidenten. Und hier wollte unser Postmännerchor eine Probe seines Könnens abliefern.
Michael war an diesem Morgen sehr aufgeregt. Die Mitglieder des Chores waren für diesen Tag vom Dienst freigestellt. Er stand früh auf und machte Anna ganz nervös mit seiner Ungeduld. Michael konnte es kaum erwarten, so nahe an seinem geliebten und hochverehrten Kaiser zu sein. Anna wollte mit den Kindern in der Stadt den Kaiser sehen und machte diese nun ausgangsfein. Das ging nicht ganz ohne Probleme ab, Wolfi wollte die Sachen nicht anziehen, die sie ihm herausgelegt hatte. Erst nach einigem Klappen auf den Po zog der den Kieler Matrosenanzug an, den auch sein älterer Bruder Peter ohne Widerrede trug.
Gegen halb zehn Uhr verließen sie alle das Haus, unten auf der Straße trafen sie Silbersteins, die auch zur Stadt eilten. Man grüßte sich kurz und ging danach getrennte Wege.
Am Hauptmarkt trennten sie sich, Michael eilte ins Palais Walderdorff, dort fand um zehn Uhr eine Generalprobe statt, Anna und die Kinder wurde von einer Menschenmenge in Richtung Simeonstraße gedrängt. Dort warteten sie ungeduldig auf den Kaiser. Alles was Beine hatte, war hier zu sehen. Viel Militär, denn Trier war eine große Garnisonsstadt, Polizei und Bürger, die im Festgewand auf den hohen Herrn warteten.
Endlich nach langem Warten erschien dieser umrahmt von militärischen Adjutanten, dem Bürgermeister und allen Stadtverordneten. Sie gingen auf der ganzen Breite der Straße, die Bürger jubelten und schrien Hochrufe und der Kaiser dankte in großer Uniform huldvoll lächelnd seinen Untertanen.
Anna und die Kinder standen nahe der Porta Nigra und auch hier waren viele Menschen. Viel sahen sie vom Kaiser nicht. Peter und Minchen drängten sich ganz nach vorne in die Reihe und sahen noch am meisten, Anna stand mit dem Kinderwagen in der hintersten Reihe, ängstlich darauf bedacht, die beiden nicht aus den Augen zu verlieren. Plötzlich stand Anna-Maria neben ihr und das erleichterte sie sehr. Sie bat diese, sich zu den beiden vorzukämpfen und auf sie acht zu geben. Anna-Maria erreichte das Kunststück und sah so auch den Kaiser aus nächster Nähe.
Jaakov Silbersein stand mit seiner Familie am Eingang des Hauptmarktes, eingekeilt in eine große Menschenmenge. Die kleinste Tochter trug er auf seiner Schulter, damit sie etwas sehen konnte. Eigentlich hatte er keine große Lust, bei diesem Spektakel dabei zu sein, aber Rachel wünschte es sich so sehr und da wollte er kein Spielverderber sein. Jaakov war nicht so begeistert von seinem obersten Kriegsherrn, er sah ihn nüchterner. Die Politik der letzten Jahre sah er mit Sorge und hoffte, dass es nicht eines Tages zu etwas Schlimmen kommen könnte. Als Oberleutnant der Reserve, er trug die Uniform heute, stand er auf der anderen Seite natürlich loyal zu seinem Kaiser. Er hoffte sehr, dass dieser auch weiterhin der Friedenskaiser sein würde. Die Zaberner Affäre gefiel ihm als liberaler Kopf nicht sonderlich und er hätte vom Kaiser und dem Kronprinzen etwas mehr Fingerspitzengefühl erwartet. Als Offizier stand er auf der Seite des Militärs, als Liberaler aber sah er die Gefahren, die entstanden, wenn das Primat der Politik unter die Aufsicht des Militärs gestellt wurde. Und gerade das war in Zabern geschehen. Er ging aber nicht so weit, das System als solches in Frage zu stellen.
Im Palais Walderdorff liefen die Vorbereitungen auf vollen Touren. Der Saal war festlich geschmückt mit Fahnen, kleinen Tannenbäumchen und Drapieren, die lange Tafel mit erlesenem Porzellan und Blumenschmuck geziert. Der Chor nahm seinen vorgesehenen Platz ein, neben ihm ein Kammerorchester, beide sollten abwechseln die Tafelmusik darbieten. Allen stand die Aufregung im Gesicht geschrieben. Die Ordonanzen, Kellner und sonstige dienstbaren Geister hantierten nach einem streng festgelegten Plan, der städtische und der kaiserlichen Zeremonienmeister überwachte dies akribisch. Michael stand als einer der größten in der letzten Reihe des Chores.
Der Kaiser und sein Gefolge betraten den Raum und nahmen die ihnen vorgesehen Plätze ein. Neben dem Kaiser der Oberbürgermeister von Bruchhausen, daneben der Landrat und der Regierungspräsident und weitere Offizielle.
Nachdem sich das Stühle rücken und Plätze finden gelegt hatte, servierten die Ordonanzen die Suppe und präsentierten den Wein. Anschließend erhob sich der Oberbürgermeister und hielt eine kleine Rede, an deren Schluss er den Kaiser hochleben ließ und alle mit einstimmten. Der Postchor stimmte »Heil dir im Siegerkranz an«, und alle außer dem Kaiser sangen stehend mit. Danach erwiderte dieser mit einer kleinen Stehgreifrede.
Das Dinner nahm nun seinen gewohnten Lauf. Die Speisefolgen liefen nach einem festgesetzten Plan ab. Chor und Orchester brachten abwechselnd ihre Darbietung vor. Es waren Lieder von patriotischem und volkstümlichem Einschlag, das Orchester spielte klassische Stücke von Mozart, Haydn und einige Melodien von Franz Lehar und Johann Strauß
Nach ungefähr eineinhalb Stunden hob der Kaiser die Tafel auf, in dem er sich bei den Gastgebern bedankte. Danach schritt er unprogrammgemäß auf unsere Musiker zu. Er begrüßte die beiden Dirigenten und lobte das Dargebrachte, dabei schaute er in die Gesichter der einzelne Sänger und Musiker. Die stattliche Figur und die leuchtenden Augen unseres Michaels waren ihm während des Banketts aufgefallen. Nicht umsonst munkelte man im Reich über Wilhelms homosexuellen Neigungen. Er bat eine Ordonanz, den jungen Mann zu ihm herunter zu geleiten. Michael wurde ganz blass nach der Aufforderung des Ordonanzoffiziers, ihm zum Kaiser zu folgen. Dieser gab unserem Michael ganz leutselig die Hand.
»Sie sind mir aufgefallen ob Ihres Eifers und begeisterten Gesichtsausdrucks«, begann der Kaiser. »Wie kommt das?«
»Ich verehrte Eure Majestät sehr, Sie sind mein großes Vorbild und es ist für mich eine unvorstellbare Ehre, vor Ihnen singen und dann auch noch stehen zu dürfen.«
»Das freut mich. Haben Sie gedient und welche Stellung nehmen Sie jetzt ein«, fragte der Kaiser geschmeichelt.
»Gefreiter der Reserve im Infanterie Regiment Graf Werder und Anwärter auf den unteren Postbeamtendienst«, erwiderte Michael aufgeregt aber in strammer Haltung.
»Sehr schön, mit Ihrer eifrigen und patriotischen Einstellung werden Sie es noch weit bringen. Es freut mich immer wieder, wenn ich strebsame junge Menschen sehe. Machen Sie weiter so«, gab ihm noch einmal freundlich die Hand und schritt weiter.
In diesem Augenblick war unser Michael der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Der Kaiser hatte mit ihm gesprochen, er konnte sein Glück kaum fassen. Er schwamm in Glückseligkeit, wurde getragen von einer Welle des Glücks. Nie hätte er es sich träumen lassen, seinem geliebten Idol so nahe zu sein.
Der Raum leerte sich langsam, die Honoratioren verließen die Bühne. Michael stand wie benommen da. Bei den anderen löste sich die Spannung und sie umringten ihn um ihm zu gratulieren. »Mensch Michael«, tönte es von allen Seiten, »Solch ein Glück, solch eine Auszeichnung, was hast du für ein Schwein.«
Jetzt löste sich auch bei ihm die Spannung und er lächelte glücklich. Sein Schwiegervater trat neben ihn und gratulierte ihm, indem er ihm die Hand schüttelte. Das gleiche tat der Dirigent.
»Michael«, meinte er stolz und anerkennend, »du hast dem Chor große Ehre gemacht. Welch eine Auszeichnung.«
»Sie gilt uns allen«, erwiderte er bescheiden, »ich habe in eurer aller Namen die Glückwünsche dem Kaiser dargebracht und seine Huld entgegengenommen.«
Er war der Held des Tages. Stets gut gelitten im Chor stieg heute sein Ansehen ins Unermessliche. Sie waren stolz auf ihn und damit Stolz auf sich selbst. In diesem Augenblick identifizierten sie sich völlig mit dem Kaiser und der sie tragenden Ordnung.
»Was machen wir jetzt?« Mit dieser Frage brachte Bernhard Bläsius alle vom Himmel auf die Erde zurück.
»Wir gehen alle etwas essen«, meinte der Dirigent, »ich habe in der Kiste reservieren lassen. Ein gutes Essen und ein guter Tropfen werden uns guttun.«
Die anderen nickten beifällig und begannen, ihre Sachen zusammenzusuchen und zum Aufbruch zu blasen
Jaakov Silberstein trennte sich von seiner Familie, sobald der Kaiser samt Tross durchgezogen war. Er strebte dem Kasino des Anwaltvereins zu, denn hier sollte zu Ehren des Tages ein Festessen mit Huldigungsadresse an den Kaiser erfolgen. Auf dem Weg dorthin traf er einen Kollegen, der ebenfalls in Uniform, dem Casino entgegenstrebte. Viele Anwälte waren Offiziere der Reserve, es gehört zum guten Ton und war eigentlich ein gesellschaftliches Muss. Der Leutnant der Reserve stellte den Schlüssel zum Eintritt in die bürgerliche Gesellschaft dar.
»Hat es Ihnen gefallen Silberstein«, schmunzelte der Kollege, »imposante Erscheinung unser Kaiser.«
»Stimmt«, erwiderte dieser trocken.
Sie erreichten das Gebäude des Vereins und betraten den Gesellschaftsraum Hier standen schon viele Kollegen in Gruppen zusammen, Gläser und Rauchwaren in der Hand haltend, miteinander plaudernd. Silberstein begrüßte einige Bekannte und stellte sich zu einer Gruppe von Juristen, mit denen er näher Kontakt hatte. Er war in diesen Kreisen sehr beliebt. Dr. Jaakov Silberstein galt als brillanter Kopf und exzellenter Anwalt, geachtet und bewundert. Seine bescheidene und großzügige Art steigerte zudem seine Beliebtheit. Man traf sich zwanglos, hatte gewisse gesellschaftliche Kontakte, trank gelegentlich ein Glas Bier miteinander. Rechtsanwalt Jüttner, ein fast gleichartiger Kollege, natürlich auch in Uniform, dessen Vater Justizrat und in dessen angesehener Kanzlei dieser arbeitete, meinte zu Silberstein, mit dem er etwas sympathisierte.
»Beim Bankett soll es einen kleinen on dite gegeben haben. Der Kaiser hatte die Laune, sich einen der Postsänger vorstellen zu lassen. Ich glaube, es war Ihr Nachbar. «
»Sie meinen Nachbar Trotz?«, fragte Silberstein verwundert, »dem Kaiser vorgestellt. Wie das?«
»Er sollt ihm zweimal die Hand gegeben haben, eine Laune des Kaisers«, meinte Jüttner.
»Mein Nachbar ist ein großer Verehrer des Kaisers«, lachte Silberstein«, sicher eine Sternstunde für ihn, dem kleinen Postboten.«
»Da sieht man, wie populär unser Souverän ist«, mischte sich ein Dritter ein, »ein schönes Beispiel für seine Popularität und Volkstümlichkeit und das die Monarchie auf breiten Füßen steht. Was reden die Sozis immer von Klassengesellschaft, hier zeigt sich doch genau das Gegenteil. Der Kaiser kennt keine Klassen.«
»Na ja«, meinte ein anderer leise,« der Kaiser hat auch noch andere Ambitionen.«
»Sind Sie wahnsinnig«, raunten die anderen, »in aller Öffentlichkeit so etwas zu sagen. Selbst Denken darf man so etwas nicht einmal.«
»Na ja, ein Arbeiter ist mein Nachbar gerade nicht. Er ist ein etwas spießbürgerlicher Mann, der Teil dieses Systems ist, wenn auch nur ein ganz kleines. Und der ehrgeizig ist und aufsteigen will, soweit das seine Klasse zulässt. Ich freue mich für ihn ob seiner Auszeichnung. Anderenorts war der Kaiser nicht so leutselig. Wenn ich an die Zaberner Affäre denke...«
»Mensch Silberstein, fangen Sie schon wieder mit dieser Geschichte an«, seufzte Jüttner. »Sie mischen Äpfel mit Birnen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.«
»Schon«, entgegnete dieser, »gerade wir Juristen, auch wenn wir Offiziere sind, dürfen es nicht dulden, wenn das Recht dermaßen gebeugt wird. Und da ist es mir gleichgültig, ob im Reich oder im Elsass.«
»Die Sache ist nicht richtig gelaufen, da gebe ich Silberstein Recht«, mischte sich ein weiterer Kollege ein, »aber bei uns haben nicht die Zivilisten, nicht wir bürgerliche, sondern der Adel und das sie stellende höhere Militär das Sagen. Wer daran rüttelt, bringt die gesamte Grundordnung ins Wanken. Ich bin auch für etwas mehr Mitsprache, nicht aber für die Aufhebung aller Standesschranken. Wo kommen wir dahin?«
»Wo kommen wir dahin«, nahm Silberstein gedankenvoll die Worte auf, »eine gute Frage.«
»Wir repräsentieren und tragen diese Gesellschaft mit, sind ein Teil von ihr. Wo kämen wir hin, das in Frage zu stellen. Welche Gesellschaft wollten Sie, Silberstein«, fragte Jüttner.
»Eine etwas liberalere, natürlich nicht zu liberal, mit Ziel und Augenmaß, eine Gesellschaft wie in England. Hier kommen Ober- und Unterschicht doch recht gut miteinander aus«, sagte dieser.
»Dort hat der Adel auch das Sagen«, meinte ein weiterer Kollege, »sie machen das nur geschickter als bei uns. Aber kommt Leute, setzen wir uns, ich habe Hunger und es geht bald los. Sichern wir uns gute Plätze«
Alle lachten und strebten der Tafel zu.
Verlassen wir unsere Juristenschar und gehen zum Haus unseres Helden des Tages. Anna kehrte mit ihrer Schwester und den Kindern zeitig zurück, nach dem Mittageessen und einer kleinen Mittagsruhe ging Peter zum Spielen auf die Straße. Gegen vier Uhr kam er aufgeregt zurück, Anna wunderte sich ob der frühen Stunden.
»Mama, Mamma, Anna-Maria«, rief er ganz aufgeregt in die Küche, in der die beiden an Flickzeug saßen. »Papa hat mit dem Kaiser gesprochen und er hat ihm zweimal die Hand gegeben.«
»Was redest du Junge«, fragte Anna erstaunt und erschrocken, »Papa und der Kaiser, wie das? Woher hast du das?«
»Von Bub und der hat es von seinem Vater, einer seiner Reporter war dabei und hat alles gesehen und aufgeschrieben. Morgen kommt das in die Zeitung.«
»Ich gehe noch mal runter zum Spielen«, keuchte er und verschwand.
»Komm nicht zu spät zurück«, rief ihm die Mutter nach.
»Was soll man davon halten«, lachte Anna, »Michael und sein Kaiser, Hand in Hand. Da wird der mächtig stolz sein.«
Anna-Maria lachte ebenfalls, sie kannte unseren Michael sehr genau. Aber beide, Anna und ihre Schwester waren doch stolz auf ihn.
In der Kiste nahm das Bankett zu Ehren des Kaisers seinen Lauf. Natürlich wurde unser Michael hier mit großem Stolz gefeiert. Große Worte wurden gesprochen, viele Toasts ausgesprochen und die Geschichte immer und immer wieder erzählt. Einer der ihren war so vom Kaiser ausgezeichnet worden, das machte sie alle stolz und glücklich.
»Es entschädigt uns für die vielen Mühen, die wir hatten, um ein solches Werk zu vollbringen«, räsonierte der Dirigent stolz und ein klein wenig angesäuselt vom guten Wein.
Verschiedene Offizielle der Post kamen hinzu und drückten Michael stolz und bewegt die Hand. Es kam ihm so vor, als ob er an diesem Tage die gesamte Post gerettet habe. Da gaben ihm Leute die Hand, die ihn, den kleinen Postboten, bisher kaum beachteten. So stolz er auch war, die Sache begann ihm auf die Nerven zu gehen. Der Kaiser hat mir die Hand gegeben und darüber bin ich stolz, den Tag werde ich nie vergessen, aber dafür braucht man jetzt nicht die Macht des Schicksals zu spielen. Es ist eine Sache zwischen dem Kaiser und mir, den ich sehr verehre. Der Kaiser sah das und würdigte es, nicht mehr und nicht weniger.
Seine Freunde waren aber trotzdem stolz auf ihren Michael. Es war die gleiche Runde wie an dem Probenabend vor einigen Wochen.
»Siehst du Michael«, sagte sein Schwiegervater und trank ihm zu, »jetzt hat dein so verehrter Kaiser dir die Hand gegeben. Eine große Ehre, für dich und für uns alle.«
»Danke Vater, danke euch allen«, erwiderte Michael bescheiden, »aber lassen wir die Kirche im Dorf. Ich bin stolz, dass mir der Kaiser die Hand gab, aber wir wollen nicht übertreiben. Siehst du Karl, wir sind ein Teil dieses Getriebes, ein kleines Rädchen und das honorierte unser Kaiser.«
»Klar Michael«, erwiderte Karl, »ich bin ja auch stolz auf dich, wenn ich auch nicht so begeistert vom Kaiser bin wie du.«
»Wir wollen an solch einem heiteren Tag keine Wolken aufziehen lassen«, lächelte Friedrich, »also keine Reden über Politik, das passt heute hier nicht hin.«
Die anderen nickten und überließen sich der Freude dieses schönen Tages. Sie aßen und tranken gut, mäßig aber nicht übermäßig und sangen einige ihrer schönsten Lieder dazu. Die Gäste im Restaurant hörten und schauten zustimmend zu. Ein Stück gemütliches Alt-Trier. Der Kaiser bescherte allen diesen schönen Tag.
Gegen sechs Uhr lief Peter in der Wohnung ein. Anna-Maria verabschiedete sich und ging ihres Weges. Gleich darauf erschien Michael, leicht angesäuselt und guten Mutes. Er war in bester Stimmung und tätschelte den Kindern den Kopf. Anna sah ihn glücklich an, er gab ihr einen Kuss.
»Was hat Peter da erzählt, stimmt das, der Kaiser hat dir zwei Mal die Hand gegeben.«
»Woher weißt du das Peter«, fragte Michael erstaunt.
»Von Hahns Bub, ein Reporter hat es gesehen und es kommt morgen auch in die Zeitung«, antwortete er stolz. Alle hier im Viertel reden davon.
»Du lieber Himmel«, seufzte Michael und setzte sich auf einen Küchenstuhl.
»Was ist daran so schlimm«, fragte Anna, »es ist eine große Auszeichnung und du hast die verdient. Wir sind alle stolz auf dich.«
»Ja schön«, lächelte er müde, »aber so viel Aufwand braucht trotzdem darum nicht gemacht zu werden. Weiß Gott, wer mir heute schon alles die Hand gedrückt oder auf die Schulter geklopft hat.«
»Es ist eine große Auszeichnung und sicher hilft es dir auch beruflich.«
»Papa ist der Kaiser ein großer Mann«, fragte Peter neugierig. »Wir haben im Kindergarten ein Lied gelernt. Der Kaiser ist ein großer Mann und wohnet in Berlin.« Er sang einige Noten dazu.
»Natürlich ist er das, eine imposante Erscheinung, ein wichtiger Mann, er kommt gleich hinter Gott«, mahnte der Vater.« Und wir müssen ihm immer gehorchen.«
Anna trug das Abendessen auf. Michael hatte nicht mehr viel Hunger, das Bankett lag noch hinter ihm. Er aß nur eine Kleinigkeit und unterhielt sich in sehr entspannter Art und Weise mit Anna und den Kindern. Solch eine entspannte Atmosphäre herrschte selten bei Tisch. Heute kam er sogar mit Minchen gut aus und hatte nichts an ihr und auch den anderen Kindern auszusetzen. Die Kinder genossen es und wurden ganz fröhlich dabei.
Später brachte Anna sie ins Bett und danach saß sie mit Michael noch einige Zeit im Wohnzimmer. Sie ließen die Bilder des Tages an sich vorbei ziehen, Michael erzählte intensiv die ganze Geschichte aufs Neue und zum Schluss freuten sie sich über den schönen und gelungenen Tag.
Der nächste Tag brachte weitere Aufregungen. Im Treppenhaus traf Michael seinen Nachbar Silberstein. Dieser grüßte wie immer sehr freundlich, und nachdem sie ihre Hüte gelüftet hatten meinte dieser.
»Was hört man da, Sie sind gestern dem Kaiser vorgestellt worden. Kolossal, gratuliere.«
»Das stimmt Herr Dr. Silberstein, der Kaiser geruhte, mir die Hand zu geben. Das freute mich, denn ich verehre ihn sehr. Aber mehr ist es auch nicht, ich hebe dafür nicht von der Erde ab.«
»Das glaube ich Ihnen, und so schätze ich Sie auch nicht ein«, lachte Silberstein, «aber vielleicht hilft es Ihrer Postkarriere.«
»Möglich«, meinte Michael, »möglich ist alles. Ich muss leider weiter Herr Nachbar, die Pflicht ruft, bin schon etwas spät dran.« Und beide verabschiedeten sich sehr artig voneinander. Michael schaute ihm nach. Dieser Winkeladvokat, dieser alte Jud, steht so weit in der Hierarchie über mir, der hat gut reden von Karriere und so. Aber ich habe jetzt keinen Sinn, weiter darüber nachzudenken.
Dieser Postfritze, sinnierte Silberstein, wurde so geehrt und spielt jetzt den Bescheidenen. Dabei ist so ein Ereignis in seinen Kreisen doch das höchste Glück, diese Kleinbürger und Philister[7].
Sobald unser Sänger das Postgebäude betrat, wurde er von verschiedenen Kollegen angesprochen, auf die Schulter geklopft und Hände geschüttelt.
»Mensch Michael, Mensch Trotz hieß es, was für eine Ehre.«
Kaum hatte er seinen Arbeitsplatz eingenommen, musste er zum Vorsteher, dem gestrengen Postrat. Dieser beglückwünschte und eröffnete ihm zugleich, dass sie beide sofort beim Präsidenten erwartet wurden. Verwirrt folgte er seinem Vorgesetzten in den Olymp der Post. Michael war hier noch nie gewesen und ein Postler seiner Klasse hatte normalerweise auch keinen Zutritt zu diesen heiligen Hallen.
Der Präsident empfing ihn jovial, schüttelte ihm die Hand und meinte.
»Das ist eine große Ehre für uns, der Kaiser zeichnete durch Sie auch unsere Postverwaltung aus. Wie lange sind Sie schon dabei und welche Stellung begleiten sie derzeit?«
»Seit 1904 Herr Präsident«, erwiderte Michael in strammer Haltung, »bisher war ich Postbote, seit zwei Monaten arbeite ich als Praktikant mit dem Ziel des unteren Postdienstes in der Verwaltung.«
»Herr Trotz ist ein ausgezeichneter Mitarbeiter«, ergänzte der Postrat und der Präsident nickte, »wir beabsichtigen, ihn zum ersten April nächsten Jahren zur Laufbahn zuzulassen und in das Beamtenverhältnis zu übernehmen.«
»Sehr gut, sehr gut der Mann«, nickte der Präsident noch einmal zustimmend, »tun Sie das und halten Sie mich auf dem laufenden. Unsere Mitarbeiter sind das Aushängeschild der Post. Es ist sehr wichtig, nach außen ein tadelloses Bild abzugeben. Das taten Sie, Herr Trotz, gestern in vorbildlicher Weise. Ich bin sehr stolz auf Sie. Ich denke, Herr Postrat, wir werden die Beförderung unseres Kollegen ins Beamtenverhältnis als Postschaffner etwas beschleunigen. Bitte veranlassen Sie das Notwenige.«
»Sehr wohl Herr Präsident.«
Dieser drückte Michael noch einmal die Hand, bot ihm und seinem Postrat eine gute Zigarre an. Danach waren beide entlassen. Stolz und glücklich schritten sie in das Büro des Chefs zurück.
»Also mein Lieber«, meinte der Postrat, »ich nehme Sie sofort aus dem Telegraphendienst heraus. Sie werden ab heute im Postinnendienst eingesetzt. Wir beginnen mit dem Schalterdienst, Sie werden dort hospitieren und nach einem genau festgelegten Plan verschiedene Stadien durchlaufen. Die Einzelheiten besprechen Sie mit ihrem nächsten Vorgesetzten. Ich führe Sie jetzt zu ihm und werde Sie vorstellen.«
Wir wollen hier anmerken, dass Michael einen Monat später zum Postschaffner befördert und in das Beamtenverhältnis übernommen wurde.
Nachdem Michael aus dem Haus war, ordnete Anna wie gewohnt die Wohnung und den Tagesablauf, die Kinder versorgt, die Betten gemacht, auf Anna-Maria gewartet und ihr täglicher Gang in die Geschäfte konnte beginnen.
Beim Milchmann fiel es Anna zuerst auf. Dieses breite, überfreundliche Lachen, mit dem sie begrüßt wurde. Und alle versuchten, mit ihr in ein Gespräch zu kommen.
Beim Metzger Werland war es nicht anderes. Man betrachtete sie mit Blicken, als sei sie ein Kalb mit zwei Köpfen. Und wieder dieses vertrauliche Lachen und Zunicken! Irrte sie sich, oder tuschelten die Leute, wenn sie den Laden wieder verließ? Komisch!
Ach ja, natürlich, die Kaisergeschichte. Es stand in der Zeitung und heute wissen es schon alle Leute in der Straße und im Viertel. Frau Effertz, die Kolonialwarenhändlerin schwatzte sogar, sie hätte gehört, dass große Glück wäre jetzt bei ihnen eingekehrt.
»Sicher«, antwortete Anna trocken, »es war eine große Ehre für meinen Mann. Aber das ist auch schon alles.« Und machte, dass sie schnell aus dem Laden kam.
»Mensch Anna-Maria«, seufzte Anna später in der Wohnung, »was hat mein Michael nur da angerichtet. Überall wurde ich darauf angesprochen oder angeschaut. Als ob wir Gold gefunden hätten.«
»Papa redete gestern Abend auch von nichts anderem mehr. Es traf sie halt hart und die Ehre machte sie fertig.«
»So sind die Männer«, seufzte Anna noch einmal, »habens immer mit ihrer Ehre. Und gerade mein Michael und sein geliebter Kaiser. Und nun gab der ihm auch noch die Hand. Das verkraftet er kaum. Andererseits wird es ihm bei der Post von Nutzen sein, da bin ich mir sicher.«
»Eben«, bestätigte die Schwester, »und das ist doch das Wichtigste.«
»Anna, du bist am gleichen Tag geboren wie der Kaiser, am siebenundzwanzigsten Januar. Vielleicht hat Michael dich nur deshalb geheiratet«, scherzte Anna-Maria.
»Er vergisst auf jeden Fall nie meinen Geburtstag«, lachte Anna, »aber er heiratete mich schon aus Liebe, auch wenn die Männer über diese Gefühle nicht reden.«
»Liebst du ihn immer noch«, fragte Anna-Maria spontan.
»Natürlich, er ist ein guter Mann, auch wenn er ein Hautkopf ist, einen besseren hätte ich nicht finden können.«
2.
Albert zog es nach Trier. In den Jahren der Wanderschaft war er einige Zeit hier gewesen und die Stadt hatte ihm sehr gut gefallen. Dieses alte katholische Trier mit seiner großen Geschichte, geprägt vom katholischen Glauben, wichtigem Stützpunkt in den Jahrhunderten gegen den Unglauben. Dieses alte heilige Trier mit seinen Wurzeln bis in die Römerzeit machte auf ihn den größten Eindruck. Dazu die vielen Kirchen und der schöne Dom gaben der Stadt eine einmalige Atmosphäre. Ein kleiner Wehmutstropfen blieb allerdings für unseren frommen Schreiner. In dieser heiligen Stadt war in seinen Augen der Antichrist geboren, denn dafür hielt er Karl Marx. Der Kommunismus ist der Untergang der Menschheit, dachte Albert, Christentum und Sozialismus stehen sich wie Feuer und Wasser gegenüber. Warum muss solch ein Mensch ausgerechnet in einer so heiligen Stadt geboren sein. Man sieht halt, der Teufel ist überall. Und Gottes Wege sind unergründlich.
Im März 1913 packte Albert seine Habseligkeiten und zog seinem Ziel entgegen. Es wurde von Berlin her eine lange Reise, die er mit der Bahn vierter Klasse, der sogenannten Holzklasse, durchführte. Trier als äußerster Zipfel der preußischen Rheinprovinzen wurde von Berlin immer stiefmütterlich behandelt. Man traute diesen katholischen Rheinländern nicht und schikanierte sie stets ein bisschen. Die Einstellung der Bevölkerung zur preußischen Obrigkeit blieb daher gespannt, ungeachtet der Begeisterung einzelner wie Michel für den Kaiser. Aber auch unser Postler war in erster Linie katholisch und vergaß das nicht, so sehr er die Obrigkeit liebte. Albert hingegen fühlte noch viel mehr katholisch, er war es durch und durch und gegen seine konservative katholische Grundeinstellung waren konservative Kleriker jakobinische Tumultuanten.
An einem freundlichen Märztage also erreichte er Trier. Er kannte sich hier ja recht gut aus und ging den kurzen Weg bis zum Haus Fetzenreich, dem Quartier des Kolpingvereins.
Es lag in der Sichelstraße in Sichtweite des Doms, was Albert schon bei seinem ersten Aufenthalt so gut gefallen hatte.
Dieses Anwesen, im Kern aus dem Spätmittelalter stammend, wurde im Jahre 1824 von dem Architekten Franz Müller barockklassizistisch umgebaut. Die Fassade hatte den schon geläufigen Aufbau mit zwei Geschossen und fünf Achsen, mittlerem betontem Eingang sowie einem Mansarddach und rustizierten Ecklisenen. Die Proportionen waren leicht gestaucht, die Fenster hochrechteckig. Die Tür- und Fenstergewände wiesen Faszienbildung auf, ein Hinweis auf die unbarocken Tendenzen. Im Ganzen war der Bau ein Nachzügler, da zu seiner Erbauungszeit im dritten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts nur wenige hundert Meter weiter bereits in Formen des preußischen Klassizismus sowie des beginnenden Historismus gebaut wurde. Der Gesellenverein kaufte dieses schöne Anwesen in der späten Hälfte des 19. Jahrhunderts und es diente als Anlaufstelle für die Handwerksburschen, gab ihnen Quartier, Schutz und Zuhause.
Albert wurde vom Hausvater Marzin empfangen, dem er geschrieben hatte. Man schätzte ihn hier, da er fromm, sehr bescheiden und hilfsbereit war. Marzin mochte unseren Albert besonders, es war fast schon eine Freundschaft.
»Nun Albert, wieder im Lande«, begrüßte ihn der Hausvater jovial, »siehst gut aus mein Freund.«
»Ich bin auch sehr froh, wieder hier zu sein«, erwiderte er und gab ihm die Hand.
»Albert, ein Einzelzimmer habe ich im Moment nicht, aber du bekommst sofort eines, wenn wieder was frei wird. Du musst dich mit einem Gemeinschaftsquartier begnügen.«
»Nicht schlimm«, entgegnete Albert, »Hauptsache ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich brauche nicht viel zum Leben.«
Albert nahm seine geringe Habe und folgte dem Hausvater, der ihn in die Stube führte, in der drei Doppelbetten, sechs Spinde, ein Tisch und sechs Stühle standen. Er zeigte ihm sein Bett und seinen Spind. Die anderen Zimmergenossen waren auf Arbeit.
»Lass dir die Bettwäsche aus der Kleiderkammer geben, du kennst dich ja aus, kennst die Regeln als alter Kolpianer. Was du zu zahlen hast, weißt du auch, ist immer am ersten fällig. Hast du schon Arbeit?«
»Noch nicht, entgegnete Albert, »wenn ich hier alles erledigt habe, gehe ich zu meinem alten Meister, bei dem ich das letzte Mal gearbeitet habe. Vielleicht hat er Arbeit für mich.«
»Sicher«, bestätigte der Hausvater, »erledige den Kram und komm dann zum Essen.
»Danke Herr Marzin«, sagte Albert bescheiden.
Albert räumte seine Siebensachen ein, es war nicht viel, ein wenig Kleidung, einiges Handwerkszeug, das er in tadellosem Zustand hielt und anderen Krimskrams. Danach wusch er sich die Hände und ging zum Essen.
Hausvater Marzin stellte ihn den Anwesenden kurz vor und zeigte ihm seinen Platz. Es herrschte eine strenge Tischordnung, jeder wusste wo er saß. Die anderen nickten ihm zu und das Essen nahm nach einem Gebet seinen gewohnten Lauf. Es war sehr einfache Kost, aber ausreichend und auch eigenmaßen schmackhaft zubereitet. Albert stellte hierin keine großen Ansprüche.
Nach dem Essen meldete er sich freiwillig zum Spüldienst, einige Küchenangestellte kannten ihn noch und begrüßten ihn freundlich. Albert war ihnen deshalb so gut in Erinnerung, weil er immer bescheiden solche Dienste übernommen hatte. Anschließend nahm er seinen Mantel und zog los. Sein Ziel war die Schreinerei Giesecke in der Deutschherrenstraße.
Für den Meister hatte er bei seinem ersten Aufenthalt viel gearbeitet. So wurde er auch sehr freundlich begrüßt, als er die Schreinerei betrat.
»Unser Albert ist wieder da«, rief freudig der Senior und gab ihm herzhaft die Hand.« Du kommst gerade recht, ich habe viel Arbeit und brauche jede Hand. Bleibst du länger in Trier?«
»Ja«, erwiderte Albert, »ich will erst einmal hier in Trier bleiben. Wohne wieder beim Kolping. Wann soll ich anfangen?«
»Gleich wenn du willst«, lachte der Meister und Albert schickte sich an, seinen Mantel auszuziehen.
»Das war ein Scherz Albert, natürlich nicht heute«, lachte der Senior, »morgen früh um sieben Uhr, wenn es dir recht ist. Du kannst wieder mit Zimmermann Helbart zusammen arbeiten, ihr habt euch doch schon früher gut verstanden. Nur Albert, fest anstellten kann ich dich nicht, dafür reicht es auf Dauer nicht bei mir.«
»Ist nicht schlimm Meister, ich bin froh, jetzt Arbeit zu haben. Ich finde immer etwas, Sie wissen es.« Der Meister nickte. Albert gab ihm die Hand und verließ die Werkstatt. Für diesen Meister arbeitete er gerne, er war in Ordnung, legte viel Wert auf gute Arbeit, zahlte einen guten Lohn und behandelte die Gesellen ordentlich. Albert hatte sich seit seiner Lehrzeit geschworen von keinem Meister mehr schikanieren zu lassen und suchte deshalb mit großer Sorgfalt seine Auftraggeber aus.
Was tun mit dem Rest des Tages, dachte er, als er den Rückweg antrat. Da er Zeit hatte, ging er nicht den direkten Weg zurück sondern machte einen kleinen Umweg über den Kirchenplatz. Er sah die neue Johanneskirche, die bei seinem ersten Aufenthalt noch im Bau war. Was für eine schöne Kirche und ging hinein. Sie war recht groß, im neuromanischen Stil erbaut, die Decke über dem Hauptaltar mit großen Fresken der Evangelisten ausgemalt. Besonders gefielen ihm der schöne Hauptaltar, und die beiden rechts und links gelegenen kleinen Seitenaltäre. Eine ebenfalls aus schönem Marmor angefertigte Kommunionbank schloss den Altarraum ab.
Albert kniete rechts hinten in eine Bank und begann zu beten. Dann setzte er sich und betrachtete noch einmal in Ruhe die Umgebung. Es fiel ihm auf, dass an den Bänken und Türen noch Schreinerarbeiten durchzuführen wären, es sah noch etwas roh aus.
In diesem Augenblick betrat von der links gelegenen Sakristei ein Mann den Altarraum und begann zu werkeln. Sicher der Küster oder Organist, dachte Albert. Der Mann war etwas kleiner als Albert, hatte ein sympathisches offenes Gesicht und war ungefähr in seinem Alter. Sein linkes Bein war etwas verkrümmt und er zog es ein wenig nach.
Albert stand auf und ging an die Kommunionbank. Der Mann drehte sich um und sah unseren Albert in seiner Zimmermannskluft. Sicher ein Geselle, der um ein kleines Almosen bittet, auf Wanderschaft, sind arme Kerle.
Albert verbeugte sich und meinte. »Es ist eine schöne Kirche, aber hier ist schreinermäßig noch einiges zu tun. Die Bänke und Türen sind noch nicht sauber verlegt. Müsste noch vieles nachgearbeitet werden. Ich könnte das machen. Mein Name ist Albert Dieckmann, bin Schreiner- und Zimmermann.«
Der Mann lächelte. »Sicher, hier ist noch viel zu tun, auch oben im Chor an der Orgel und in der Taufkapelle, in der Sakristei. Aber die Gemeinde muss sparen, alles zu seiner Zeit.«
»Ich verlange kein Geld dafür, ich mache das ehrenamtlich, in meiner Freizeit, es ist mir eine Ehre, für die Kirche zu arbeiten.«
Der Mann schaute ihn verwundert an, etwas ungläubig. Es lagen eine solche Ruhe und Ausgeglichenheit in dem Ausdruck des anderen. An wen erinnert er mich, dachte er.
»Wohnen Sie in der Pfarrei, ich habe Sie bisher hier noch nie gesehen?«
»Nein, ich bin erst kurz wieder hier, habe früher schon mal in Trier abgearbeitet. Ich wohne im Kolping und arbeite jetzt für Meister Giesecke«, erwiderte er.
Jetzt weiß ich an wen der mich erinnert, an den heiligen Josef. Er sieht irgendwie aus wie der heilige Josef.
»So so, für Meister Giesecke.«
Er trat aus dem Altarraum und ging auf Albert zu.
»Mein Name ist Wilhelm Schello, ich bin der Küster und Organist der Pfarrei«, und gab ihm die Hand, »ich werde mal mit Dechant Roschel sprechen. Einen guten Arbeiter können wir schon gebrauchen. Ich wohne mit meiner Frau in dem kleinen Haus hinter der Kirche. Fragen Sie doch in einigen Tagen bei mir nach. Ich bin mir aber sicher, dass der Dechant zugreifen wird. Wer bei Meister Giesecke arbeitet, ist ein frommer und guter Arbeiter.«
»Ich komme am Sonntag in die Kirche«, sagte Albert, »dann können wir darüber reden.«
Er verbeugte sich und verließ die Kirche. Er sieht aus wie der heilige Josef. Schello sah ihm nach. Wer so aussieht ist kein schlechter Mensch.
Albert schlenderte langsam nach Hause. Die Abendandacht begann und die wollte er nicht versäumen. Auf seiner Stube waren inzwischen die anderen Genossen eingetroffen und er stellte sich kurz vor. Danach verließ er den Raum und ging zur Kapelle, hernach zum Abendessen.
Bei Tisch wurde nicht viel gesprochen, man hörte dem Tischleser zu, der aus einer erbaulichen Schrift vorlas. Die anderen beäugten ihren neuen Zimmergenossen argwöhnisch. Irgendetwas an unserem Schreiner schien ihnen nicht zu gefallen.
Albert meldet sich wieder freiwillig zum Spüldienst und ging später auf seine Stube. Die anderen saßen um den Tisch herum und spielten Karten, eine Flasche Schnaps stand auf dem Tisch, die ab und zu herumgereicht wurde, Zigaretten und Pfeifenrauch lagen in der Luft. Das gefiel Albert nicht.
»Na Neuer«, meinte einer der Zimmergenossen, ein grobschlächtiger Mann, »willst auch nen Schluck.« Albert verneinte.
»Hört mal, so geht das nicht, du hast dich hier anzupassen. Bist wohl ein Betbruder, hab das schon bemerkt. Schätzchen des Hausvaters und Präsens wie?«
»Das geht dich überhaupt nichts an«, erwiderte Albert.
»Auch noch frech werden, du Holzkopf, willst wohl eines auf die Schnauze.«
»Du kannst das ja mal versuchen«, erwiderte Albert.
Die anderen sagten nichts und schauten ihn groß an. Der Grobschlächtige, anscheinend das Großmaul und der Wortführer der Gruppe, stand auf und ging auf Albert zu. Er trat ganz dicht an ihn heran.
»Was willst du Bürschchen«, und hielt ihm die Faust vor das Gesicht.
Bevor er sich aber versah, trat Albert ihm auf den rechten Fuß und versetzte ihm gleichzeitig einen Kinnhacken, der ihn zu Boden brachte. Bevor er sich gerappelt hatte, gab Albert ihm einen ordentlichen Tritt in den Hintern, packte ihn beim Kragen und zog ihn hoch. Dann versetzte er ihm einen Fausthieb in den Magen, der ihn wieder zu Boden brachte. Er blieb liegen. Albert ging ruhig an seinen Spind, schloss auf und nahm einen schweren Eichenstecken heraus, seinen Wanderstab.
»Passt mal auf ihr Großmäuler, ich lasse mir von niemand und erst recht von euch nichts gefallen. Wenn ihr glaubt, mich schikanieren zu können, seid ihr am falschen Platz. Ich werde euch die Visagen so zurechtbiegen, dass euch die eigene Mutter nicht mehr erkennt und das Hinterteil zu Staub treten. Ich war lange genug auf Wanderschaft, um zu wissen, wie man sich wehren muss.
»Und du Großmaul«, sagte er zu dem am Boden Liegenden, »dir werde ich es zeigen. Wir gehen jetzt sofort zum Hausvater und ich sorge dafür, dass du morgen hier verschwunden bist. Habt ihr anderen noch etwas zu melden?«
Keiner sagte etwas.
»Feige seit ihr auch noch, so ist recht. Der Schnaps verschwindet hier von der Stube, und zwar sofort. Wenn ich mit diesem Lümmel hier vom Hausvater zurück bin, will ich die Flasche nicht mehr sehen. Und lüften könnt ihr auch mal.«
Albert packte das Großmaul am Kragen, zog ihn hoch und schleifte ihn aus dem Zimmer. Mit einem weiteren Fußtritt im Hintern stolperte dieser vor ihn her und sie erreichten das kleine Büro des Hausvaters. Der sah sofort was hier los war und hörte sich Alberts Bericht an.
»Du schläfst heute im Kellerraum und bist morgen früh hier weg«, sagte er zu ihm, »solch einen wie dich können wir hier nicht brauchen.« Das Großmaul sagte nichts mehr.
Albert verließ das Büro und ging auf seine Stube zurück. Die restlichen Genossen saßen stumm um den Tisch, die Schnapsflasche war verschwunden.
Albert setzte sich auf einen freien Stuhl am Tisch. Er schaute jeden einzelnen an.
»Hör mal Kollege«, meinte jetzt ein Zunftbruder, »wir wollen keinen Streit mit dir. Ich bin auch schon lange genug auf der Walz um zu wissen, wie der Hase läuft.«
»Eben«, meinte Albert, »und solche Großmäuler wie der, den ich eben verarztet habe, gibt es überall und in jeder Gruppe. Ich bin ein zurückhaltender Mensch, ich lese viel und gehe in die Kirche, sie bedeutet mir viel. Deshalb bin ich im Kolping, sonst kann ich auch in irgendeinem Männerwohnheim Unterschlupf finden. Und zum Saufen und Fluchen geht man ins Wirtshaus. Ich wurde in meiner Lehrzeit ordentlich durchgeprügelt und habe mir geschworen, so etwas nicht mehr zu dulden. In den Gemeinschaftsunterkünften gib es immer einen oder mehrere die glauben, die anderen schikanieren zu können«
Die anderen nickten, sie teilten das gleiche Schicksal.
»Ich suche auch keinen Familienanschluss«, nahm Albert wieder das Wort, »ich will in Ruhe gelassen werden und so leben, wie es mir gefällt.«
»Ist gut«, meinte ein anderer, »wir haben verstanden. Lasst uns Frieden schließen. Du hast ja recht, jeder muss selbst sehen, wie er zurechtkommt.«
Er stand auf, ging zu Albert hin und streckte ihm die Hand zur Versöhnung hin. Dieser schlug ein und die anderen machten es ihrem Kameraden nach. Der Frieden war wieder hergestellt. Sie setzten sich alle um den Tisch und begannen, zu erzählen, von ihrer Wanderschaft und bisherigem Leben. Und von Stund an verstanden sich die fünf Stubengenossen ausgezeichnet.
Am nächsten Tag begann Albert seine Arbeit in der Schreinerei. Johann Helbart, ein älterer Zimmermann begrüßte ihn freundschaftlich.
»Tag Albert, wie geht es dir. Bist wieder im Lande, schön, dass wir beide wieder zusammenarbeiten.«
»Das finde ich auch Johann«, erwiderte Albert und gab dem Freund die Hand. »bin froh, mit dir zusammenarbeiten zu können.«
Die beiden hatten früher viel miteinander gearbeitet und kannten sich gut, waren sich gegenseitig sympathisch. Sie besprachen ihr weiteres Tagewerk. Im Laufe des Nachmittags sagte Johann beiläufig zu Albert.
»Hast du nicht Lust, morgen Abend zu uns zum Abendessen zu kommen? Meine Familie freut sich sicher drauf, dich wieder zusehen.« Albert kannte die Familie Johanns recht gut, war er doch früher schon dort gewesen.
»Macht es auch nicht zu viel Arbeit«, fragte er bescheiden.
»Aber Albert, auf einen mehr oder weniger kommt es nicht an und wir freuen uns wirklich, wenn du kommst.«
»Na dann«, erwiderte Albert
»So gegen halb sieben, ist dir das recht?«
»Wunderbar.«
»Komm herein Albert, sagte Johann Helbarts Frau Katharina, »und zieh die Kappe ab.« Sie gab ihm die Hand. Albert war pünktlich um halb sieben erscheinen, frisch gewaschen und in seinen besten Sachen. Er brachte ein paar Blumen mit für die Hausfrau.
»Komm in die gute Stube«, meinte diese und schob ihn ins Wohnzimmer ihrer kleinen Wohnung am Zuckerberg 12/13, mitten im Judenviertel und ganz in der Nähe der Synagoge gelegen. In dem bescheidenen Wohnzimmer war der Tisch bereits gedeckt, die beiden Töchter Katharina, zwanzigjährig und Barbara, etwas jünger liefen eifrig hin und her, nach dem sie Albert begrüßt hatten.
»Seit ihr groß geworden«, scherzte dieser und alle lachten. Die beiden konnten unseren Albert sehr gut leiden, er war immer freundlich zu ihnen gewesen.
Endlich war der Tisch gedeckt. Alle setzten sich herum, Johann sprach das Tischgebet und alle langten zu. Es gab einfache gute Hausmannskost, ein warmes Abendessen, Bier und Milch zu trinken.
»Lang zu Albert«, forderte freundlich die Hausfrau, »sei nicht so bescheiden, du kannst es vertragen.«
Albert lachte verlegen und nahm sich noch einen ordentlichen Löffel von dem guten Gericht.
»Magst du Bier«, fragte Johann.
»Ein kleines Gläschen bitte«, erwiderte Albert.
Nach der Mahlzeit räumten die Mädchen ab und trugen das Geschirr in die Küche.
Johann und Albert saßen zeitweise alleine im Wohnzimmer. Johann rauchte seine Pfeife. Der Duft des Knasters erfüllte den Raum.
»Was sind deine Pläne Albert? Willst du ewig im Kolping wohnen. Willst du keine Familie gründen?« fragte Johann.« Alt genug bist du.«
»Ich habe noch kein festes Einkommen. Zudem muss ich erst mal die richtige Frau finden. Und ich möchte noch den Meisterbrief erwerben.«
»Das ist richtig, dass du so strebsam bist«, erwiderte Johann, »aber der Meister kostest etwas Geld.«
»Deshalb spare ich etwas dafür und möchte mich noch nicht binden«, meinte Albert. Aber er dachte im Inneren, die Katharina ist ein schönes Mädchen geworden, sie gefällt mir gut, das wäre die richtige Frau für mich. Um vom Thema abzulenken meinte er.
»Ich habe gestern mit dem Organisten von St. Johannes gesprochen. Ich werde etwas ehrenamtlich in der Kirche fällige Schreinerarbeiten machen.«
Die Frauen kehrten ins Wohnzimmer zurück. Sie hörten die letzten Worte Alberts. Katharina lächelte.
»Dann sehen wir uns vielleicht in der Kirche, ich helfe des Öfteren der Frau Schello beim Waschen und Herrichten der heiligen Gewänder, Mama hat mich doch das Schneidern gelernt.«
Johann schmunzelte und dachte sich seinen Teil. Albert als Schwiegersohn wäre ihm hochwillkommen.
Am Sonntag nach dem Hochamt ging Herr Schello auf Albert zu und bat ihn, in die Sakristei zu folgen. Dechant Roschel, ein netter älterer jovialer Mann war gerade dabei, sich der Gewänder zu entledigen.
»Herr Dechant, hier ist der junge Schreiner, der uns helfen möchte«
Der Dechant sah freundlich auf Albert und gab ihm die Hand. An wen erinnert der mich?
»Es ist der heilige Josef«, meinte Schello trocken.
»Können Sie Gedanken lesen, mein Freund?«
»Es freut mich sehr, dass Sie für uns arbeiten wollen. Wie stellen Sie sich das vor?«
»Ich komme abends und am Samstagmittag, wenn ich Zeit habe, Hochwürden.«
»Wunderbar«, meinte der Dechant, »Herr Schello zeigt Ihnen die Stellen, an denen etwas getan werden muss. Gottes Lohn ist Ihnen sicher, mein Freund.« Er gab ihm noch einmal die Hand und verließ die Sakristei.
Von diesem Tag an war Albert ein ständiger Gast in der Kirche. Jede freie Minute, die er erübrigen konnte, verbrachte er dort. Er leistete hervorragende Arbeit und alle waren voll des Lobes. Mit seinem Charakter nahm er alle für sich ein. Herr Schello und Albert wurden Freunde und oft lud dieser den Schreiner nach getaner Arbeit zum Abendessen ein. Auch seine Frau Roswitha sah unseren Albert gerne. Eines Tages boten beide ihm das du an, dass dieser mit Freuden annahm. Sie wurden seine besten Freunde in der Stadt.
Natürlich sah Albert auch Katharina Helbart des Öfteren, er sah sie sehr gerne und zwischen den beiden entspannte sich eine zarte Liebe. Katharina mochte diesen aufrichtigen armen Schreiner, er war intelligent und konnte so lebhaft erzählen. Sie hörte doch so gerne schöne Geschichten. Dazu hatte er gute Manieren. Katharina war ein einfaches, sehr gutmütiges Mädchen, vielleicht ein bisschen naiv. Ihr Aussehen konnte man nicht direkt schön nennen, für Albert aber war sie es. Sie kamen sich näher, natürlich alles in Ehren.
Als er eines Samstags mittags in der Kirche werkelte, trat ein gutgekleideter Herr auf ihn zu. Er war etwas älter als er und stellte sich als Rechtsanwalt Jüttner vor.
»Ich habe von Herrn Schello erfahren, dass Sie Schreinerarbeiten annehmen. Ich sehe, welch gute Arbeit Sie hier in der Kirche leisten«, begann er die Unterhaltung, »meine Familie und ich, also mein Vater, Justizrat Jüttner, und ich mit meiner jungen Familie wohnen in einer Villa am Kathrinenufer, nicht weit von hier. Wir haben diese erst kürzlich erworben und es gibt noch viel zu tun, insbesondere Schreinerarbeiten. Wären Sie daran interessiert?«
»Gerne«, sagte Albert, dem das Angebot sehr gelegen kam, denn Meister Giesecke hatte nicht mehr viel für ihn zu tun. »Ich mache was Sie wollen. Wann soll ich beginnen?«
»Wann können Sie«?
»Ab Mittwoch, wenn es Ihnen recht ist.«
»Bestens«, lachte der junge Rechtsanwalt, »kommen Sie doch bitte Dienstagabend zu uns, dann können wir in Ruhe alles besprechen und Sie können am nächsten Tag sofort beginnen.«
Der Anwalt gab Albert die Hand und ging. Wilhelm Schello trat zu ihm.
»Gute Familie, sagte er zu Albert, als dieser erzählt hatte, »sehr gute Familie, bestes Renommee.«
»Danke Wilhelm für die Vermittlung«, grinste Albert.
»Du brauchst dich nicht zu bedanken, deine Arbeit spricht für sich. Übrigens, ich hätte noch einen Auftraggeber für dich. Die Josefsschwestern suchen einen Schreiner, der allerlei Arbeiten erledigen kann. Wenn du willst, geh zur Schwester Oberin und sage ihr einen schönen Gruß von mir. Ich spiele dort ab und zu sonntags die Orgel.
»Du bist wirklich ein guter Freund«, meinte Albert, »wie kann ich das gutmachen.«
»Es ist vergolten, glaube mir.«
Wie die Dinge lagen bekam Albert diese schönen Arbeitsstellen. Bei Meister Giesecke, der für ihn auch bei den anderen Arbeitsstellen pro forma die Oberaufsicht führte, Justizrat Jüttner sen. und sein Sohn, die begeistert von seiner Arbeit waren und den Josefsschwestern, die seinen Fleiß, sein Können und seine Frömmigkeit hoch schätzten und über alles lobten. Albert verdiente nun genug, um sein bescheidenes Leben finanzieren zu können.
Einige Monate später erledigte Albert eine Auftragsarbeit für Meister Giesecke. Zusammen mit Johann arbeiteten sie in dem großen Bekleidungsgeschäft Silberstein an der Ecke Nagelstraße. Es war ein imposantes Gebäude mit vier Stockwerken. Um die Mittagszeit setzten sie sich auf einen großen Stein vor dem Laden und verzehrten ihr Mittagsbrot. Ein junger Herr ging an ihnen vorbei und schaute sie etwas verwundert an. Johann stand auf und grüßte, in dem er die Mütze abnahm. Albert blieb sitzen. Der junge Herr grüßte oberflächlich und ein wenig herablassen und ging hinein.
»Wer war das?« fragte Albert.
»Der Rechtsanwalt Dr. Jaakov Silberstein, der Sohn des Geschäftsinhabers«, erwiderte Johann.
»Sind das Juden«, fragte Albert verwundert.
»Sicher, das erkennst du doch schon am Namen. Wer heißt schon Silberstein. Das riecht nach Jud.«
»Mein Vater verlor durch Handelsjuden unsere kleine Landwirtschaft in Schlesien. Er leihte sich Geld bei ihnen und sie zogen ihm das Fell über den Kopf, er kam aus den Schulden nicht mehr heraus«, meinte Albert.
»Ja, ja die Juden. Sind oftmals Halsabschneider und Wucherer. Das Geld bleibt an ihren Händen kleben«, seufzte Johann, »eigentlich mag ich sie nicht sonderlich.«
»Aber du wohnst doch im Judenviertel«, sagte Albert verwundert.
»Das schon, die Wohnung ist nicht zu teuer und der Hausherr natürlich ein alter Jud, aber sonst soweit in Ordnung. Es gibt solche und solche Juden. Ich habe nur prinzipiell gesprochen. Als Christen müssen wir sie verachten, denn sie haben unsren Herrn Jesus ans Kreuz geschlagen und wer mag sie schon.«
»Aber es sind doch deine Nachbarn«, sagte Albert verwundert. »Wie bekommst du das unter einen Hut?«
»Wie ich dir bereits sagte, es gibt solche und solche. Meine Nachbarn stören mich nicht, sie sind ganz angenehm, haben manchmal komische Bräuche wie am Sabbat, aber sind hilfsbereit und freundlich. Wir grüßen uns und lassen uns weitgehend in Ruhe. Katharina hilft ihnen in ihrer Gutmütigkeit öfters am Sabbat, wenn sie nichts tun dürfen. Und es gibt eben die anderen, Handelsjuden und Lumpen, und dann die Juden, die unseren Jesus gekreuzigt haben. Es gibt halt viele Arten von Juden. Aber wir leben in einer anderen Zeit und außerdem glaube ich auch nicht alles, was der Pastor von der Kanzel erzählt.«
»Lumpen gibt es überall, nicht nur unter den Juden«, bemerkte Albert trocken, »und unter den Priestern gibt es solche und solche, da hast du Recht.«
3. Begegnungen Teil 1
Das Jahr neigte sich dem Ende entgegen. Albert war zufrieden mit sich und seiner Situation. Er fühlte sich wohl bei der Arbeit und in seinem Umfeld, dem Kolping und der Pfarrei St. Johannes. An einem Sonntag gegen Ende November besuchte er wie immer das Hochamt. Nach der Messe betete er noch still und ging hernach zum Ausgang. Wilhelm Schello holte ihn ein und beide betraten den Kirchenvorplatz. Sie grüßten die noch verbliebenen Kirchenbesucher. Wilhelm zeigte auf ein junges Ehepaar und meinte:
»Albert schau, dass ist das Ehepaar Trotz. Er wurde anlässlich des Kaiserbesuchs ausgezeichnet. Hast du das nicht in der Zeitung gelesen, liest doch sonst alles. Ein junger Postchorsänger durfte dem Kaiser zweimal die Hand schütteln. Das da vorne ist er.«
»So«? meinte Albert, »dem Kaiser die Hand geschüttelt, ist ja doll.«
»Eben«, meinte Wilhelm und beide lüfteten ihre Hüte und grüßten das junge Paar, als sie an ihnen vorbeigingen. Michael grüßte höflich zurück, in dem auch er den Hut zog, Anna lächelte hoheitsvoll und erwiderte den Gruß.
»Wer ist das neben Herrn Schello?« fragte sie.
»Ein junger Schreiner, der in der Kirche arbeitet und aushilft. Ein armer Wandergeselle, der glaube ich im Kolpinghaus wohnt.« Dabei schaute er hoheitsvoll geradeaus.
Wilhelm betrat mit Albert seine Wohnung. Der Küster wohnte in einem alten Haus hinter der Kirche. Ein altes, stark verbautes Haus mit zwei Stockwerken, er wohnte im zweiten. Unter ihm Dora, ein Trierer Original und ganz unten eine junge Familie mit Kind. Das Treppenhaus war dunkel und eng, schloss man die Wohnungstüre auf, betrat man doch recht angenehm geschnittene Räume. Sie gingen ins Wohnzimmer und setzten sich aufs Sofa. Roswitha deckte gerade den Tisch, begrüßte beide und meinte, es dauere noch eine halbe Stunde. Dann entschwand sie in die Küche.
Wilhelm nahm aus dem Wohnzimmerschrank zwei kleine Gläschen und schenkte Albert und sich einen guten Cognac ein. Er nahm sich eine Zigarre und begann zu rauchen. Sie stießen miteinander an.
»Hast du den Kaiser bei seinem Besuch im Oktober nicht gesehen«, fragte er Albert.
»Nein«, entgegnete dieser, »ich bin kein Freund von ihm, er ist mir gleichgültig. Ein alberner Selbstdarsteller und sein Militär sind mir ebenfalls zuwider. Hast du das in der Zeitung mit Zabern gelesen?«
»Ich verstehe nicht viel von Politik, ich bin in erster Linie Musiker. Außerdem war ich nicht beim Militär wegen meines Beines.«
»Und ich nicht wegen meiner früh verstorbenen Brüder«, ergänzte Albert, »und darüber bin ich nicht traurig. Ich halte den Krieg für ein Unglück und hoffe sehr, dass wir so etwas nicht erleben müssen.«
»Glaubst du, dass es Krieg geben wird?«, fragte Wilhelm erschrocken, »wie kommst du darauf? Nur weil unser Kaiser ein Uniformnarr ist und das Militär viel zu sagen hat.«
»Der Kaiser ist ein naiver Trottel, ein mieser Theaterschmierenkömdiant, sonst nichts. Ich bin nur ein einfacher Schreiner, aber das sehe ich auch, dass alle Staaten um uns herum bis zu den Zähnen bewaffnet sind. Und alle Militärs schießen gerne, ob bei uns oder bei den Franzosen. In Berlin las ich in der Kolpingbücherei in einer Zeitung über eine Frau, die den Friedensnobelpreis bekam. Bertha von Suttner heißt sie. Sie warnt vor einem Vernichtungskrieg, der uns drohen könnte angesichts der aufgerüsteten Staaten.«
»Du liest zu viel Albert«, lächelte Wilhelm, »sieh nicht so schwarz. Wir haben nun schon lange Frieden und das wird sicher so bleiben, vielleicht einige Scharmützel, aber nichts Großes. Jedenfalls hoffe ich das.«
»Wollen wir es hoffen und dafür beten.«