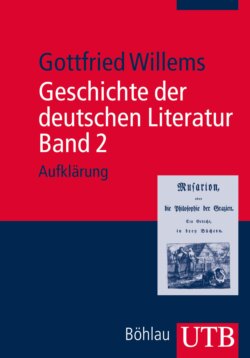Читать книгу Geschichte der deutschen Literatur. Band 2 - Gottfried Willems - Страница 8
1.2 Modernisierung im 18. Jahrhundert: Aufklärung
ОглавлениеAufklärung als Modernisierung
Was man im Rückblick auf das 18. Jahrhundert Aufklärung genannt hat, war eine große geschichtliche Bewegung, die sich eine Reform aller menschlichen Dinge auf die Fahnen geschrieben hatte, eine Reform der gesamten Kultur von den Formen, in denen sich das menschliche Denken und Wissen organisiert, über die Strukturen, in denen der Einzelne lebt, arbeitet und sich mit anderen austauscht, bis hin zur Organisation der Gesellschaft als ganzer, und die damit in der Tat nach und nach alle Bezirke des menschlichen Lebens erreichte und durchdrang.
Vorangetrieben wurde sie von einer durchaus überschaubaren gesellschaftlichen Gruppe, die sich eben damals neu formierte und die man heute die Intellektuellen nennt. Sie selbst und ihre Zeitgenossen hatten für sie allerdings noch einen anderen Namen; sie sprachen von ihr als von den „Philosophen“. Wie ihre Vorgänger, die frühneuzeitlichen Zirkel gelehrter Humanisten, war die Gruppe der „Philosophen“ bereits bestens vernetzt, standen alle, die ihr angehörten, in einem Austausch, der so eng und intensiv war, wie ihn die Verkehrsformen der Zeit nur irgend zuließen. Anders als die Humanistenzirkel bestand sie freilich nicht nur aus der Elite der Gelehrsamkeit, aus Theologen, Philosophen, Philologen und anderen Vertretern einer gelehrten Bildung, sondern auch aus interessierten Laien, aus Literaten, Publizisten, Pädagogen, höheren Beamten und all den anderen „Standespersonen“, die sich die Bildung der Bevölkerung und die Entwicklung der Gesellschaft zur Aufgabe machten. Die Intellektuellen haben die Aufklärung gemacht, und die Aufklärung hat die Intellektuellen gemacht.
Diese „Philosophen“ haben nun eben nach und nach den Begriff der Moderne entwickelt, von dem aus sich unsere heutige Gesellschaft als moderne Gesellschaft definiert. Was aber heißt modern? Von Modernität sprechen wir immer dann, wenn etwas Altes, Herkömmliches, Überliefertes, Traditionelles, Altgewohntes durch etwas Neues ersetzt worden ist, wenn an ihm ein Akt der Modernisierung vorgenommen worden ist, in dem Bestreben, mit dem Anspruch, die Sache besser zu machen als vorher, einen Fortschritt zu erzielen. Das setzt natürlich voraus, daß man zuvor einen kritischen Blick auf das Alte, Herkömmliche, Überlieferte, Traditionelle, Altgewohnte geworfen
[<< 12]
hat, einen Blick, dem es sich eben als veraltet, überholt und überholungsbedürftig, als verbesserungsbedürftig darstellt. Nichts kann eine Gesellschaft wie die unsere deutlicher als eine moderne Gesellschaft kennzeichnen, als daß sie alles Alte immer schon unter den Generalverdacht stellt, veraltet zu sein und der Modernisierung zu bedürfen.
Entwicklung eines kritischen Verhältnisses zur Überlieferung
So weit, so modernisierungsfreudig, so fortgeschritten und fortschrittsversessen waren die Aufklärer des 18. Jahrhunderts freilich noch nicht. Aber sie haben nach und nach ein Klima geschaffen, in dem es zunächst überhaupt möglich und dann auch üblich wurde, sich kritisch mit Überlieferung und Tradition zu beschäftigen, und in dem so der Weg hin zu Neuem freigemacht wurde, in dem der Begriff modern insofern einen positiven Klang bekam. Aufklärung bedeutet im 18. Jahrhundert zunächst und vor allem: Entwicklung eines kritischen Verhältnisses zur Überlieferung, Emanzipation von der Autorität der Tradition. Das kann man schon äußerlich daran erkennen, daß das Wort „kritisch“ ein Lieblingswort aller Aufklärer gewesen ist.
Eines der wichtigsten Dokumente der frühen Aufklärung ist der „Dictionnaire historique et critique“ (1697), das Historisch-kritische Lexikon des Franzosen Pierre Bayle (1647 –1706), ein Werk, das im 18. Jahrhundert mehrfach ins Deutsche übersetzt worden ist – unter anderem von Gottsched, unter Beteiligung seiner Frau und des jungen Gellert – und das überall in Europa, oder jedenfalls doch in allen Ländern, die von der Aufklärung erreicht worden sind, zu einem Grundbuch der Bildung geworden ist, ein Werk, das sich im Bücherschrank eines jeden fand, der an der Aufklärungsbewegung teilhatte, bis hin zum Vater von Goethe. Da werden mit der Systematik eines Lexikons die Bestände der kulturgeschichtlichen Überlieferung zunächst historisch gesichtet und sodann kritisch auseinandergenommen: historisch-kritisches Lexikon. Solche Kritik will aufdecken, was an der Tradition bloß schlechte Gewohnheit, bloß Meinung, Aberglauben und Vorurteil ist. Der Aufklärer streitet mit seiner Kritik gegen das, was er Meinung, Aberglauben und Vorurteil nennt.
Es wurden damals übrigens auch Lehrbücher der Poesie geschrieben, denen der Name einer Critischen Dichtkunst gegeben wurde, unter anderem von Gottsched (1730) und Johann Jakob Breitinger (1740). Unter diesem Titel versuchten die Autoren eben mit all dem aufzuräumen, was für sie bloße Meinungen und Vorurteile in Sachen
[<< 13]
Literatur waren. Und dieser Kritizismus kulminierte in den großen Kritiken des Philosophen Immanuel Kant: „Kritik der reinen Vernunft“ (1781), „Kritik der praktischen Vernunft“ (1788), „Kritik der Urteilskraft“ (1790). Da wird die Kritik ins Prinzipielle gewendet, nämlich auf die kritisierende Vernunft selbst bezogen, als Selbstkritik der kritisierenden Vernunft.
Glaubst du denn: von Mund zu Ohr
Sei ein redlicher Gewinst?
Überliefrung, o du Tor,
Ist auch wohl ein Hirngespinst!
Nun geht erst das Urteil an.
Dich vermag aus Glaubensketten
Der Verstand allein zu retten,
Dem du schon Verzicht getan. (HA 2, 48 –49)
So klingt das alles bei Goethe. Goethe ist ein in der Wolle gefärbter Aufklärer gewesen, und er ist es geblieben bis ins hohe Alter, und das heißt: bis weit ins 19. Jahrhundert hinein; es handelt sich bei den zitierten Versen nämlich um ein Gedicht aus einem seiner Alterswerke, dem lyrischen Zyklus „West-östlicher Divan“ von 1819. Überlieferung, so wird da gesagt, ist immer eine problematische Sache; worauf es ankommt, ist, nicht fraglos auf dem Weg der Anpassung in die Überlieferung einzurücken, sondern das eigene kritische Urteil zu bemühen, das Wagnis und die Arbeit des Selbst-Urteilens auf sich zu nehmen. sapere aude, wage zu wissen, lautet demgemäß ein immer wieder beschworenes Motto der Aufklärung; an seiner Stelle und in ähnlicher Funktion trifft man auch häufig auf ein Diktum von Horaz: nil admirari, nichts (unbesehen) bewundern.
Säkularisation und „Querelle des Anciens et des Modernes“
Aufklärung als Entwicklung eines kritischen Verhältnisses zur Überlieferung, als Emanzipation von der Autorität der Tradition. Wenn wir verstehen wollen, was das im 18. Jahrhundert konkret bedeutet hat, dann müssen wir uns vergegenwärtigen, was seinerzeit die wichtigsten Mächte der Tradition waren, die gegenüber den Menschen ihre Autorität zur Geltung brachten, autoritativ in das Leben der Menschen hineinwirkten, und auf welche Weise, mit welchen Mitteln sie das
[<< 14]
taten. Es handelt sich dabei vor allem um zwei große Überlieferungskomplexe: das Erbe des Christentums, wie es die Basis für die Autorität der verschiedenen Kirchen und Theologien war, und das Erbe der Antike, wie es vom frühneuzeitlichen Humanismus in allen Belangen des kulturellen Lebens autoritativ zur Geltung gebracht worden war.
Die frühe Neuzeit, das 16. und 17. Jahrhundert, hatten ja die Reformation und die Renaissance gesehen, und das heißt: sie hatten zum einen im Streit der Konfessionen einen neuen Schub an Religiosität erlebt, der alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens durchdrang; und zum andern hatten sie erlebt, daß der Humanismus die Quellen des antiken Erbes neu erschlossen und die Kultur der Antike, die Philosophie und Wissenschaft, Kunst und Literatur der alten Griechen und Römer zur Basis aller Bildung und Kultur, zum Maß aller Dinge gemacht hatte. Beides wurde nun im Zuge der Aufklärung zum Gegenstand einer kritischen Auseinandersetzung. So ist das 18. Jahrhundert, was die Religion anbelangt, zur Zeit einer fortschreitenden Säkularisation geworden und, was das Erbe der Antike anbelangt, zur Zeit eines Streits um die Vorbildlichkeit der antiken Kultur, der „Querelle des Anciens et des Modernes“, eines Dauerdisputs zwischen denen, die die antiken Vorbilder für unübertrefflich hielten, und denen, die demgegenüber das Eigenrecht und die besonderen Qualitäten des Modernen zur Geltung zu bringen suchten.1
Undogmatische Religiosität, freier Umgang mit dem Erbe der Antike
Säkularisation, „Querelle des Anciens et des Modernes“ – das heißt allerdings nicht, daß die Aufklärer nun gar nichts mehr mit Religion und Antike zu tun haben wollten. Das Gegenteil ist richtig. Was die Religion anbelangt, so verstanden sich die meisten Aufklärer durchaus noch als religiöse Menschen, glaubten sie noch an einen Gott oder an etwas Göttliches, schon allein deshalb, weil sie sich nicht vorstellen konnten, daß man Moral, Ethik, ja das Soziale überhaupt, das schiedlich-friedliche Zusammenleben der Menschen, anders als religiös begründen könnte. Allerdings taten sie das vielfach dann nicht
[<< 15]
mehr in den überkommenen kirchlichen, theologisch-dogmatischen Formen; sie machten sich ihre eigenen undogmatischen Gottesbegriffe, ihre eigenen undogmatischen Vorstellungen von einem Leben in Gott und einem ethisch begründeten sozialen Leben, sei es als Deisten, Theisten, Pantheisten oder Panentheisten. Nur wenige gingen auch darüber noch hinaus und versuchten es mit dem Atheismus, etwa mit materialistischen Positionen; immerhin hat das 18. Jahrhundert auch den Frühmaterialismus gesehen.
Und was das Erbe der Antike anbelangt, so sind die Aufklärer allesamt zunächst einmal klassische Humanisten gewesen, mehr oder weniger gelehrte Kenner der Antike. Es gibt kaum einen Autor im 18. Jahrhundert, der nicht die Dichter der alten Griechen und Römer von Homer bis Vergil, von Sophokles bis Seneca und von Pindar bis Horaz gründlich kannte und dem deren Werke bei der Arbeit nicht ständig als Vorbilder oder Gegenbilder vor Augen standen. So ist es ja noch am Ende des Jahrhunderts, bei Goethe und Schiller, oder bei Hölderlin. Aber man begriff diese Vorbilder, diese Muster immer weniger als verbindliche Autoritäten. Auch wenn man vieles an ihren Werken immer noch bewunderte, ging man doch immer freier mit ihnen um, benutzte man sie mehr und mehr als Gegenbilder, denen man etwas anderes, etwas spezifisch Modernes gegenüberstellen wollte, und mancherorts hat man sich auch vollständig von ihnen zu lösen versucht.
Also eine fortschreitende Säkularisation, eine permanente „Querelle des Anciens et des Modernes“, aber keineswegs so, daß man das christliche und das antike Erbe gänzlich aus dem Blick hätte entfernen wollen. Man wollte sich nicht von diesen Überlieferungen, sondern nur von ihrer Autorität lösen, von den autoritativen, bindenden Ansprüchen, die damit in der frühen Neuzeit verknüpft waren. Zu einer programmatischen Absage nicht nur an die autoritativen Ansprüche von Tradition, sondern an die Tradition selbst und an das Tradierte überhaupt kommt es erst am Ende des 19. Jahrhunderts, an der Schwelle zur Moderne im engeren Sinne, bei den ersten programmatischen Avantgardisten; derlei findet sich im 18. Jahrhundert noch kaum.
Kritik an der „Schrift“
Was die Aufklärer dementsprechend vor allem kritisieren, ist die Form, in der das christliche Erbe und das antike Erbe ihre Autorität zur Geltung bringen, sind Buchgelehrsamkeit und Schriftgläubigkeit.
[<< 16]
Die christliche Religion fußt ja auf einem Buch, auf der Bibel, der „Heiligen Schrift“; diese soll alles Wesentliche und Wahre enthalten, so daß hier eine Schriftkenntnis und Schriftgläubigkeit, die von Schriftgelehrten verwaltet wird, zur Basis des religiösen Lebens geworden ist. Hinzu treten in der christlichen Tradition weitere altehrwürdige Bücher, vor allem die Schriften der Kirchenväter, die „Patristik“. In eben dieser Haltung haben sich die frühmodernen Humanisten, die ja zunächst einmal Christen und insofern Kinder einer schriftgläubigen Kultur waren, dann auch dem Erbe der Antike genähert. Der Antike wollten sie vor allem in den Schriften begegnen, die sich von ihr erhalten hatten, und diese Schriften hatten für sie einen ähnlichen Stellenwert, eine ähnliche Autorität wie die Bibel und die Kirchenväter, so daß sie die Kultur der Antike, die Wissenschaft und die Kunst, um nicht zu sagen: den Geist der Antike als Buchgelehrte, als Schriftgelehrte, als Philologen in den Formen der Schriftkenntnis und der Schriftgläubigkeit meinten haben zu können.
Dagegen machen die Aufklärer Front, so sehr sie selbst als Intellektuelle auch mit Büchern leben, selbst immerzu mit Lesen und Schreiben beschäftigt sind. Was die Aufklärer des 18. Jahrhunderts von den christlichen Theologen und den Humanisten des 16. und 17. Jahrhunderts vor allem trennt, ist ihre Absage an Buchgelehrsamkeit und Schriftgläubigkeit. Bücher sind für sie nur Hilfsmittel; worauf es ihnen vor allem ankommt, ist das, was im wirklichen Leben geschieht, oder, wie sie selbst lieber sagen, was in der „lebendigen Natur“ vor sich geht, was „natürlich“ ist. In dem berühmtesten Werk von Lessing, dem „dramatischen Gedicht“ „Nathan der Weise“, von dem hier noch ausführlich die Rede sein soll, heißt es einmal von Nathan, daß er „die kalte Buchgelehrsamkeit“ nicht liebe, „die sich mit toten Zeichen ins Gehirn nur drückt“ (LN V, 382 –385); das ist typisch. Demgemäß suchen die Aufklärer Gott weniger in der Bibel als in der „lebendigen Natur“ und suchen sie Wissenschaft und Kunst weniger in den Schriften der Alten als in eben dieser Natur.
Die Kritik an der Buchgelehrsamkeit und am Buchgelehrten ist gerade für die Literatur ein dankbares Feld gewesen. Es gibt kaum ein Werk von Bedeutung im 18. Jahrhundert, das nicht an irgendeiner Stelle zur Gelehrtensatire wird und sich über die Verstiegenheit
[<< 17]
und Weltfremdheit des bloßen Buchgelehrten lustig macht.2 Damit setzt man sich von der Literatur der frühen Neuzeit ab, die, jedenfalls soweit sie vom Humanismus geprägt war, eine gelehrte Dichtung, eine Gelehrtendichtung war, ja deren literarische Texte oftmals mit Fußnoten und Quellenbelegen versehen sind wie eine wissenschaftliche Abhandlung. Auch wenn die Aufklärer von ihrem Bildungsgang her gelehrte Humanisten sind, wollen sie doch keine Gelehrtendichtung mehr fabrizieren, wollen sie anders schreiben, „natürlicher“ schreiben, und das machen sie eben mit den Mitteln der Gelehrtensatire deutlich. Wie die Humanisten einen Kampf gegen die Unbildung geführt haben, so kämpfen die Aufklärer nun gegen die Überbildung.
Abkehr vom Rationalismus,„Naturalismus“
Damit ist ein weiteres wichtiges Stichwort gefallen: Natur. Keinen Begriff haben die Aufklärer häufiger im Mund geführt als den der Natur. Er ist für sie wichtiger als der Begriff, der von den Nachgeborenen bis heute vor allem mit ihren Bestrebungen verknüpft wird, als der Begriff der Vernunft. Von den ersten Kritikern der Aufklärung bis in die heutige Wissenschaft hinein, bis hin zur modernen Literaturgeschichtsschreibung hat sich ja die Vorstellung festgesetzt, die Aufklärung habe eine Art Kult der Vernunft, der „ratio“ veranstaltet, sie habe einem selbstherrlichen Rationalismus, einem „Logozentrismus“ gehuldigt, sie habe sich der Vernunft geradezu im Sinne einer „Totalitätsobsession“ verschrieben gehabt. Die Aufklärer hätten geglaubt, daß die menschliche ratio alles erklären und alles regeln, alles in den Griff bekommen könne, von der Natur über die Gesellschaft bis hin zum Leben des Einzelnen.
Unterwerfung der Natur, Unterwerfung der natürlichen Triebe des Menschen unter die ratio, ein rational kontrolliertes Leben, ein rational veranstalteter Fortschritt, und in diesem Sinne Vervollkommnung des Einzelnen wie der Gesellschaft, „Perfektibilität“, Fortschritts- und Geschichtsoptimismus – das sind bis heute beliebte Stichworte, wo es um die Aufklärung geht.3 Von der ratio her habe man am Glück der Menschheit arbeiten wollen, an allen Abgründen des Menschen
[<< 18]
und allen Abgründen der Geschichte vorbei. So kann man es etwa in der „Dialektik der Aufklärung“ (1947) von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno lesen, und bei ihnen hat sich gerade die Germanistik in den letzten Jahrzehnten immer wieder über das 18. Jahrhundert belehren wollen.
Aber Adorno und Horkheimer haben nur wenig vom 18. Jahrhundert verstanden; sie sprechen, wo sie die Aufklärung in den Blick nehmen, im Grunde von der positivistischen Wissenschaftskultur des 19. Jahrhunderts. Die Aufklärer des 18. Jahrhunderts waren weniger Rationalisten als vielmehr „Naturalisten“. Wenn sie denn überhaupt einen Kult betrieben haben, dann war das ein Kult der Natur und kein Kult der Vernunft. Wo immer sie zur Sache kommen, wo immer sie auf das zu sprechen kommen, was für sie das Wesentliche ist, da erscheint in ihren Texten an zentraler Stelle der Begriff der Natur, und auch wo es nicht um Wesentliches geht, bei allem und jedem heißt es bei ihnen: Natur, Natur, Natur!4 So haben sie sich zum Beispiel in der Theologie um natürliche Gottesbegriffe bemüht, in der Philosophie um die allgemeine Menschennatur und um eine natürliche Ethik, in der Wissenschaft um die Naturerkenntnis, im staatlichen Leben um die Geltung des Naturrechts, und in der Kunst und Literatur um das Prinzip der Naturnachahmung, der imitatio naturae, der mimesis. Die Dichtung sollte nun weniger Kunst sein – Kunst im Sinne von Künstlichkeit – als vielmehr etwas Natürliches, sie sollte irgendwie „Naturpoesie“ sein.
Und die Natur steht für die Aufklärer eben über der menschlichen Vernunft, sie übersteigt für sie immer schon die Möglichkeiten der Vernunft. In diesem Sinne haben sie durch das ganze 18. Jahrhundert hindurch an einer Kritik der Vernunft gearbeitet, wie sie Kant dann gegen Ende des Jahrhunderts in seinen großen Kritiken zusammenfaßt, haben sie sich überall darum bemüht, der Vernunft ihre Grenzen aufzuzeigen, zumal dort, wo sie sich zu großen „Systemen“ versteigt, die das Ganze der Welt erklären wollen.5 „The most ingenious way of
[<< 19]
becoming foolish, is by a system“, heißt es schon bei dem frühen Aufklärer Shaftesbury,6 und noch Goethe warnt davor, die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Natur „zu einer systematischen Form“ zu treiben (HA 13, 20). Die Natur soll der Vernunft zwar zugänglich sein, insofern sie nach Gesetzen funktioniert, die der Verstand einsehen kann, aber sie soll zugleich über alles hinausreichen, was die Vernunft sich jemals wird denken können. So daß für den Menschen der richtige Weg nur sein kann, der Natur zu folgen, auf sie zu hören, sich an sie anzuschließen, sich mit seinem Leben und Denken in sie einzupassen: vivere secundum naturam; in Worten eines anderen frühen Aufklärers, Alexander Pope: „Take Nature’s path, and mad Opinion’s leave“ (PE IV, 29), in Worten des deutschen Autors Wieland: „Laßt uns (…) der Natur folgen; einer Führerin, die uns unmöglich irre führen kann“.7 Wer sich die Natur allen Ernstes würde unterwerfen, sie theoretisch und praktisch würde beherrschen wollen, der würde unweigerlich bei Krampf und Gewalt enden. Das ist Aufklärung.
Aufklärung als Verbindung von „Kritizismus“ und „Naturalismus“
Wir haben also nun ein zweites Lieblingswort der Aufklärer neben dem Wörtchen „kritisch“, das Prädikat „natürlich“, und eine zweite Maxime neben der, die in den Dikta „sapere aude“ und „nil admirari“ zum Ausdruck kommt, die Maxime „vivere secundum naturam“. Es ist ein sicheres Indiz dafür, daß man einen Text der Aufklärung vor sich hat, wenn man auf die Kombination der beiden Prädikate „kritisch“ und „natürlich“ trifft, nicht weniger sicher, als wenn man auf Begriffsoppositionen wie Natur versus Meinung, Natur versus Vorurteil oder Natur versus Aberglauben trifft.
Die Aufklärer sind zunächst einmal kritische Menschen; sie nehmen das, was ihnen überliefert ist, nicht einfach unkritisch hin, wollen die Überlieferung kritisch durchleuchten. Die Basis ihrer Kritik, das Fundament, von dem aus sie das Überlieferte ins Auge fassen, um es gegebenenfalls als schlechte Gewohnheit, als bloße Meinung, als Vorurteil und Aberglauben abzuqualifizieren, ist vor allem das, was sie Natur
[<< 20]
nennen; sie stellen sich auf den Boden der Natur. Was aber heißt: auf dem Boden der Natur? Es heißt: auf dem Boden der Erfahrung. Natur ist, was man erfahren kann, was man sinnlich wahrnehmen, sehen, hören, riechen, schmecken, ertasten, erfühlen, erleben kann, und dann mit seinem Verstand verarbeiten und mit seinem Gedächtnis festhalten; Erfahrung ist, was man sich in der Auseinandersetzung mit der Natur erwirbt. Kritik an der Überlieferung heißt hier mithin, das Überlieferte auf den Prüfstand der Erfahrung stellen, und das wiederum heißt: auf den Prüfstand der Natur; und dabei kann es sich dann eben als wahr oder falsch erweisen. Die erste, wichtigste Quelle des Wissens ist für die Aufklärer anders als für die Humanisten nicht mehr das, was in altehrwürdigen Büchern steht, sondern die Erfahrung.
Individualisierung und Geniekult
Mit diesen Begriffen von Natur und Erfahrung ist ein weiterer Begriff eng verknüpft, der der Emanzipation. Mit Emanzipation ist hier der Weg des einzelnen Menschen, des Individuums weg von der Bindung an Autoritäten, Traditionen und Konventionen hin zu einem offenen Raum gemeint, in dem er ein Leben nach eigener Wahl, ein selbständiges, selbstbestimmtes Leben führen kann. Zu einer Erfahrung gehört ja immer ein Mensch, der sie macht, ein Individuum als Subjekt dieser Erfahrung, ein Ich, dem die betreffende Erfahrung zuteil wird. Da muß ein Subjekt sein, das wahrnimmt, sieht, hört, fühlt, erlebt, das sich etwas dabei denkt, das das Wahrgenommene und Bedachte als richtig und wichtig, wahr und sinnvoll bewertet, das es in seinem Gedächtnis abspeichert und gegenüber anderen für es eintritt – ohne Subjekt keine Erfahrung. In dem Maße nun, in dem die Erfahrung wichtiger wird als die Überlieferung, wenn nicht gar zum Maß aller Dinge, vollzieht sich zugleich eine Aufwertung des Individuums als des unentbehrlichen Trägers des Erfahrungmachens, und damit eine Aufwertung alles Individuellen. Mit der Abkehr von der Autorität der Überlieferung im Setzen auf die Natur und die Erfahrung geht die Emanzipation des Individuums Hand in Hand. So ist das 18. Jahrhundert auch das Jahrhundert gewesen, in dem der moderne Individualismus erstmals sein Haupt erhoben hat. In Worten Wielands: die „Natur (…) will, daß ein jeder Mensch seine eigene Person spiele“.8
[<< 21]
Ein zentraler Schauplatz für die Erkundung der neuen Bedeutung des Individuums ist das Nachdenken über das Genie gewesen. Durch das ganze 18. Jahrhundert hindurch hat man sich immer wieder mit dem Begriff des „Originalgenies“ auseinandergesetzt, so sehr, daß eine bestimmte Phase der literarischen Entwicklung in Deutschland, die Phase des „Sturm und Drang“, auch „Geniezeit“ genannt werden konnte.9 Aber der Begriff des Genies ist hier nicht nur ein Thema der Kunst; letztlich bezeichnet er einen entscheidenden Zugang zu dem neuen Bild vom Menschen, das die Aufklärung entworfen hat, zu ihrer Anthropologie. Das Genie ist das große Paradigma des neuen Individualismus. An ihm wird studiert, welche Dimensionen die Eigenart und die Bedeutung des Individuums annehmen kann; das zeigt eben der Bestandteil Original im Begriff des Originalgenies. Die Taten des Genies lassen erkennen, in welchem Maße sich die Erfahrungen, in denen dem Menschen seine Welt aufgeht, der Individualität und Subjektivität dessen verdanken, der da Erfahrungen macht und von ihnen Zeugnis ablegt.
Naturrecht vs. Ständegesellschaft
Die Emanzipation des Individuums hat natürlich immer auch eine politisch-gesellschaftliche Seite. Das macht uns darauf aufmerksam, daß sich die Aufklärung bei ihrer kritischen Prüfung der Tradition im Rückgang auf Erfahrung und Natur noch mit einer dritten großen Macht der Überlieferung neben dem Erbe des Christentums und dem Erbe der Antike beschäftigt hat: mit der Gesellschaftsordnung, und das heißt seinerzeit: mit einer feudal-ständischen Ordnung. Denn die Gesellschaft war im 18. Jahrhundert noch immer eine Ständegesellschaft, wie sie letztlich auf das mittelalterliche Feudalwesen zurückgeht, eine Gesellschaft mit einem Fürsten, einem Monarchen an der Spitze und mit den Ständen des hohen und niederen Adels, des hohen und niederen Klerus, des patrizischen Stadtbürgertums, der Handwerker und der Bauern darunter, mit Ständen, die jeweils besondere Rechte, besondere Privilegien genossen, deren Mitglieder also nicht gleich waren vor dem Gesetz und demgemäß im staatlich-politischen Leben unterschiedliche Rollen zu spielen, unterschiedliche Funktionen wahrzunehmen hatten. Diese Ordnung und diese Privilegien rechtfertigten sich ebenfalls mit
[<< 22]
der Autorität der Überlieferung. Die Ordnung sollte legitim sein, weil sie eine altehrwürdige und alterprobte Ordnung war, die Privilegien sollten legitim sein, weil sie ererbte Rechte waren.
Auch hier stellten die Aufklärer die kritische Frage: ist diese traditionelle Ordnung, sind diese überkommenen Privilegien, so alt sie auch immer sein mögen, natürlich? Will sagen: entsprechen sie der Natur des Menschen? Also auch hier haben die Aufklärer nach der Natur gefragt, nämlich nach den natürlichen Rechten des Menschen, nach dem „Naturrecht“, den „Menschenrechten“, danach, wie Gesellschaft wohl von Natur aus gemeint sei, nach dem, was sie den „Naturzustand“ nannten. Sind die Menschen nicht von Natur aus frei und gleich? Und wie müßte eine Gesellschaft aussehen, die solcher Freiheit und Gleichheit gerecht würde? Derartige Überlegungen haben dann die Entwicklungen in Gang gebracht, die am Ende des Jahrhunderts zur Französischen Revolution geführt haben, und damit zu unserer modernen Staats- und Gesellschaftsordnung.
Kritik an der Ständeordnung kam übrigens nicht nur aus jenen bürgerlichen Kreisen, die sich als unterprivilegiert verstehen konnten, wie die Aufklärung überhaupt nicht bloß eine Sache des Bürgertums oder überhaupt eine bürgerliche Sache gewesen ist. Das ist leider noch immer in den meisten Literaturgeschichten zu lesen, wo es um das 18. Jahrhundert geht. Aber es ist nicht richtig. Die Aufklärung war eine Sache, zu der sich Zirkel gebildeter Adliger und Bürger zusammenfanden.10 Da wurde keineswegs in erster Linie das Selbstbewußtsein eines Standes, das Selbstbewußtsein des Bürgertums, kultiviert, sondern es ging um ein Zusammenfinden jenseits der Standesgrenzen. Die Aufklärung läßt sich noch nicht einmal auf jene Schicht festlegen, die Lessing den „Mittelstand“ nennt,11 also den niederen Adel und das gehobene Bürgertum. Könige wie Friedrich II. von Preußen und Lords wie Shaftesbury haben daran ebenso ihren Anteil gehabt wie Handwerkersöhne vom Schlage Rousseaus. Davon wird noch zu reden sein.
[<< 23]
Aufklärung und Öffentlichkeit
Ein letzter Punkt. Wenn wir fragen: was ist der Ort, an dem die Aufklärer, die „Philosophen“ dieses ihr kritisches Geschäft betreiben? dann treffen wir auf eine neue Einrichtung, mit der sich recht eigentlich die moderne Öffentlichkeit etabliert hat, nämlich auf ein Zeitschriftenwesen, das es vorher so noch nicht gab. Wichtig sind natürlich weiterhin die Kommunikationsräume, die sich der frühmoderne Humanismus geschaffen hat, etwa die gebildeten Freundeszirkel in den Städten, an den Fürstenhöfen und an den Universitäten. Und da hat es natürlich auch schon so etwas wie eine Öffentlichkeit gegeben, die offenen Räume des Markts und der Kirche, des Hofs, der Aula, des Theaters. Aber hier hat Öffentlichkeit immer nur die umfassen können, die körperlich anwesend waren; das, was man ein „Präsenzpublikum“ nennt. Weiter, hin zu einem über Raum und Zeit zerstreuten „dispersen Massenpublikum“ hat hier allenfalls schon das Buchwesen gereicht, aber das ist natürlich, was die Umschlagsgeschwindigkeit von Informationen anbelangt, vergleichweise schwerfällig.
Im 18. Jahrhundert nun entsteht, vor allem dank der Aktivitäten der Aufklärer und ausdrücklich zum Zweck der Ausbreitung aufklärerischer Gedanken, ein neuartiges Zeitschriftenwesen. Das beginnt mit den sogenannten „Moralischen Wochenschriften“ in England, dem Land, wo die Aufklärung zunächst Fahrt aufgenommen hat. Das berühmteste Beispiel ist der „Spectator“ (1711 –1712, 1714) von Joseph Addison und Richard Steele. Dieses Vorbild wird dann bald auf dem Kontinent nachgeahmt, auch im deutschen Sprachraum, so von Johann Jakob Bodmer und Johann Jakob Breitinger in Zürich, wo sie ihre „Discourse der Mahlern“ (1721 –1723) herausgeben, und dann in Hamburg, in Leipzig und anderswo.12 Gegen die Mitte des Jahrhunderts gibt es sogar schon eine ganze Reihe von Zeitschriften – allerdings keine Wochenschriften – die sich bevorzugt mit Kunst und Literatur befassen, freilich immer im Rahmen der breiten Themenpalette der Aufklärung. Sie heißen etwa „Briefe, die neueste Literatur betreffend“, oder „Allgemeine Bibliothek der schönen Wissenschaften und Künste“. Lessing hat eine zeitlang als Redakteur solcher Zeitschriften gearbeitet.
[<< 24]
Wieland gab nach dem Vorbild der führenden französischen Zeitschrift, des „Mercure de France“, eine eigene Zeitschrift heraus, die zu einer Art Zentralorgan der deutschen Spätaufklärung wurde und eine zeitlang fast alle Gebildeten in Deutschland erreichte, den „Teutschen Merkur“ (1773 –1810). Zeitschriften wie diese bilden neben dem Buchwesen die wichtigste Plattform der Aufklärung. In ihnen wird über alles diskutiert, was ein aufgeklärtes Publikum interessiert, unter reger Anteilnahme dieses Publikums. Nicht zuletzt wird hier auch über Fragen der Pressefreiheit gestritten, denn es gibt seinerzeit natürlich weithin noch immer eine Zensur, die der Diskussionsfreude bald engere und bald weitere Grenzen setzt.