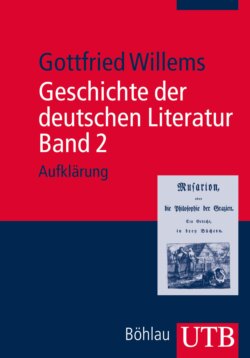Читать книгу Geschichte der deutschen Literatur. Band 2 - Gottfried Willems - Страница 9
1.3 Literatur im 18. Jahrhundert
ОглавлениеFließende Grenzen zwischen Belletristik und Sachbuch
Eine Einführung in die Literatur des 18. Jahrhunderts fragt natürlich in erster Linie nach literarischen Texten. Aber was heißt im 18. Jahrhundert überhaupt Literatur? Der heutige Leser muß sich darauf einstellen, daß die Grenzen zwischen dem, was er aus heutiger Sicht als Literatur bezeichnen mag, und anderen Bereichen der Kultur wie Philosophie, Wissenschaft, Historie und politische Publizistik seinerzeit noch nicht so scharf ausgeprägt waren wie heute. Da wirkt lange Zeit noch die alte Einheit von Wissenschaft und Kunst, von akademischer Gelehrsamkeit und künstlerischer Kreativität, rhetorischem und literarischem Schreiben nach, wie sie der frühmoderne Humanismus pflegte. Die scharfe Grenzziehung zwischen Belletristik und Sachbuch, ästhetischem und non-ästhetischem Schrifttum, fiktionaler und non-fiktionaler Literatur, wie sie bei uns heute üblich ist, ist ein Werk erst des späten 18. Jahrhunderts selbst gewesen, ist hier erst allmählich entwickelt, begründet und durchgesetzt worden.
Daß literarische und non-literarische Formen im 18. Jahrhundert noch sehr viel näher beieinander sind, sieht man schon äußerlich an dem Gesamtwerk vieler Autoren; es gibt noch nicht jene rigide Arbeitsteilung zwischen Theoretikern und Praktikern, jene hohe Spezialisierung der Autoren für bestimmte Fächer, Gattungen und Schreibpraktiken, die für uns heute selbstverständlich ist. So hat zum Beispiel der Franzose Voltaire, eines der Leitfossile der europäischen
[<< 25]
Aufklärung, nicht nur Tragödien, Versepen, Romane, Erzählungen und Oden geschrieben; er war zugleich auch einer der einflußreichsten Philosophen, Historiker, Kritiker und wissenschaftlichen und politischen Publizisten seiner Zeit. Und das sieht man seinen Werken auch an. Die Unterschiede zwischen dem dichterischen, philosophischen, wissenschaftlichen und journalistischen Schreiben sind bei ihm nur graduelle und keine kategorischen.
Und so ist es auch bei den meisten deutschen Aufklärern gewesen, und mit Abstrichen selbst noch bei Goethe und Schiller. Schiller hat ja außer literarischen auch philosophische und historische Werke geschaffen, und Goethe hat auch als Naturphilosoph und Naturwissenschaftler gearbeitet. Diese Praxis des Schreibens kommt erst in der nächsten Generation von Autoren an ihr Ende, der Generation von Hölderlin und Kleist; wenn sie denn Dichter sind, dann sind sie vielfach nichts als Dichter. Aber da befinden wir uns schon an der Grenze zum 19. Jahrhundert. Heute ist ein Autor im Normalfall ausschließlich Verfasser von Literatur oder Kritiker oder Wissenschaftler oder politischer Journalist und hat allenfalls ausnahmsweise einmal einen Gastauftritt in der Domäne des anderen. Auch das Schreiben und Publizieren unterliegt inzwischen weithin jener Arbeitsteilung, jener Spezialisierung, die ein wesentliches Merkmal der modernen Gesellschaft ist.
Es gibt im 18. Jahrhundert noch ganze Gattungen, die diese Situation der fließenden Grenzen bezeugen, so z. B. das Lehrgedicht. Im Lehrgedicht werden Resultate der theoretischen Arbeit, etwa der Philosophie und der Wissenschaft, in dichterischer Form, in einer poetischen Sprache und in Versform niedergelegt. Hinzu kommt, daß die Gattungstrias Epik – Lyrik – Drama als Inbegriff des Kernbereichs der Belletristik seinerzeit noch nicht so ausgeprägt war wie heute; auch die Etablierung dieser Trias ist ein Werk erst des 18. Jahrhunderts gewesen, und zwar des späten 18. Jahrhunderts.13 Und schließlich sind die Übergänge zu pragmatischen Textsorten wie Brief, Tagebuch, Autobi-
[<< 27]
ographie, Reisebericht noch durchaus fließend. So ist z. B. der Autor der berühmtesten und einflußreichsten Romane der Jahrhundertmitte, der Engländer Samuel Richardson (1689 –1761), über das Anlegen eines „Briefstellers“, einer Anleitung zum Schreiben von Briefen mit Hilfe einer Kollektion von Musterbriefen, zum Schriftsteller geworden, und seine Romane sind dann eben Briefromane geworden. Und daß so viele Romane der Epoche Reiseromane sind, ihre Helden auf der Reise zeigen, hängt auch mit der zeitgenössischen Kultur des Reisens und des Reiseberichts zusammen. Man muß also mit einem sehr weiten und offenen Literaturbegriff an das 18. Jahrhundert herangehen, wenn man die Verhältnisse nicht verfälschen will.
Fließende Grenzen zwischen den Sprachräumen
Und auch eine andere Grenze ist bei der Literatur des 18. Jahrhunderts nicht so scharf ausgeprägt wie in anderen Epochen, die Grenze zwischen den Sprachräumen. Die Aufklärung ist keine rein deutsche Angelegenheit gewesen, sondern eine Bewegung, die weite Teile Europas erfaßte. Entfaltet hat sie sich zunächst vor allem in England und Schottland, sodann in Frankreich, und von England und Frankreich her kam sie schließlich auch nach Deutschland. Der Aufklärungsdiskurs ist ein Phänomen, das sich über die Grenzen der verschiedenen Sprachräume hinweg im Austausch unterschiedlicher Kulturräume entwickelt hat. Wenn man dem gerecht werden will, muß man komparatistisch arbeiten, darf man sich nicht nur mit deutscher Literatur beschäftigen, muß man über diese deutsche Literatur hinaus zumindest auch die englische und die französische Literatur mit in den Blick nehmen.
Denn es gibt keinen deutschen Vertreter einer aufgeklärt-aufklärerischen Literatur, der sich nicht zumindest mit englischer und französischer Literatur beschäftigt hätte, mit Locke, Shaftesbury, Pope und Hume, mit Bayle, Voltaire, Montesquieu, Diderot und Rousseau, keinen, dessen Werk man demzufolge sachgerecht analysieren könnte, ohne die englischen und französischen Einflüsse mit zu bedenken. Bis heute ist es ein Krebsschaden der deutschen Literaturgeschichtsschreibung, daß sie den Einfluß des Auslands im 19. Jahrhundert zunächst im Sinne des Gedankens der Nationalliteratur nach Kräften wegdisputiert hat und sich dann nicht konsequent genug um die Korrektur des einmal gezeichneten Bildes vom Entwicklungsgang der deutschen Literatur bemüht hat, nicht wirklich aus den einmal gelegten Geleisen der
[<< 27]
Literaturgeschichtsschreibung herausgefunden hat. Hier soll mit dem germanistischen Idiotismus der deutschen Nabelschau nach Kräften Schluß gemacht werden. Demgemäß wird im folgenden auch immer wieder von englischen und französischen Autoren gehandelt werden, eben von all dem, was man braucht, um die Aufklärung als ganzes in den Blick zu bekommen und die deutschen Entwicklungen auf angemessene Weise nachzuzeichnen.
[<< 28]
1 Hans Robert Jauß: Ästhetische Normen und geschichtliche Reflexion in der Querelle des Anciens et des Modernes. In: Charles Perrault: Parallèle des anciens et des modernes (…). München 1964, S. 8 –64. – Peter K. Kapitza: Ein bürgerlicher Krieg in der gelehrten Welt. Zur Geschichte der Querelle des Anciens et des Modernes in Deutschland. München 1981.
2 Beispiele bei Alexander Kosenina: Der gelehrte Narr. Gelehrtensatire seit der Aufklärung. Göttingen 2003.
3 Diese Vorstellungen bestimmen z. B. noch die Darstellung der Epoche in Hansers Sozialgeschichte der Literatur und bei Gerhard Kaiser (s. Literaturhinweise).
4 Zur „zentralen Rolle des Naturbegriffs“ s. Panajotis Kondylis: Die Aufklärung im Rahmen des neuzeitlichen Rationalismus. München 1986, S. 342 –356.
5 Roy Porter: Kleine Geschichte der Aufklärung. Berlin 1991, S. 9 –11. – Kondylis: Aufklärung (Anm. 4), S. 298 –309.
6 Shaftesbury: Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times. Bd. 1. London 1735, S. 290.
7 Wieland: Der goldne Spiegel oder Die Könige von Scheschian. Erster Theil. In: ders.: Sämmtliche Werke. Bd. 6. Leipzig 1794. ND Hamburg 1984, S. 72.
8 Ebenda, S. 142.
9 Jochen Schmidt: Die Geschichte des Geniegedankens 1750 –1945. 2 Bde. Darmstadt 1985.
10 Porter: Aufklärung (Anm. 5), S. 56 –66.
11 Lessing: Abhandlungen von dem weinerlichen oder rührenden Lustspiele. In: ders., Werke. Hrsg. v. Herbert G. Göpfert. Bd. 4. München 1973, S. 12 –58, hier S. 13.
12 Wolfgang Martens: Die Botschaft der Tugend. Die Aufklärung im Spiegel der deutschen Moralischen Wochenschriften. Stuttgart 1971.
13 Stefan Trappen: Gattungspoetik. Studien zur Poetik des 16. bis 18. Jahrhunderts und zur Geschichte der triadischen Gattungslehre. Heidelberg 2001, S. 198 –269.