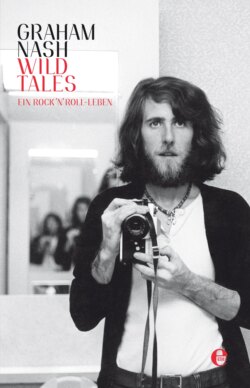Читать книгу Wild Tales - Graham Nash - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. KAPITEL
Оглавление1996 verbrachte ich einige Zeit in Blackpool, einem heruntergekommenen Urlaubsort am Meer, in den Arbeiter aus Nordengland kommen, um sich zu entspannen; auch ich nahm mir hier eine Auszeit. Meine zwei Söhne, Jackson und Will, begleiteten mich, und als wir an einem diesigen Nachmittag die New South Promenade entlangspazierten, machten wir einen Umweg über eine Absteige namens Kimberley Hotel, deren Bewertung im Internet bei zwei einhalb von fünf Sternen liegt – das sagt eigentlich schon alles. Der Portier am Tresen schaute von seiner Zeitschrift auf, als wir uns näherten.
„Ich hätte da mal eine etwas seltsame Frage“, sagte ich.
Mit einer Handbewegung schnitt er mir das Wort ab. „Um die Ecke. Die zwei Treppen runter und dann nach links.“
„Entschuldigung!?“, sagte ich, etwas irritiert. „Woher wissen Sie, was ich fragen wollte?“
„Denken Sie, Sie sind der Einzige?“, fragte er. „Alle, die hierher zurückkommen, stellen genau dieselbe Frage.“
Wir folgten seiner Wegerklärung, und da war sie: die Entbin dungsstation, auf der ich am 2. Februar 1942 um 1:50 Uhr zur Welt kam. Es war alles so, wie ich es mir vorgestellt hatte – ein dunkler, feucht müffelnder, kleiner Bunker, ausgekleidet mit roter Flock-Tapete, die wahrscheinlich noch aus Zeiten von Königin Viktoria stammte. Der fensterlose Raum machte zwar einen düsteren Eindruck, aber zum Teufel, ich hatte froh sein können, überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben.
Ich sollte eigentlich in Salford bei Manchester geboren werden, wo ich dann auch aufwuchs, aber im Jahr 1942 war Manchester als wichtiges Industriezentrum ein ständiges Ziel für Bombenangriffe. Schwangere Frauen wurden an sichere Orte wie Blackpool evakuiert, um dort in relativem Frieden gebären zu können. Und deswegen führte mich mein Weg Jahre später noch einmal zum Kimberley Hotel.
Der Krieg war schon fast vorbei, als ich nach Manchester zurückkam, und er hatte Narben in jeder Straße hinterlassen. Salford, unser Viertel, war ein Schutthaufen. Mindestens zehn Häuser waren weggebombt worden, die Stadt wurde fast jede Nacht angegriffen. Die Straßenzüge waren zerklüftet, riesige Krater zerfurchten die Landschaft. Wir waren in einer brenzligen Lage. Mein Cousin Ray, der in der Nähe wohnte, war unter den Kamin geschleudert worden, als sein Haus bombardiert wurde, und konnte sich nicht befreien; erst vier Tage später wurde er von Arbeitern dort entdeckt. Egal, wohin man schaute: Alles war verwüstet. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn die Deutschen unser Viertel ganz plattgemacht hätten, denn die Lebensbedingungen waren ohnehin furchtbar. Salford war ein Getto, ein Gewirr von Reihenhäusern, die in den späten 1890ern errichtet worden waren, und seitdem war an den Häusern wohl auch nichts mehr verändert worden.
Salford war überhaupt nicht repräsentativ für Manchester; es hatte einen ganz eigenen, entspannten Charakter. Später verstand ich, dass es eins der schlimmsten Slums im Norden oder vielleicht sogar in ganz England war, doch als ich aufwuchs, umgab mich eine zwar arme, aber ehrliche Gemeinschaft. Jeder versuchte, so gut durchzukommen, wie es ging. Es gab kaum Kriminalität, niemand schloss die Haustür ab. Pferdegespanne fuhren die Straßen entlang. Ein paar Leute, Lumpensammler, gingen regelmäßig herum, um alte Kleider gegen ein Zeug einzutauschen, das wir „Brownstones“ nannten – seifenähnliche Blöcke, die man vor der eigenen Haustür auf dem feuchten Bürgersteig verreiben konnte, damit es ein bisschen hübscher aussah und glänzte. Zu bestimmten Anlässen wie der Guy Fawkes Night oder der Krönung von Königin Elisabeth 1952 feierten die Familien gemeinsam auf der Straße. Die Kinder, allesamt Babyboomer, rannten überall herum, und wir dachten überhaupt nicht darüber nach, wie dicht aneinandergepresst wir wohnten.
Die Häuser – hunderte von identischen, zweistöckigen Ziegelgebäuden mit zwei Zimmern oben, zwei Zimmern unten, die Schulter an Schulter standen – waren für irische und schottische Arbeiter errichtet worden, die zu Tausenden nach England gekommen waren, um in den Minen und Mühlen zu arbeiten. In unserer Straße standen dreißig Häuser, und gleich dahinter noch mal dreißig, und so ging es Reihe für Reihe weiter. Klar, es waren Sozialbauten, aber wir benutzten damals einen etwas respektvolleren Begriff: Arbeiterwohnungen.
Wir lebten in der 1 Skinner Street, einem Eckhaus. Nichts Schickes, nicht einmal etwas Bürgerliches; es war eine ziemlich bescheidene Existenz. Zwei Schlafzimmer für uns fünf – meine Eltern, mich und meine zwei jüngeren Schwestern Elaine und Sharon. Ein großes Fenster unten, ein Ausgang nach hinten auf eine schmale Gasse, wo das Klo zu finden war. Kein Badezimmer im Haus zu haben, ist wirklich furchtbar, besonders im Winter, wenn man pinkeln muss und der Nachttopf voll ist. Es gab auch kein heißes Wasser, bis wir Jahre später endlich eine Heizung bekamen. Damals beschränkte sich unsere Welt auf das kleine Salford. Mein Vater war vier Häuser weiter in der 9 Skinner Street aufgewachsen. Meine Tante Olive und Onkel Ben wohnten um die Ecke in der Ada Street, zu meiner Tante Peg und Onkel Jimmy konnte man auch zu Fuß gehen. Es war eine große Familie, die seit Generationen mit dem Ort verwachsen war und wohl auch bleiben würde. Wir alle steckten in diesem riesigen nördlichen Gulag fest. Ich dachte immer, es gäbe kein Entkommen – aber ich greife den Ereignissen vor.
Meine Eltern taten alles, was in ihrer Macht stand, um unser Leben erträglich zu gestalten. Mein Vater, William, war ein richtiger Kerl – er muss an die 120 Kilo gewogen haben, und er war groß, größer als ich es jetzt bin. Aber er war ein sanfter Riese, ein hingebungsvoller Arbeiter, mit zwinkernden Augen und einem unglaublichen Sinn für Humor. Wie die meisten Männer im Norden Englands strengte er sich sehr an, nicht weiter aufzufallen. Er hatte keine dröhnende Stimme, protzte nie herum, war weder eigensinnig noch politisch engagiert. Mein Vater wirkte auf mich in seiner einfachen Art immer würdevoll. Wenn es darauf ankam, konnte er auch hart sein – man legte sich jedenfalls besser nicht mit ihm an. Einmal besuchte er einen meiner Auftritte in einem örtlichen Pub. Allan und ich hatten uns für die Show geschminkt, irgendein Arschloch nannte uns Schwuchteln, und da packte mein Vater diesen Typen am Schlafittchen und setzte ihn vor die Tür. Es war das erste und einzige Mal, dass ich diese Seite an ihm erlebt habe.
Aber so sehr ich meinen Vater auch liebte, wir führten nie ein tieferes Gespräch miteinander. Um die Wahrheit zu sagen, sprachen wir überhaupt kaum miteinander, jedenfalls nicht über Dinge, die von Bedeutung waren. Das war nichts Ungewöhnliches; so war es bei uns zu Hause eben – und wahrscheinlich in vielen anderen Familien auch. Bloß nicht emotional werden. Behalt den Kram mal besser für dich. So war es im Norden. Außerdem ging mein Vater jeden Tag um sieben Uhr zur Arbeit und kam vor sechs Uhr abends nicht zurück. Dann war er erschöpft, trank seinen Tee, ging vielleicht ins King’s Arms, den nächsten Pub, und fiel dann ins Bett, bevor am nächsten Morgen wieder alles von vorne losging. Ich weiß also nicht viel Persönliches über ihn.
Meine Mutter, Mary Gallagher, wuchs in Moss Side auf, einem Viertel gleich neben dem alten Fußballstadion in Manchester. Wie mein Vater hat auch sie ihr ganzes Leben lang unfassbar hart gearbeitet, zuerst in der Buchhaltung einer Molkerei und später in einem Wettbüro. Sie hatte eigene Träume und Ambitionen, große Fantasien von einem glamouröseren Leben, von denen ich erst als Erwachsener erfuhr, aber unsere Lebensumstände machten es unmöglich, diesen Träumen nachzugehen. Der Krieg war gerade vorbei, sie war verheiratet, musste sich um die Familie kümmern, da hatten Träume keinen Platz. Meine Eltern haben ihr Leben lang gekämpft – und sie kamen gerade so über die Runden. Mein Vater
war Techniker bei David Brown Jackson. David Brown war lange Jahre Eigner von Aston Martin, sein Name steckt hinter dem Kürzel DB in der Typenbezeichnung mehrerer Modelle. Sein Betrieb war ein großartiger Ort für einen Sechsjährigen – eine Festung mit riesigen Türen, hinter denen sich ein enormer Kessel mit geschmolzenem Eisen verbarg. Mein Vater zapfte den Kessel an, und ein Strom von zischender Lava lief über eine Wanne in eine Form, um dort zu erstarren. Man sollte doch meinen, das wäre etwas wert – dass er anständig von dieser harten Arbeit hätte leben können –, aber er verdiente nicht mehr als zwanzig Pfund pro Woche.
Ob meine Eltern glücklich waren? Schwer zu sagen. Es war nicht leicht für die Menschen in Englands Norden, wirklich glücklich zu sein. Bei uns zu Hause wurde zwar viel gelacht, aber das war oft nur ein Mittel, um die darunter liegende Mühsal zu überdecken, sich von der Armut abzulenken. England war innerhalb von achtzig Jahren zweimal angegriffen worden, Familienmitglieder und Freunde waren im Chaos verloren gegangen, also waren alle schon damit zufrieden, überhaupt am Leben zu sein. Aus meiner Sicht waren die Leute im Norden tolerant, dankbar, und ihre einzige Hoffnung war, auch den nächsten Tag zu überstehen. Glück war ein Luxus, den sie sich nicht leisten konnten.
Das Geld war in unserer Familie sehr knapp. Wir besaßen nicht viel, aber das sah bei anderen nicht anders aus, also war das keine große Sache. Luxusgüter gab es nur ganz vereinzelt. Ich erinnere mich nicht daran, jemals gar kein Essen gehabt zu haben, aber ich war sehr oft hungrig. Ich war ein dünner kleiner Junge, nicht gerade gut gepolstert, damals schon so wie heute, mit wanderndem Blick und vielen, dicken Haaren. Dass ich so oft Hunger hatte, hing auch mit dem Lieblingsessen meines Vaters zusammen: Kuhherzen. Er kaufte sie beim Metzger und kochte sie. Ach, war das ekelhaft! Aber das Essen war allgemein nichts, worüber man sich hätte freuen können. Die Kriegsrationierungen waren noch in Kraft. Lange nachdem der Krieg vorbei war, war es im Norden immer noch schwierig, Butter, Zucker oder Milch zu bekommen. Mir war es am wichtigsten, nicht frieren zu müssen. Eine meiner frühen Pflichten bestand darin, den Kinderwagen meiner Schwester auszuräumen, zum nächsten Kohlenlagerplatz zu stiefeln und den Wagen vollzuladen, damit es bei uns zu Hause warm blieb.
Wenn du so arm bist, wie wir es waren, und an einem so düsteren Ort wie Salford lebst, sind Träume oft dein einziger Ausweg. Meine erste Halluzination hatte ich – Jahre, bevor ich LSD entdeckte – bei einem Sonnenuntergang nach einem Sturm. Ich war im Schlafzimmer meiner Eltern und schaute aus dem Fenster, es stand halb offen, ich konnte den Staub noch riechen. Und ich dachte, ich würde eine goldene Stadt in den Wolken sehen. Offensichtlich handelte es sich dabei nur um ein paar verirrte Sonnenstrahlen, die auf die Wolkenformation fielen, aber für einen Sechsjährigen mit einer regen Fantasie war es eine goldene Stadt vor einem endlosen Horizont. Dazu hörte ich eine kleine Stadt, die sich regte. Damals gab es noch kaum Autos, bloß Pferdekutschen, Lumpensammler, eine Mutter, die nach ihren Kindern rief – Alltags-geräusche. Aber für mich klang es wie Musik. Es war das erste Mal, dass ich ein Gefühl dafür bekam, was das Leben noch alles auf Lager haben könnte.
Wenn du in Salford aufwächst, musst du ziemlich kreativ sein. Für uns Kinder gab es nicht viel zu tun, wir spielten Fußball und durchstöberten die ausgebombten Häuser, das waren unsere liebsten Spielplätze. Meine Kumpels und ich stöberten zwischen Schutt und Asche nach Pfannen, Nachttöpfen, Stücken von Kaminsimsen, irgendwelchen Sachen. Für die Feuer zur Guy Fawkes Night sammelten wir eifrig Holz. Fawkes war einer der Anführer einer katholischen Rebellionsbewegung gewesen, die versucht hatte, den protestantischen König zu stürzen. Uns gefiel die Vorstellung, dass die Rebellen einen Tunnel unter dem Parlament hindurch gegraben hatten, um das Gebäude in die Luft zu sprengen. Im Rückblick waren unsere Streifzüge ganz schön gefährlich; die Ruinen hätten jederzeit einstürzen können. Hätten meine Eltern gewusst, wo ich mich herumtrieb, sie hätten mir sicher den Hintern versohlt.
Wenn wir keine Lust mehr hatten, die Häuser zu durchstreifen, erklommen wir die Kohlenhalde; wir mussten aufpassen, dass wir dabei nicht unter einem Berg von schwarzer Kohle begraben wurden. Oder wir kletterten über den Zaun der Kirche St. Ignatius und trieben uns in deren Keller herum. Das war an sich völlig harmlos; was Kinder eben so treiben. Aber wenn wir erwischt wurden – und natürlich wurden wir erwischt – stellte uns der Priester vor die Wahl: entweder ab zur Polizei oder Hosen runter, damit er uns verdreschen konnte. Nun, es war klar, wofür wir uns entschieden, und das war allen Beteiligten recht: Niemals wären wir zur Polizei gegangen. Wir waren Kinder, wir hatten nichts gestohlen, die Polizei kam uns verdammt beängstigend vor. Der Priester wollte ohnehin nur einen Blick auf unsere nackten Hintern erhaschen. Ganz klar, das war kein Missbrauch, aber er hatte auf diese Weise zweifelsohne sein Vergnügen mit uns.
Es brachte mich auch nicht davon ab, gerne in die Kirche zu gehen. Sonntags sogar dreimal, zu jeder sich bietenden Gelegenheit. Nicht, dass ich oder irgendwer in meiner Familie religiös gewesen wäre. Aber ich war immer froh, mal von zu Hause wegzukommen, und ich sang gerne im Chor, wenn die Orgel im Hintergrund tönte wie eine Stimme vom Himmel. Dort hatte ich zum ersten Mal die Gelegenheit, gemeinsam mit anderen zu singen. Wie sich die Stimmen erhoben und sich in Harmonie vereinten – das war schon ein Erlebnis! Ich hatte eine glockenklare Stimme und konnte ganz hoch singen. Schon in dem Alter lernte ich, wie ich meine Stimme noch über die Melodie setzen konnte, und das sollte mir für den Rest meines Lebens nützlich sein.
Ich denke, Musik war meine Religion, obwohl meine Familie überhaupt keinen Zugang dazu hatte. Wir sangen nicht miteinan der, und es gab auch keine Schallplatten – konnten wir uns nicht leisten. Mein Cousin Ray hatte einen Plattenspieler mit einem riesigen Trichter, bei ihm hörten wir immer die Ouvertüre zu Samson und Delilah und drehten ganz laut auf. Bei uns zu Hause gab es nur ein Radio, so ein braunes Plastikding mit einem Knopf zum An- und Ausschalten sowie drei Knöpfen für die BBC-Sender: den ersten für das Light Programme, auf dem Unterhaltungsmusik lief, den zweiten für den Home Service mit Comedy und Sonderberichten und den dritten für die Third Programme genannte Mischung aus kulturellen und intellektuellen Sendungen. Auf Light Programme waren immer viele Tanzorchester aus dem Norden zu hören, außerdem Schlagersänger wie Frankie Laine und Rosemary Clooney, später dann Johnnie Ray. Irgendwann bekamen wir auch Radio Luxemburg rein. Keine Ahnung, wieso. Es war jedenfalls der dritte Knopf, und wenn das Wetter mitspielte, war der Empfang völlig störungsfrei. Radio Lux befeuerte meine Fantasie. Als Teenager beeindruckte mich einfach alles, was sie spielten: die Platters, Fats Domino, Gene Vincent, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly, Elvis, die gesamte Riege der jungen Rockgötter. Ansonsten gab es Musik in meiner Familie nur auf den Spaziergängen mit meinem Vater. Er pfiff eine Melodie, und ich pfiff harmonisch zurück. Einmal gingen wir ins Borough, einem Kino auf der anderen Seite vom Ordsall Park. Ich sah dort zum ersten Mal The Girl Can’t Help It. Der Film hat mein Leben in vielerlei Hinsicht beeinflusst. Er beginnt in körnigem Schwarz-Weiß, Tom Ewell erklärt, was los ist, und dann wechselt er zu prachtvollem Technicolor. Wahnsinn! Meine liebsten Rock’n’Roll-Stars spielten mit. Und die Szene, in der Jayne Mansfield zum ersten Mal auftritt, ist für einen 15-jährigen ziemlich unglaublich. Sie sah wie ein Engel aus – anders: besser als ein Engel. Als wir danach durch den Park zurückgingen, sang mein Vater, und ich stimmte mit ein: „Shrimp Boats Are a-Coming“, „This Old House“, „Ghost Riders in the Sky“ und dieses ganze alberne Zeug.
Mein musikalisches Leben sollte sich an einem ganz gewöhnlichen Schultag in der Ordsall Board Primary School für immer ändern. Ich träumte im Unterricht von Mr. Burke so vor mich hin, als es plötzlich an der Tür klopfte und eine alte Dame mit einem langen dunklen Schal um den Hals einen Jungen in meinem Alter hereinbrachte. Er war sichtlich nervös. Nach einer kurzen Unterredung rief Mr. Burke die Klasse zur Ruhe. „Hört mal alle her“, sagte er. „Das ist Harold Clarke, er ist von Broughton hierhergezogen und geht ab jetzt in eure Klasse. Also, wo kann er sich hinsetzen?“ Wir schauten uns um. Es gab nur noch einen freien Platz – neben mir.
„Hier!“, vermeldete ich.
Besser hätte es nicht kommen können. Harold Clarke, der sich später Allan nannte, wurde sofort mein bester Freund. Ich spürte gleich, dass er wie ich war. Ich musste nur einen Satz beginnen, und er wusste, was ich sagen wollte, bevor ich zu Ende gesprochen hatte. Wir mochten dieselben Fußballclubs, dieselben Mädchen. Wir kämmten uns auf dieselbe Weise die Haare mit Brylcreem nach hinten, um auszusehen wie Tony Curtis. Und Musik – Musik verband uns wirklich.
Clarkie und ich gehörten zu der Gruppe, die bei der Morgenversammlung vor Schulbeginn das Vaterunser sang. Die anderen Kinder leierten nur die Melodie mit, aber Clarkie und ich setzten uns ab und fanden ganz von selbst fabelhafte Harmonien. Wir gaben uns einfach hin und übertrumpften einander. Allan hatte ein großartiges Organ, seine Stimmfärbung war damals schon reich und kräftig, er sang sehr kontrolliert und sein Falsett wölbte sich bis in den Himmel.
Das zweistimmige Singen wurde unsere Leidenschaft. Ich habe keine Ahnung, woher wir das hatten. Niemand hatte es uns beigebracht, und wir hatten auch keine Worte dafür. Es war einfach ein Geschenk, und es bereitete uns viel Freude. Wir sangen überall – in der Schule und zu Hause, besonders gerne vor dem Spiegel. Dann taten wir so, als wären wir unsere Lieblingssänger. Ich bastelte mir eine Gitarre aus Sperrholz, malte sie rot an und schwang meine knochigen Hüften vor dem Spiegel, als wäre ich Elvis höchstpersönlich. Als die Everly Brothers populär wurden, imitierten wir die – später die Louvin Brothers, Ira und Charlie. Wir saugten alles auf und machten unser eigenes Ding draus.
Samstags gingen wir zur Trafford Road und drückten uns die Nase am Schaufenster des örtlichen Musikladens platt. Es gab dort Rasseln, Mundharmonikas und Flöten, aber auch eine Auswahl an klassischen Gitarren. Irgendwann tauchte ein elektrisches Modell in ihrer Mitte auf, von einem Scheinwerfer beleuchtet, und es hypnotisierte mich stundenlang. Ich stand nur da, starrte und hoffte, dass ich mir eines Tages durch einen wundersamen Zufall so ein Schätzchen würde leisten können. Aber ich ahnte auch, dass dieser Tag noch in weiter Ferne lag.
Gitarren interessierten mich mehr als die Schule. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, kommt mir das seltsam vor, denn inzwischen bin ich ausgesprochen wissbegierig und zu meinen Freunden zählen einige wirklich brillante Köpfe. Nichts finde ich anregender als eine Diskussion mit einem Wissenschaftler oder ein Buch, das einen bestimmten Aspekt des Lebens beleuchtet. Aber als ich zur Schule ging, schien nichts mein Interesse zu wecken. Ich war ein gleichgültiger Schüler – las nichts, lernte nichts. Wer weiß, warum? Vielleicht tragen die stumpfsinnigen Lehrer oder die Umstände bei mir zu Hause eine Mitschuld. Aber eigentlich lebte ich in meiner eigenen Welt.
Von klein auf war ich ein Einzelgänger. Ich mag Menschen, sie faszinieren mich, aber manchmal sind all ihr Gerede und ihre allgemeine Geschäftigkeit doch schwer zu ertragen. Ich habe immer nach Orten gesucht, an denen ich die Welt außen vor lassen konnte, um mich der Einsamkeit und meinen Träumereien hinzugeben. An der Ordsall Board School gab es dafür kaum Möglichkeiten. Es gab keine Cafeteria, zum Mittagessen mussten wir in ein Gebäude im angeschlossenen Park hinübergehen. Mein Freund Fred Moore und ich rannten immer dorthin, um als erste an den Töpfen zu sein. Nach dem Essen verdrückte ich mich und kletterte auf einen kleinen Baum im Park. Da oben war ich in Sicherheit, niemand konnte mich stören. Ich spüre noch immer die wippenden Äste unter meinen Füßen. Nur der Baum und ich. Völlige Abgeschiedenheit. Einfach perfekt.
Zu Hause war ich mit einer anderen einsamen Leidenschaft beschäftigt: der Fotografie. Mein Vater war Amateurfotograf, und er verwandelte das Zimmer, in dem ich schlief, regelmäßig in eine Dunkelkammer. Er nahm die Decke vom Bett, verhängte damit das Fenster und stellte Wannen mit Chemikalien auf, in denen er die Bilder entwickelte. Von Anfang an nahm die Magie der Fotografie mich gefangen. Mit großen Augen schaute ich zu, wie mein Vater ein Blatt Papier durch die Wannen wandern ließ und dabei langsam ein Bild entstand. Faszinierend! Mein Vater machte mich mit den Vorgängen vertraut. Kurz darauf schenkte er mir eine Kamera. Ich war überrascht, dass wir uns das überhaupt leisten konnten; es war eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Aber in meiner Begeisterung dachte ich nicht länger darüber nach.
Seitdem ich zehn Jahre alt war, war ich besessen davon, zu fotografieren – keine Schnappschüsse, sondern Bilder, die einen besonderen Moment einfingen oder etwas erzählten. Das hatte viel mit meiner Neugier auf Menschen zu tun. Eine große Rolle spielte aber auch mein Wunsch, nicht aufzufallen, unsichtbar zu bleiben, wie da oben in meinem Baum. Die Menschen auf den Fotos sollten völlig natürlich sein, sie sollten gar nicht merken, dass ich überhaupt da war. Die meisten meiner Versuche waren vergeblich, aber ab und zu landete ich einen Volltreffer. Mein Lieblingsfoto aus dieser Zeit ist ein Bild von meiner Mutter. Ich erinnere mich genau daran, wie mir bewusst wurde, dass dies kein gewöhnlicher Schnappschuss sein würde. Wir waren mit der ganzen Familie in einer Urlaubsanlage namens Middletown Towers, etwa fünfzig Kilometer nördlich von Manchester. Eine junge Frau war in den Pool gesprungen und musste sich den Kopf gestoßen habe, jedenfalls sie trieb ganz merkwürdig auf dem Wasser. Ohne zu zögern, sprang mein Vater in den Pool und rettete die Frau, und dabei verlor sie ihr Bikinioberteil. Tja, das waren sozusagen die ersten Brüste meines Lebens. Ich war elf Jahre alt. Das war schon was! Nicht schlecht! Meine Mutter saß auf einer Badeliege am anderen Ende des Pools. Es war ein wolkenverhangener Tag, sie hatte sich ihre Jacke um die Schultern gelegt, trug ihre Sonnenbrille und rauchte. Aus irgendeinem Grund wandte ich mich von der Frau ab und schaute meine Mutter an. Sie bekam das nicht mit. Mit einem Mal sah ich in ihr nicht nur meine Mutter, sondern fragte mich: Wer ist diese Person eigentlich? Ich erwischte sie in einem sehr ruhigen, etwas verlorenen Moment. Und da wurde mir klar, dass ich einen anderen Blick auf die Dinge hatte.
Ich hätte mich den ganzen Tag nur mit der Fotografie beschäftigen können. Ich sparte jeden Penny, den ich abzweigen konnte, für Filme. Zum Glück hatte ich einen Job, der mir ein bisschen Geld einbrachte. Mein Onkel Ben war Gewerkschaftsvertreter, und jeden Samstagmorgen schickte er mich los, um die Mitgliedsbeiträge einzusammeln. Ich klopfte an die Türen – „Die Gewerkschaft hier!“ – und manchmal schauten die Leute nur durch ihre Vorhänge und öffneten nicht, aber die meisten zahlten. Ich hatte ein Buch dabei, in dem die Namen und Beiträge verzeichnet waren, und setzte nach jeder Zahlung ein Häkchen. Der Großteil meines Verdienstes kam in die Familienkasse, den Rest investierte ich in Filme. Mein Freund Fred Moore und ich bauten uns in seinem Hinterhof eine provisorische Dunkelkammer und entwickelten dort einen Film nach dem nächsten.
Die Kamera verhalf mir zu einer neuen Perspektive für mein junges Leben. Aber gegen Ende des Jahres 1953 änderte sich alles. Eines Abends kam ich vom Fußballspielen mit meinen Kumpels nach Hause und traf meine Mutter in einem völlig aufgelösten Zustand an. „Dein Vater ist in Schwierigkeiten“, sagte sie, außerstande, ihren Kummer vor mir zu verbergen.
Während ich fort gewesen war, war die Polizei gekommen. „Ist William Nash zu sprechen?“, hatten sie gefragt. Meine Mutter antwortete, er trinke gerade Tee, aber sie ließen sich nicht abwimmeln. Sie wollten Genaueres über eine gewisse Kamera erfahren, die sich in seinem Besitz befand. Besser gesagt: in meinem. Es war die Kamera, die er mir geschenkt hatte. „Ich habe sie nicht gestohlen.“ Mein Vater bestand darauf. „Ich habe sie einem Arbeitskollegen abgekauft.“ Es sei eine billige Kamera, sagte er, sie habe nur zehn Pfund gekostet. Die Polizisten wollten einen Namen wissen, aber mein Vater weigerte sich, denn seine Freunde verpfeift man nicht. Sie glaubten ihm nicht und nahmen ihn wegen des Besitzes von Hehlerware vorläufig fest.
Es zog mir den Boden unter den Füßen weg. Mein Vater war ein guter Mann. Ehrlich, gesetzestreu und stolz. Noch nie war er in Schwierigkeiten geraten. Die Polizei hatte nie einen Grund gehabt, an unsere Tür zu klopfen – es war unerhört. Aber jetzt hatte sich das Blatt gewendet. Unsere Privatsphäre war zerstört. Alle Nachbarn wussten Bescheid. Wenn die Polizei zu dir kommt, spricht sich das rum; die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer in Salford. Ein niederschmetternder Schlag für einen Mann, der sein Leben lang alles mit sich allein ausgemacht hatte.
Nachdem sich die erste Aufregung gelegt hatte, machten wir uns keine großen Gedanken mehr. Mein Vater war kein Dieb, selbst wenn andere ihn für einen hielten, und niemand kam ins Gefängnis, weil er eine billige Kamera gestohlen hatte.
Kurz darauf schlich sich mein Vater nachts in mein stockfinsteres Zimmer, ich hatte schon geschlafen. Und ich wusste sofort, dass etwas nicht in Ordnung war. „Ich muss mit dir reden“, sagte er. Ich konnte an seinem Tonfall hören, dass die Sache nun doch ernst geworden war. Er erklärte mir, dass er unschuldig sei, dass das in diesem wirren Rechtsverfahren aber keine Rolle spiele. „Ich muss vor Gericht, und möglicherweise bleibe ich eine Weile weg. Wenn es so kommen sollte, zähle ich auf dich. Du bist dann der Mann im Haus.“ Ich begriff nicht ganz, was er meinte, es machte für mich überhaupt keinen Sinn. Aber ich nickte und umarmte ihn fest. Es war das gefühlvollste Gespräch, das wir je miteinander geführt hatten.
Die Verhandlung folgte bald – die Mühlen des Gesetzes mahlten damals noch nicht so langsam wie heute. Nur eine oder zwei Wochen später, ich sprang gerade im Haus herum, stürmte meine Mutter herein und verkündete: „Er hat ein Jahr bekommen!“ Dann brach sie in Tränen aus. Ich war geschockt, fassungslos. Ich konnte es einfach nicht begreifen. Selbst wenn mein Vater für schuldig erklärt worden war, war er doch höchstens ein Mittäter gewesen. Ein Jahr Gefängnis kam mir völlig übertrieben vor. Wir konnten ihn nicht einmal mehr besuchen. Er wurde sofort eingelocht.
Nun brachen andere Zeiten an. Wir mussten zusammenhalten und uns alleine durchschlagen. Meine Mutter versuchte, tapfer zu sein. „Wir schaffen das schon“, behauptete sie, aber ich war mir da nicht so sicher. Offensichtlich war die Familie bisher mehr schlecht als recht durchgekommen. Ohne den Lohn meines Vaters würden wir noch mehr Opfer bringen müssen.
Aber es kam alles noch schlimmer. Mein Vater saß in Strange-ways ein, einem brutalen Hochsicherheitsgefängnis, in dem auch Hinrichtungen vollzogen wurden. Es war ein Ort des ewigen Schreckens im Zentrum von Manchester, dunkel und unheilvoll, wie aus einem Dickens-Roman. Ich mochte mir gar nicht vorstellen, wie mein Vater seine Zeit dort in der Gesellschaft von Schwerverbrechern herumbrachte. Meine Mutter war verzweifelt – so kannte ich sie gar nicht.
Zu Hause wurde es richtig hart. Ich war nun also wirklich der Mann im Haus, sorgte dafür, dass Vorder- und Hintertür nachts verschlossen waren, der Ofen aus war, und musste die Verantwortung für meine Schwester Elaine übernehmen. Wenn ich auch nur einen Fuß vor die Tür setzte, um mich mit meinen Freunden zu treffen, rief meine Mutter schon: „Nimm deine Schwester mit!“ Oh, Mann! „Gut, komm mit, Elaine.“ Wir hatten vorher schon nicht im Überfluss gelebt, aber jetzt mussten wir selbst am Notwendigsten sparen. Die meisten meiner Kleider kamen von der Heilsarmee, weder passten sie mir, noch passten sie zusammen. Ich trug Oberteile, die aussahen wie Opas Nachthemd, Mäntel, die zeltähnlich an mir herunterhingen. Nachdem ich die Sohlen meiner Schuhe durchgelaufen hatte, musste ich einmal sogar die Damenschuhe meiner Mutter auftragen, was für einen Zwölfjährigen unfassbar demütigend ist. Und das zu einer Zeit, als ich doch nur cool sein wollte und mir wünschte, Mädchen und meine Freunde zu beeindrucken. Stattdessen schaute ich im wahrsten Sinne des Wortes blöd aus der Wäsche. Ach, damit habe ich heute noch zu kämpfen. Nach allem, was ich in meinem Leben erreicht habe, halte ich meinem Coolness-Faktor immer noch für verdammt niedrig.
Wenigstens strengte ich mich inzwischen im Unterricht mehr an und bestand die Zulassungsprüfung für die höhere Schule. Das forderte wiederum einen großen, unerwarteten Tribut, was meine Freundschaft zu Allan betraf. Seit wir sechs Jahre alt waren, waren wir beste Freunde, aber diese Prüfung entzweite uns. Clarkie bestand sie nicht, und das trieb einen Keil zwischen uns. Ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht hatte er das Gefühl, nicht so intelligent zu sein wie ich, obwohl er es durchaus war.
Das Jahr war aus vielerlei Gründen schwierig. Mein Vater kam endlich frei. Nach fünf Monaten in Strangeways war er in eine Einrichtung mit niedrigerer Sicherheitsstufe namens Bela River verlegt worden. Aber als er nach Salford, in seine Heimat, zu seiner Familie zurückkehrte, war ein gebrochener Mann. Die Verurteilung hatte ihm jegliche Selbstachtung geraubt, und kurz darauf verlor er auch seine Arbeit. David Brown Jackson feuerte meinen Vater nur aus einem einzigen Grund: Weil er im Gefängnis gewesen war. Auf seine Jahre bei der Firma oder auf seinen Charakter, der tadellos war, wurde keine Rücksicht genommen. Das Schicksal meines Vaters mitansehen zu müssen, hatte großen Einfluss auf mich.
Die bestandene Zulassungsprüfung sorgte allerdings für ziemlichen Wirbel, besonders in unserer Familie. Zur Belohnung kaufte meine Mutter mir einen Plattenspieler von Philips. Ich habe keine Ahnung, wie sie das Geld dafür zusammenkratzen konnte, denn wir hatten wirklich absolut nichts. Was für ein fantastisches Geschenk! Ach, ich habe das Ding geliebt, auch wenn ich gar keine Platten besaß.
Ich kannte aber einen Typen, der Platten hatte. Er hieß Ralph Etherington und wohnte ein paar Häuser weiter am Ende der Straße. Eines Tages, Anfang 1956, rief er mich zu sich: „Hey, komm mal her und hör dir das an.“ Er hatte einen elektronischen Plattenspieler, den man nicht einmal ankurbeln musste. Er setzte einfach die Nadel auf und … „Heartbreak Hotel“.
Wow! Mir stand der Mund offen, während Elvis sich durch diesen Wahnsinnsknaller sang. Egal, wie oft ich es höre, es geht mir bis heute so. Der Schwelbrand seiner Stimme setzt dich in Flammen, und du bist verloren. All der Schmerz, die Einsamkeit und Seelenqual, die diese Stimme transportiert! Er schüttet sein Herz aus, steckt alles in diesen Song. Es ist ein Stück musikalisches Drama, das es kaum ein zweites Mal gibt.
Von diesem Moment an stand mir der Himmel offen. Ich fing an, amerikanischen Rock’n’Roll zu hören. Ein paar Männer in meinem Umfeld, Brüder und Cousins von Bekannten, arbeiteten bei der Handelsmarine und brachten Platten aus den Staaten mit. „The Great Pretender“, „Butterfly“, „That’ll Be the Day“, „Hound Dog“, „Long Tall Sally“ … Lonnie Donegan, der King of Skiffle, hat britischen Teenagern einen Riesendienst erwiesen. Sogar arme Kinder wie ich konnten eine Band gründen, indem wir Sachen benutzten, die wir ohnehin zu Hause hatten – ein Waschbrett und eine Teekiste als Schlagzeug und Bass. Es war eine wunderbare Einführung ins Musikmachen. So viele Bands im Norden haben als Skiffle-Gruppen angefangen, auch die Beatles, das machte Lonnie Donegan zu einer wichtigen Nummer. Aber mit der Magie des Rock’n’Roll konnte Skiffle nicht mithalten. Ich erinnere mich an einen nebligen Nachmittag in Salford, ich ging zum örtlichen Plattenladen. Draußen hatten sie kleine Lautsprecher angebracht, aus denen die neuesten amerikanischen Hits ertönten. Durch den Nebel schallte mir „Blue Moon“ von Elvis entgegen und es war … perfekt.
Das war’s also. Kaum war mir der Rock’n’Roll unter die Haut gekrochen, kam ich nicht mehr davon los. Anstatt im Unterricht zuzuhören, begann ich zu kritzeln, zeichnete Fender Stratocaster und Bühnenaufbau-Entwürfe. Ich begann, Autogrammschreiben zu üben. Meine Tagträume übernahmen das Kommando, und ich folgte ihnen. Egal, was die Lehrer sagten – ich wusste, was ich vorhatte. Nichts sollte mich von meinen Träumen abbringen.
Ein Freund von mir, Arthur Marsden, brachte seine Platten mit zur Schule, er hatte so ein kleines tragbares Gerät, das man überall einstöpseln konnte. Eines Tages zog er eine 78-RPM-Version von „Be-Bop-a-Lula“ hervor und tauschte sie gegen mein Mittagessen ein. Danke noch mal, Arthur! Es war meine erste eigene Platte – und was für eine. Sie regte meine Fantasie in vielerlei Hinsicht an. Gene Vincents verwegene, schnarrende Stimme klang nach Sex und Gefahr, und dazu kam dieser unvergessliche Text. Die Art, wie er die Wörter ausspuckte – das machte mich fertig. Ich hatte ein Foto von ihm gesehen in einer schwarzen Motorradjacke, die Frisur mit viel Pomade in Form gebracht, ein Draufgänger – die Inkarnation des Rock’n’Roll.
Clarkie und ich waren wie berauscht. Zwei Jahre später bekam mein Freund Fred ein Fahrrad zum Geburtstag und fuhr damit bis nach Bad Nauheim in Deutschland, um Elvis zu treffen. Von da an wollte ich natürlich auch ein Fahrrad. Aber wir redeten nur über Musik. Wir gierten danach wie zwei Junkies und sangen beinahe jeden Tag zusammen. Nach der Schule trafen wir uns oft im Salford Lads Club, einer kleinen Sozialeinrichtung für Kinder, die sonst nichts zu tun hatten. Wir spielten dort Schach, Billard und Tischtennis. Allan und ich machten bei einer Minstrel-Show mit. Wir malten uns die Gesichter schwarz – politisch unkorrekter geht’s nicht, aber wer machte sich in den 1950ern darüber schon Gedanken.
Vor meinem dreizehnten Geburtstag fragte meine Mutter mich: „Was wünschst du dir?“ Ich wollte ein Fahrrad, aber natürlich waren wir zu arm. (Unvorstellbar, eine Jugend ohne Fahrrad.) Ich konnte nirgends hin, meine Freunde waren ohne mich unterwegs. Aber es gab ja noch eine Alternative – eine Gitarre. Tagelang diskutierte ich mit mir selbst. Fahrrad oder Gitarre? Gitarre oder Fahrrad? Ich wusste, dass meine Mutter mir kein anständiges Fahrrad kaufen konnte, also entschied ich mich für eine gebrauchte Akustikgitarre aus dem Pfandhaus. Es war eine Levin Sunburst mit einer dermaßen hohen Saitenlage, dass meine Finger mehrere Kilometer zwischen Saiten und Bund zurücklegen mussten. Es war übel – meine Finger bluteten. Aber es gelang mir, sie zu stimmen; ich habe ein verdammt gutes Gehör.
Clarkie bekam zur selben Zeit eine Gitarre, und mit Burt Weedons Play in a Day-Büchern brachten wir uns das Spielen bei – wahrscheinlich auf die gleiche Weise wie Eric Clapton, George Harrison, Dave Davis und Jimmy Page. Die Bücher machten in unserem Freundeskreis die Runde, und wir konnten schon drei Akkorde, als Skiffle aufkam. Ich erinnere mich an meinen ersten Moll-Akkord: a-Moll. In dieser Tonart ist auch der Crickets-Song „Baby My Heart“ geschrieben. Großer Gott – ein Mollakkord! Fantastisch! Wenn du lernst, so einen Klang zu erzeugen, öffnen sich in deinem Kopf tausend Türen. Ich entdeckte eine komplett neue Welt, weit weg von Salford.
Allan und ich gaben unsere Gitarren nicht mehr aus der Hand. Wir trafen uns bei ihm oder bei mir zu Hause und übten ununterbrochen. Unser Repertoire bestand aus Skiffle-Hits: „Don’t You Rock Me, Daddy-O“, „Rock Island Line“, „Bring a Little Water, Sylvie“, „Wimoweh“. Mit zwei oder drei Akkorden kam man problemlos durch ein paar Dutzend Songs. „John Henry“, „Midnight Special“, „Cumberland Gab“, „Pick a Bale of Cotton“, „Worried Man Blues“ … wir machten rasche Fortschritte, nicht nur mit den Songs, sondern auch, was das zweistimmige Spielen anging. Eines Nachmittags, ich war bei Clarkie zu Besuch, kam sein älterer Bruder Frank herein und hörte uns eine Weile zu. „Gefällt mir, was ihr da macht“, sagte er nach ein paar Songs. „Hättet ihr was dagegen, wenn ich mal nachfrage, ob ihr in meinem Club spielen könnt?“ Er war Mitglied bei einer Arbeitervereinigung, dem Devonshire Sporting Club; der Laden gehörte dem berühmten Ringer Bill Benny. Frank legte ein gutes Wort für uns ein, und Benny sagte, er solle uns ruhig mal mitbringen. Alle möglichen Talente traten bei ihm auf – Akkordeonspieler, die „Lady of Spain“ hervorquetschten, Jongleure, die Teller durch die Luft wirbelten, Hunde, die im Rhythmus bellen konnten. Zwei 14-jährige Skiffle-Spieler passten hervorragend dazwischen.
Ein historischer Moment stand bevor: unser allererster Auftritt. Jemand fragte mich, ob ich Angst hätte. Angst? Ich verstand die Frage nicht. Warum sollte ich Angst haben? Es war genau das, was ich tun wollte. Ich war 14 Jahre alt und zu allem bereit. Unsere Gesichter waren jung und frisch, und wir hielten uns für unbesiegbar. Ja, und wir haben das Publikum umgehauen. Wir haben den Club zum Toben gebracht. Ich erinnere mich noch, wie Bill Benny danach eine riesige Rolle mit Pfundnoten aus seiner Tasche zog, sich bis zu den kleineren Noten durchblätterte und uns zwei Zehn-Schilling-Scheine überreichte. Wow! Stolz trug ich meine erste Gage nach Hause.
Bei einem anderen Auftritt wurden wir noch besser bezahlt – wir bekamen umgerechnet etwa zwanzig Dollar, ein verdammtes Vermögen. Langsam dämmerte uns, dass wir mit dem Musikmachen Geld verdienen konnten. Besonders, wenn wir sonntagsnachmittags in die Pubs gingen; in den meisten gab es kleine Bühnen und die Leute wollten unterhalten werden. Wir gingen zum Beispiel ins Yew Tree, und da hieß es dann: „Ihr könnt um halb fünf auf die Bühne, aber nur für zwei Songs.“ Jeder Auftritt war gleichzeitig auch ein Vorspiel, denn es saßen immer Veranstalter im Publikum. Wenn wir ihnen gefielen, kamen sie hinterher zu uns und gaben uns ihre Karte. „Ich bin vom St. Ann’s Club, wir eröffnen am Montag. Habt ihr Lust vorbeizukommen? Wie viel Geld verlangt ihr?“ Am Anfang spielten wir noch für zwei Pfund und zehn Schilling, etwa sieben Dollar, und waren froh darüber. „Hört mal, wollt ihr nicht nächsten Samstag in Altrincham spielen? Ich kann euch zehn Pfund zahlen!“ Zehn Pfund! Ernsthaft!?
Jugendliche in unserem Alter durften sich in Pubs aufhalten, solange sie keinen Alkohol tranken, und meine Mutter begleitete Allan und mich gelegentlich, um zu überprüfen, ob wir uns daran hielten. Lustigerweise teilten wir uns in ein paar der Läden die Umkleide mit Stripperinnen – und zum zweiten Mal in meinem Leben bekam ich Brüste zu sehen. Clarkie und ich waren im Paradies. Wir sangen, wir wurden dafür bezahlt, und durften ab und zu auch noch unbekleidete Frauen in ihrer ganzen Schönheit bewundern. Himmlisch!
Skiffle machte uns immer noch großen Spaß, aber es war absehbar, dass die Musik sich in eine andere Richtung weiterentwickeln würde. Ich spürte es an dem Tag, als ich einen Bus nach Manchester nahm und ins Kino ging, um mir Die Saat der Gewalt anzuschauen. Meine Güte, dieser Film wühlte uns alle auf. Unfähige Lehrer an einer innerstädtischen Schule und ihre respektlosen Schüler – das kannten wir nur zu gut. Von der Leinwand aus griff eine enorme Energie auf den Kinosaal über; eine Mischung aus Jungsein, pubertärer Lust und Ablehnung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Das Publikum war eine Bombe, gefüllt mit dem Wunsch nach Rebellion. Und als beim Abspann „Rock Around the Clock“ ertönte, drehten die Teddy Boys total durch. Sie rissen die Sitze raus, schnappten sich die Feuerlöscher, ließen ihrer angestauten Aggression freien Lauf. Ich schaute mir den Film zweimal an. Alle sahen ihn. Er war absolut fantastisch und befeuerte unsere Fantasie. Und als wir hörten, dass Bill Haley in die Stadt kommen würde, war die Sache klar.
Jeder wollte bei Bill Haleys Konzert in Manchester dabei sein, Clarkie und ich natürlich auch. Wir wussten, dass es etwas Besonderes werden würde. Wir mussten hin, das stand außer Frage. Aber wie? Der Kartenverkauf sollte an einem Montag Anfang September starten, um zehn Uhr morgens, da waren wir beide in der Schule. Das Konzert würde längst ausverkauft sein, wenn wir danach zum Ticketschalter gingen. Allan und ich waren ja inzwischen auf unterschiedlichen Schulen. Ich ging jetzt auf die Salford Grammar, während er weiterhin Ordsall Board besuchte. Einer von uns musste also schwänzen, und dreimal darf man raten, wer.
Am Montagmorgen machte ich mich also auf den Weg. Ich hatte meine Bücher dabei, brachte meine jüngere Schwester zum Kindergarten – alles wie immer. Aber anstatt die Buslinie 58 zur Schule zu nehmen, stieg ich in die 2 nach Manchester. Es war wieder mal ein grauer Tag im tristen Norden, kühl und bewölkt, der Winter nahte. Die Schlange vor dem Odeon in der Oxford Road war noch nicht allzu lang, als ich gegen halb elf dort ankam. Vielleicht fünfzig Jungs in meinem Alter und ein paar wenige Mädchen waren vor mir dran, und wir erzählten uns gegenseitig, wie großartig es werden würde. „Ob Rudy Pompilli noch bei den Comets dabei ist?“ „Ob Franny Beecher seine schwarze Les Paul spielt? Ich habe noch nie eine gesehen.“
Endlich war ich an der Reihe, und ich kaufte zwei Karten für die erste Reihe im oberen Rang, von wo aus Clarkie und ich alles überblicken können würden. Die Karten waren mir heilig. Auf dem Weg zurück nach Salford hielt ich sie die ganze Zeit fest in meinen Händen.
Am nächsten Tag wurde ich nach der Morgenversammlung zum Rektor gerufen. Ich wusste gleich, dass mir Übles drohte, denn du wirst nicht zum Rektor gerufen, damit er dich lobt. Und E. G. Simms war ein grausamer Typ, wir gingen ihm möglichst aus dem Weg. Ich stand also da und wartete auf ihn, als Mr. Lewis hereinkam, einer meiner Lehrer. Er war nicht gerade glücklich, mich zu sehen. Wie sich herausstellen sollte, war er es gewesen, der mich verpfiffen hatte.
„Mr. Nash, Sie waren gestern nicht krank, oder?“, knurrte Simms. Sie wussten Bescheid, soviel war klar. Also konnte ich mir das Lügen sparen. „Nein“, sagte ich.
„Sie standen in der Schlange, um Konzertkarten zu kaufen.“
„Hmhm.“
Mr. Lewis war zur selben Zeit in Manchester gewesen, um et-was zu erledigen, und hatte mich vor dem Odeon gesehen. Natürlich hatte der Idiot das gemeldet. Mr. Simms schaute mich mit seinem bösartigsten Blick an. „Sie wissen, was das heißt?“
Ich wurde geschlagen, und zwar mit einem Schuh auf den nackten Hintern, während ich mich über den Tisch lehnen musste. Der Mistkerl gab mir zehn Schläge. Es war nicht das erste Mal, eigentlich keine große Sache, aber ich wurde fuchsteufelswild. Mein sogenanntes Vergehen hatte keine solche Strafe verdient, und mit jedem Hieb wurde ich wütender. Ich war nicht aufsässig gewesen, hatte weder den Unterricht gestört noch bei einer Prüfung geschummelt. Ich hatte niemanden umgebracht, verdammt noch mal. Ich war lediglich einer Leidenschaft gefolgt. Warum begriffen sie das nicht? Warum mussten sie an mir ein Exempel statuieren?
Danach wankte ich zurück in meine Klasse. Die anderen wussten, dass Simms mich verdroschen hatte, sie flüsterten miteinander und kicherten. Es war mir peinlich, klar. Aber während ich da saß, kochte die Wut in mir hoch. Es war so ungerecht! Meine Begeisterung war behandelt worden, als wäre sie etwas Abstoßendes, und mich empörte diese Intoleranz – ein Wort, das ich damals vielleicht noch gar nicht kannte, aber meine Abscheu war um so heftiger. Ich kam nicht darüber hinweg, wie hart ich bestraft worden war. Wie mein Vater, der für ein minderes Vergehen im Gefängnis gelandet war. Und ich kam zu dem Schluss, dass es so etwas wie wahre Gerechtigkeit nicht gab. Gerechtigkeit war ein dehnbarer Begriff, und sogenannte gerechte Entscheidungen waren immer subjektiv, sie hingen von der jeweiligen Politik und den beteiligten Personen ab. Ich dachte mir: Wenn die Dinge so laufen, dann scheiß auf Gerechtigkeit – scheiß auf die Schule. Auf ihre Regeln und Vorschriften war ich ganz bestimmt nicht angewiesen. Mein Zorn hatte vorher schon geschwelt, aber jetzt brach ein Feuer in mir aus. Von diesem Moment an wandte ich mich gegen die Schule, gegen meine Lehrer. Sie verstanden einfach nicht, was Musik mir bedeutete, und ihre Verachtung löste meine Rebellion aus. Dieses Feuer war nicht mehr zu löschen.