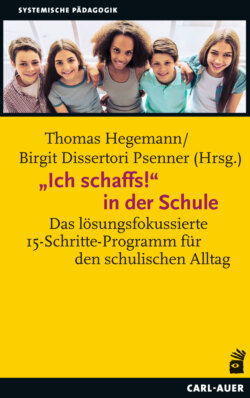Читать книгу "Ich schaffs!" in der Schule - Группа авторов - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2Was ist Lösungsfokussierung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen?
ОглавлениеAm besten erlernen wir den lösungsorientierten Ansatz, wenn wir junge Kinder beobachten, die motorische Fähigkeiten lernen, oder Jugendliche, die ein Computerprogramm lernen. Diese machen keine Problemanalyse, bevor sie loslegen. Sie stehen vor einer Anforderung und fangen einfach an. Sie machen erste Schritte und erleben dabei sowohl Erfolge als auch Misserfolge.
Nehmen wir als Beispiel Kinder, die Purzelbaum-Schlagen lernen. Erst rollen sie nur vor und fallen viele Male zur Seite. Sie machen das alles am liebsten mit anderen Kindern zusammen, vor allem dann, wenn Publikum dabei ist. Auch wenn sie zur Seite kippen, kommt immer ein aufmunternder Kommentar. Skeptische männliche Personen, die Bedenken äußern, ob das wohl noch etwas wird, werden darauf hingewiesen, dass Skepsis »schlechte Laune macht« und vor allem den gewünschten Erfolg eher behindert. Durch das gemeinsame Erleben und die kontinuierliche Bestätigung in der Gruppe lernen auch Kinder, die sich schwerer tun, altersadäquat die Technik des Purzelbaum-Schlagens.
Gleiches können wir bei Jugendlichen beobachten, die Computerprogramme oder soziale Kompetenzen erlernen, wie beispielsweise sich in einem neuen sozialen Kontext sicher zu bewegen.
Ja, werden viele entgegnen, das mag für Kinder und Jugendliche gelten, die gut ausgestattet sind – körperlich, psychisch und sozial. Aber auch die Lebensgeschichten von Menschen, die schweren Belastungen ausgesetzt waren, zeigen, dass eine lösungs- und ressourcenorientierte Haltung Voraussetzung dafür war, sich im Leben gut zu platzieren. Es ist unumstritten, dass schwierige Kindheitserlebnisse oder gar Traumen Spuren in uns hinterlassen und dass der Kontext, in dem wir aufwachsen, unser Leben beeinflusst. Aber nur ein Teil der Menschen, die Kriege und andere Traumen überstanden haben oder die in miserablen Verhältnissen aufgewachsen sind, werden später auffällig. Ein anderer Teil geht gut daraus hervor und kann auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken. Von diesen können wir lernen (Bauer u. Hegemann 2018, S. 30)!
Wie wir von den genannten Pionieren lernen, ist Lösungsorientierung in erster Linie eine Frage der Haltung und nur in zweiter Linie eine Frage der Technik.
Und so, wie es für uns gilt, diese Haltung weiterzugeben, bemisst sich auch der Erfolg lösungsorientierter Arbeit nicht so sehr nach den unmittelbar beobachtbaren Effekten. Wichtiger ist es, unsere Gespräche so zu führen, dass eine Atmosphäre geschaffen wird, die Jugendliche ermutigt, für sich passende Lösungen zu suchen und zu finden (Abb. 1).
Abb. 1: Lösungstrance (nach Ben Furman)
Damit wird Motivation zu einer zentralen Frage von Lösungsfokussierung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Die Frage ist also: Wie können wir Begeisterung zur Veränderung hervorrufen und fördern? Wir möchten dazu ein kleines Modell anbieten (Abb. 2):
Kinder und Jugendliche brauchen – wie alle Menschen –beides: ein selbst gewähltes, attraktives Ziel und das Vertrauen, dass sie dieses auch erreichen können.
Es handelt sich um eine Multiplikationsgleichung, von der wir wissen, dass das Gesamtergebnis gleich null ist, wenn ein Faktor null ist: Ist das Ziel für die Jugendlichen nicht attraktiv (sondern z. B. nur für die betroffenen Erwachsenen), also gleich null, so ist auch die Motivation, es zu erreichen, gleich null; und ist umgekehrt das Ziel attraktiv, aber das Zutrauen in den Erfolg gleich null, so ist die Motivation ebenfalls gleich null.
Abb. 2: Motivation (nach Ben Furman)
Ein lösungsorientiertes Gespräch zu führen, heißt Ermutigung zur Veränderung, Klärung des Nutzens von Veränderung, Ermutigung zum Vertrauen in die eigenen Ressourcen durch beständige Suche nach früheren und aktuellen Erfolgen sowie die Suche nach Helfern und Unterstützerinnen.
Demnach besteht Lösungsfokussierung nicht darin, für Kinder und Jugendliche Lösungen zu suchen oder sich den Kopf zu zerbrechen, was für sie das Beste ist oder was sie wohl Gutes für sich tun könnten. Lösungsorientierung kommt darin zum Ausdruck, alle Gespräche so zu führen, dass Kinder und Jugendliche bestmöglich ermutigt werden, auf eigene, für sie in der aktuellen Lage passende Lösungen zu kommen und ihre eigenen oder neuen Ressourcen dafür bestmöglich zu entwickeln.
Eine kooperative Gesprächssituation herzustellen ist das A und O!
Mit unseren Klienten können wir nur erfolgreich mit dem lösungsfokussierten Ansatz arbeiten, wenn es uns gelingt, eine kooperative und vertrauensvolle Gesprächssituation herzustellen. Kleine Kinder lernen vielleicht noch, »weil die Mama oder die Lehrerin sich freuen«. Erwachsene lernen vielleicht noch, »weil ihnen nichts anderes übrig bleibt«. Für beide wird das auch nur vorübergehend zutreffen. Jugendliche und vor allem solche, die eine Kette von Entmutigungen erlebt haben, lernen nach unserer Erfahrung nur, wenn ihnen der Nutzen klar ist, sie Vertrauen in den eigenen Erfolg haben und sie dem Berater vertrauen. In jedem Fall gehört zum Herstellen einer Arbeitsbeziehung die Achtung des Autonomiebedürfnisses und die Würdigung der aktuellen Problemlage der Klienten. Letzteres bedeutet wertzuschätzen, dass Kinder und Jugendliche gute Gründe haben können, weshalb eine spezielle Situation für sie nicht einfach ist. Entsprechende Sätze können wie folgt lauten (Bauer u. Hegemann 2018, S. 34):
•Ich kann gut verstehen, dass das für dich in dieser Situation nicht leicht ist.
•Das klingt ja alles nicht so einfach.
•Das fordert einem ja schon einiges ab.
Gleichzeitig gehört zur Lösungsfokussierung, eine Haltung der Zuversicht einzuführen und die Problemsicht wieder etwas zu relativieren, zu »normalisieren«. Passende Sätze dazu können sein (ebd.):
•Diese Probleme haben viele andere auch, aber im Laufe der Zeit schaffen es die meisten schon, damit zurechtzukommen.
•Auch wenn es schwer ist, gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, damit umzugehen.
•Wir sehen hier viele Kinder und Jugendliche, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben; aber es lohnt sich, mit anderen gemeinsam zu schauen, wie man da auch wieder rauskommt.
•Oder: Ja, das ist wirklich blöd für dich. Doch jetzt bist du hier, um eine gute Lösung zu finden.
•Oder in Klassen: Ja, da habt ihr wirklich eine Menge Probleme, die ihr bewältigen wollt! Und heute geht ihr den ersten Schritt, zu dem ihr gemeinsam überlegt, was ihr dafür tun könnt, dass ihr euch wieder wohler in eurer Klasse fühlt!
Wir brauchen für lösungsorientierte Beratung im Allgemeinen und für das Ich schaffs!-Programm im Speziellen eine Haltung der »anteilnehmenden Neugier«, wie Giancarlo Cecchin (1988) sie am besten beschrieben hat. Mit dieser suchen wir das Gespräch mit unseren Klienten, um gemeinsam mit ihnen zu erforschen, wie die Dinge sind und welche Veränderungsmöglichkeiten es gibt.
Für uns als Beratende wird dieses Ideal nicht immer durchzuhalten sein. Gerade Jugendliche verstehen es meisterhaft, Erwachsene an ihre Grenzen zu bringen. Eigene innere Bilder können aktiviert werden, die uns aus der anteilnehmenden Neugier ablenken – ein ganz normaler Prozess, denn auch wir haben unsere Geschichte. Daher ist es wichtig, die eigene Aufmerksamkeit dafür zu schärfen, wann wir sie verlieren und wie wir sie wiederfinden können. Besser ist es daher, in solchen Situationen das Gespräch zu unterbrechen, um es später wiederaufzunehmen.