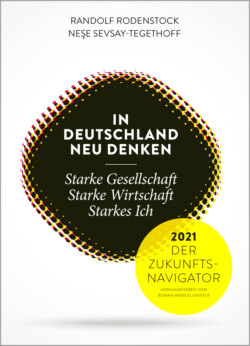Читать книгу RHI Zukunftsnavigator 2021: In Deutschland neu denken - Группа авторов - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеFranzi von Kempis
Widerworte!
EIN AKTIONSPLAN GEGEN VERSCHWÖRUNGSERZÄHLUNGEN
Als ich im März 2020 an Covid-19 erkrankte, war ich 34, gesund, ohne Vorerkrankungen – und die Welt stand erst am Anfang der globalen Pandemie. Ich war mir nicht bewusst, was diese Krankheit auslösen würde – bei mir und bei uns allen. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie sehr mich wechselnde Corona-Maßnahmen verunsichern und vor welche Herausforderungen mich ganz persönlich eine Zeit stellen würde, in der wenig als sicher gilt. Ganz sicher hätte ich nicht gedacht, dass in meiner Heimatstadt Berlin mehrere Zehntausend Corona-Leugnerinnen und -Leugner auf die Straße gehen würden. Und dass dies nicht die ersten und vielleicht auch nicht die letzten Demonstrationen ihrer Art sein würden, bei denen Menschen Plakate mit Verschwörungsmythen, antisemitischen Inhalten und rechtsextremem Gedankengut in die Luft halten, sich weigern, Masken zu tragen und den Mindestabstand einzuhalten, während sie lautstark gegen die angebliche Corona-Verschwörungslüge skandieren und den Irrglauben verbreiten, Covid-19 sei ein Hoax, den ihnen »die da oben« vorgaukeln wollen. Denn was Corona-Leugner, Rechtsextremisten und Maskenverweigerer eint? Verschwörungsmythen.
Wir befinden uns in einer einmaligen Situation. Eine globale Pandemie und ihre Bekämpfung stellen unser gewohntes Leben infrage, gefährden Menschenleben und wirtschaftlichen Wohlstand. Der beste Weg aus der Krise hinaus muss erst noch gefunden werden – dabei können wir Irr- und Umwege nicht ausschließen. Wie auch? Das verunsichert, macht Angst, weckt Bedrohungsgefühle. Aus der Wissenschaft wissen wir, dass Menschen in Krisenzeiten dazu neigen, Verschwörungserzählungen eher zu glauben als in normalen Zeiten. Denn: Sie liefern einfache Erklärungen für ungemein komplexe Situationen. Sie simulieren Antworten, wo Politiker*innen, Wissenschaftler*innen, Arbeitgeber*innen und viele weitere erst Lösungen suchen, diese manchmal auch wieder verwerfen und neu aufsetzen müssen. Und während die Welt einen Ausweg aus der Corona-Krise sucht, gefährden Menschen, die Verschwörungserzählungen rund um eine mögliche Impfung und »die da oben« und ein angeblich »nicht vorhandenes« Virus verbreiten, unsere wehrhafte Demokratie.
Wir brauchen einen Aktionsplan, um als Gesellschaft gegen diese Mythen vorzugehen, wir brauchen neue Ansätze, um Corona-Verschwörungserzählungen vorzubeugen, und wir müssen mehr Angebote entwickeln, um über diese aufzuklären und eine Gegenerzählung zu schaffen. Das Thema war lange Zeit ein Nischenthema, ob in Forschung, politischer Programmförderung oder in der Mitarbeiterentwicklung bei Unternehmen. Jetzt ist es an der Zeit, aus der Nische herauszutreten und Programm zu machen.
1. Wir müssen die Hintergründe und Zusammenhänge verstehen
Aktuell entstehen neue Konstellationen, auf Demonstrationen finden bürgerliches Lager, esoterische Hippies und radikale Rechte auf einmal ein gemeinsames Thema: Verschwörungsmythen, die sich um Corona ranken. Man könnte jetzt zugespitzt sagen: Es wurde aber auch Zeit, dass uns auffällt, welches Problem und welche Gefahr Verschwörungserzählungen in sich bergen. Und es ist bitter, dass es dafür erst solche Zusammenschlüsse auf Demos geben musste. Wir können das Problem nicht mehr »auf das Internet« oder »die Aluhüte« schieben. Verschwörungserzählungen und Menschen, die daran glauben, sind nichts Neues. Sie konnten uns auch vor Corona überall begegnen, ob am Arbeitsplatz oder beim Abendessen mit Freunden oder Familie. Schon 2019 kam eine repräsentative Umfrage der Friedrich-Ebert-Stiftung zu dem Ergebnis, dass mehr als ein Drittel der Bevölkerung glaube, »dass Politiker und andere Führungspersönlichkeiten nur Marionetten der dahinterstehenden Mächte seien.« 1 Mehr als ein Drittel!
Auf was zielen solche Erzählungen ab? Sie sollen möglichst einfache Antworten auf unübersichtliche, komplizierte Probleme und Situationen geben. Sie produzieren klare Feindbilder und einfache Erklärungen für komplexe Zusammenhänge. Sie erklären komplizierteste gesellschaftliche, politische oder wirtschaftliche Probleme oder eben eine globale Pandemie lückenlos und präsentieren dabei einen oder gleich mehrere vermeintliche Schuldige. Wer daran glaubt, sammelt alles, was das eigene Weltbild stützt. Was nicht passt: wird weggelassen. Sachliche Argumente kritischer Stimmen werden dabei angezweifelt oder geleugnet. Deshalb ist auch der oft genutzte Begriff »VerschwörungsTHEORIE« mit Vorsicht zu gebrauchen. Theorien sind wissenschaftliche Erklärungen, den Begriff »Verschwörungstheorien« zu nutzen suggeriert also, man befinde sich in der Diskussion mit »Verschwörungstheoretiker*innen« auf wissenschaftlichem Boden. Die Psychologin Pia Lamberty, Co-Autorin des Buches Fake facts, nennt die Bezeichnung »Verschwörungstheorie« sogar irreführend: »Eine Theorie lässt sich wissenschaftlich an der Welt testen. Das passiert hier ja eben nicht, weil sich diese Theorien wissenschaftlichen Kriterien von Widerlegbarkeit entziehen.« Und schlägt stattdessen zwei andere Begriffe vor: »Zum einen den Verschwörungsmythos, also ein abstraktes Narrativ, das bereits lange existiert und modifiziert immer wieder erscheint – etwa die jüdische Weltverschwörung. Zum anderen die Verschwörungserzählung, also eine konkrete Verschwörungsgeschichte, die sich häufig aus einem älteren Verschwörungsmythos speist – also etwa Verschwörungsgeschichten um Prinzessin Diana.« Zudem spricht Lamberty »von einer Verschwörungsmentalität, die wir als generelles Misstrauen gegenüber als mächtig wahrgenommenen Personen beschreiben.«
Auch die Basis für solche Verschwörungsmythen sind selten wirklich neue Gewächse. So verbreitet Attila Hildmann, ehemals bekannt als Star-Vegankoch, jetzt bekannt als gefährlicher Verschwörungsguru, zum Beispiel klare antisemitische Hetze. Dass Verschwörungsmythen und -erzählungen oftmals eine antisemitische Grundlage beinhalten, ist – leider – kein neues Phänomen, eher das Gegenteil. Antisemitische Verschwörungsmythen sind uralt, die »jüdische Weltverschwörung« gilt als die Urmutter der Verschwörungserzählungen. Hinter der angeblichen Verschwörung steht die Vorstellung, »alle Jüdinnen und Juden« hätten sich gegen die nichtjüdische Welt verschworen und würden im Geheimen daran arbeiten, die Welt zu beherrschen.2 Und auch bei Verschwörungserzählungen, die auf den ersten Blick nicht direkt »die Juden« nennen, findet sich beim Nachhaken oft doch eine antisemitische Grundlage.
Wenn wir uns die letzten Monate ansehen, finden wir viele Ansätze, warum die aktuelle Pandemie Menschen in die Hände von Verschwörungserzählungen treibt: Wir bekommen jeden Tag neue Informationen, die sich teilweise auch widersprechen. Die Verantwortlichen müssen Entscheidungen treffen, die sie teilweise wieder revidieren, sie machen Fehler, sie irren sich. All das verunsichert und macht uns empfänglicher für »leichte Antworten«, die das anbieten, was wir vielleicht ohnehin hören wollen. Während uns Verschwörungserzählungen erst mal eine einfache Erklärung (»Corona gibt es nicht, das ist eine Lüge«) liefern, teilen sie die Welt außerdem in Gut und Böse ein (»Das wollen uns die da oben nur einreden – aber wir durchschauen ihre hinterlistigen Absichten«). Weil Corona als Krankheit eher schwer greifbar ist, machen es diese Erzählungen einem einfacher, sich an einem Feindbild abzuarbeiten.3 Und natürlich ist Covid-19 furchteinflößend. Wie viel leichter ist es da, einem Mythos anzuhängen, »das sei doch alles gar nicht so schlimm und nur eine harmlose Grippe«? Auf eine perfide Art und Weise kann ich das verstehen. In Deutschland gibt es 403 291 Fälle (Robert Koch-Institut, Stand 23.10.2020 4) – das bedeutet, dass die allermeisten von uns wahrscheinlich wirklich niemanden kennen, die oder der am Virus bislang erkrankt ist. Bis heute ist die Reaktion, wenn ich jemandem erzähle, dass ich tatsächlich Corona hatte und, ja, auch tatsächlich ziemlich krank war, in 90 Prozent der Fälle: »Ach, echt? Du bist die erste Person, die ich kenne, die das wirklich hatte.« Oft folgt: »Aber SO schlimm war es ja nicht, oder?«
2. Wir müssen widersprechen (lernen)
Corona-Verschwörungsmythen tauchen überall auf: In Familien-Whats-App-Chats, im Kolleg*innenkreis, in den Kommentarspalten unter Videos und Artikeln. Und weil sie eben überall auftauchen, muss es auch überall Menschen geben, die solchen Falschmeldungen widersprechen, antidemokratischen und antisemitischen Inhalten Einhalt gebieten und »Stopp« sagen. Wir müssen dabei bei denen ansetzen, bei denen das Weltbild noch nicht verfestigt ist – denn ab einem bestimmten Punkt werden Menschen immer schwerer erreichbar. Das ist im eigenen Familien- und Bekanntenkreis natürlich einfacher: Wir sind einander verbunden, man will sich nicht verlieren. Offen auf jemanden zugehen, Menschen nicht abwerten und alleine lassen, gerade in der unsicheren Situation, in der wir uns gemeinsam befinden. Was hilft: nachfragen, sich erkundigen, warum die Person aus dem eigenen Umfeld genau dieser Verschwörungserzählung glaubt. Dissonanzen aufzeigen, Unregelmäßigkeiten erklären. Hinterfragen, woher die Quellen für die Erzählung stammen. Und manchmal gilt es dabei auch, krude Theorien auszuhalten. Denn man muss sich auch die Frage stellen, ob reines Fakten-Gegenschleudern wirklich etwas bringt. Warum sollte ich dem Tagesschau-Artikel vertrauen, wenn ich nicht an die Lügenpresse glaube? Warum sollte ich staatlichen Statistiken glauben, wenn ich der Regierung nicht traue? Wer Medien und Politik misstraut, den erreicht man eventuell besser durch konkretes Nachfragen: »Warum dieses Video? Was erscheint dir daran glaubwürdig und warum?«
Im privaten wie im beruflichen Kontext gilt es dabei, für sich selbst rote Linien zu definieren. Wie weit bin ich bereit zu gehen? Bitte nicht vergessen: Verschwörungsmythen und -erzählungen beinhalten oft antidemokratische oder antisemitische Thesen, auch wenn sie vorgeben, die Demokratie hochzuhalten. Wenn wir menschenfeindlichen Aussagen begegnen, sollten wir darauf hinweisen und gegen sie einstehen. Was dabei hilft:
• Sich selbst ein Ziel für eine solche Diskussion setzen (ob mit den eigenen Eltern oder der Arbeitskollegin) und sich klar werden, wen man eigentlich erreichen möchte – die Person, die an einen Verschwörungsmythos glaubt? Oder Menschen, die danebenstehen? Oder Betroffene von Verschwörungsgläubigen?
• Sich klar werden, ob man inhaltlich für eine Diskussion gewappnet ist. Es kann helfen, sich in bestimmte Mythen und Erzählungen einzulesen, damit man nicht argumentearm und ermüdet abbrechen muss.
• Sich Unterstützung holen und auf die eigene mentale Gesundheit achten: Idealerweise zieht man nicht alleine in eine Diskussion rund um Verschwörungserzählungen. Und immer gilt: nur das tun, was einem selbst mental guttut beziehungsweise was man selbst aushält.5
Nicht hilfreich: pauschal diffamieren. Andere als #Covidioten oder Aluhüte zu betiteln ist einfach, klingt lässig, man steht auf der vorgeblich »sicheren« Seite. Dabei geht es doch eigentlich darum: Dinge differenziert zu betrachten. Einsicht zu gewinnen. Diejenigen mitzunehmen, die sich rational bewegen, die kritisieren, aber nicht vernunftswidrig handeln und für Argumente nicht mehr zugänglich sind. Und wir sollten auch nicht vergessen: Es ist absolut gerechtfertigt und notwendig, politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Prozesse und Vorgehensweisen kritisch zu hinterfragen. Das gilt ebenso für uns selbst. Jeder sollte in der Lage und offen dafür sein, seinen eigenen Standpunkt wieder und wieder zu beleuchten und eigene Argumente auf den Prüfstein zu stellen – es ist erlaubt und manchmal zwingend notwendig, die eigene Meinung zu ändern. Disclaimer: Als Autorin eines Buches, in dem es ein eigenes Kapitel zum Umgang mit verschwörungsideologischen Inhalten gibt, habe ich dort selbst zum Beispiel den »Verschwörungstheorie«-Begriff durchgängig genutzt. Ein Jahr später würde ich das heute anders machen, ich bin durch die Corona-Epidemie und ihre verschwörungsideologischen Auswüchse sowie neue Literatur zu dem Thema nun eines Besseren belehrt worden.
NICHT NUR MYTHEN SIND IMMER NUR EINEN KLICK WEIT ENTFERNT, SONDERN AUCH FAKTENCHECKS, VERIFIZIERTE INFORMATIONEN UND INHALTLICHE AUFKLÄRUNG – SOMIT SCHAFFT DAS INTERNET KONTEXT UND EINORDNUNG, DIE VOR INTERNETZEITEN GAR NICHT MÖGLICH GEWESEN WÄREN.
Zudem sollte man im Kopf behalten: An solche Inhalte zu glauben löst hohe psychische Belastungen aus, gerade wenn der Verschwörungsglaube immer stärker Teile des eigenen Alltags dominiert. Auch für die Familien von Betroffenen kann das eine immense Herausforderung darstellen. Nicht selten kommt es zum Bruch.
3. Wir müssen die Rolle des Internets einordnen
Das Internet spielt eine bedeutende Rolle bei der Verbreitung von Verschwörungsmythen und Falschmeldungen – auch in Corona-Zeiten. Natürlich, denn hier treffen und finden sich Gleichgesinnte, stoßen manche Menschen das erste Mal auf bestimmte Mythen und Fake-Infos. Verschwörungsideologen sind nicht mehr wie früher auf klassische Medien angewiesen, sondern können im Netz eigene Welten kreieren und via digitalen Plattformen ihr Publikum aufbauen und hohe Reichweiten erzielen. Hinzu kommt: Weil im Netz sowohl Pro- als auch Contra-Informationen vorhanden sind, stößt man beim Googeln zu einem bestimmten Thema, Beispiel »Impfen«, schnell auch auf Anti-Seiten. Im Netz zeigt sich außerdem, dass einige wenige oftmals ausreichen, um für Falschmeldungen und Verschwörungsmythen hohe Reichweiten zu erzielen.
Sowohl Twitter als auch Facebook wollen stärker gegen die Verschwörungserzählung von QAnon vorgehen und Nutzerkonten sperren, die diese Mythen verbreiten. Facebook hat außerdem seine Regeln, was Hatespeech gegen Jüdinnen und Juden angeht, verschärft. Allerdings: In den Ländern, in denen die Leugnung des Holocaust nicht unter Strafe steht und somit auch nicht geahndet wird, ändert sich nichts. Anders auf YouTube – sonst eher bekannt als Hort der endlosen Verschwörungsvideo-Loops, in denen man dank des Algorithmus, der einem ähnliche Videos vorschlägt, hängen bleiben kann: Hier ist Holocaustleugnung seit 2019 verboten.6 Trotzdem bleibt YouTube einer der Ursprungsorte für verschwörungsideologische Inhalte: Das Rechercheportal Correctiv fand heraus, dass Verschwörungsmythen über WhatsApp und Facebook zwar verbreitet werden, ihren Ursprung zumeist aber auf YouTube haben.7 Auch das ist eine Information, die wir im Hinterkopf behalten sollten, wenn in einem Chat ein verdächtiger Link auftaucht.
Das alles ist die eine Seite. Andererseits müssen wir, bevor wir das Internet als Quell allen Übels und Schuldigen für verschwörungsideologische Inhalte verteufeln, auch in Betracht ziehen, dass es dank des Netzes eben auch mehr Möglichkeiten denn je gibt, sich zu informieren. Nicht nur Mythen sind immer nur einen Klick weit entfernt, sondern auch Faktenchecks, verifizierte Informationen und inhaltliche Aufklärung – somit schafft das Internet Kontext und Einordnung, die vor Internetzeiten gar nicht möglich gewesen wären. Außerdem weisen Studien nach, dass Verschwörungsmythen schon vor der Existenz von YouTube, Facebook, Twitter und Co. weit verbreitet waren – und auch über klassische Medien gestreut wurden (und heute noch werden).8
Welche Verantwortung haben die sozialen Plattformen? Nocun und Lamberty verweisen darauf, dass Maßnahmen wie das Twitter-Verbot für politische Werbeanzeigen auf der Plattform und die Einführung von Faktenchecks auf Facebook nur ein Anfang sein können und die Wirksamkeit dieser Maßnahmen noch nicht bewiesen sei. Sie fordern einen ausführlichen Faktencheck auf YouTube – statt des aktuellen Wikipedia-Verweises.9 In Zeiten ausufernder Verschwörungsideologien, die irrationale Ängste vor einer globalen Pandemie bedienen und damit nicht nur die Gläubigen selbst, sondern uns alle betreffen (zum Beispiel durch Verweigerung der Corona-Maßnahmen, die uns alle schützen), halte ich einen solchen Ansatz für zutreffend – wir brauchen mehr Transparenz und einfachere Formen der Aufklärung, die dort greifen, wo Menschen im Netz auf bestimmte Aussagen treffen.
4. Wir müssen flächendeckende neue Angebote schaffen
Nicht nur im Internet brauchen wir für verschwörungsideologische Inhalte neue Angebote. Wir brauchen sie auf vielen unterschiedlichen Ebenen: politisch, gesellschaftlich, in der Wirtschaft ebenso wie in Schulen, für Jugendliche genauso wie für Erwachsene. Denn diese Inhalte sind eine Gefahr für den Zusammenhalt unserer Demokratie, sie werden genutzt, um politisch Stimmung zu machen, gegen PoCs,10 Geflüchtete, LGBTQ+, gegen Jüdinnen und Juden, überhaupt gegen marginalisierte Gruppen und auch gegen Frauen. Wir müssen aufhören mit dem »Das betrifft mich ja nicht«-Denken, denn die Auswüchse dieser politischen, antidemokratischen Stimmungsmache treffen uns alle.
Wir brauchen also flächendeckende, gesellschaftlich integrierte und, ja, auch staatliche Programme, die sich der Aufklärung widmen. So gibt es aktuell einige Beratungsangebote für Betroffene und/oder Familien von Verschwörungsgläubigen – zum Beispiel Sektenberatungsstellen in einigen Bundesländern. Expert*innen wünschen sich hier den weiteren Aus- und Aufbau spezialisierter Beratungsstellen für Angehörige mit psychologischer Expertise in genau diesem Bereich. Aktuell zögerten nämlich noch viele, sich an Stellen zu wenden, die den Fokus eher auf Sekten oder zum Beispiel Rechtsextremismus legten, da sie sich hier nicht »passend« fühlten.11 Ganz abgesehen davon, dass auch die aktuellen Angebote nicht alle darauf ausgerichtet sind, verschwörungsideologische Inhalte in der wachsenden Anzahl und aktuellen Dimension aufzufangen. Um so etwas aus- und weiter aufzubauen, braucht es klare finanzielle Zugeständnisse und Förderprogramme.
Neben (weiteren) Beratungsstellen wäre es ebenfalls an der Zeit, spezifische Aussteigerprogramme aufzusetzen und ärztliche Unterstützung anzubieten – beziehungsweise die Ärzteschaft zu sensibilisieren, zu schulen und zu unterstützen. Denn wenn Menschen an einen Verschwörungsmythos glauben und deshalb sich oder ihr Kind nicht adäquat behandeln oder impfen lassen wollen, schlägt dieses Problem in allererster Linie bei der Hausärztin oder dem Hausarzt auf. Um überhaupt eine Chance zu haben, richtig zu reagieren, Zugang zu den Patienten zu finden, braucht es auch hier Aufklärung und Informationen über aktuelle Verschwörungsdiskurse und gängige Argumentationslinien.12
Es gibt auch im deutschsprachigen Raum viele kluge Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Zivilgesellschaft, Journalismus, Wirtschaft, Politik, die sich schon heute dem Thema »Verschwörungsmythen« stellen. Darunter viele Personen, die dies in ihrer Freizeit tun, unentgeltlich oder für sehr wenig Geld und – weil sie in den Fokus bestimmter Verschwörungsideolog*innen und deren Anhänger geraten – vermehrt auch unter persönlicher Bedrohung. Wir müssen uns überlegen, wie wir diese Menschen besser schützen können. Wie auch in anderen Bereichen, zum Beispiel der Rassismusbekämpfung oder dem Kampf gegen Antisemitismus, stellt sich die Frage, welchen Preis Menschen bereit sein sollen, freiwillig zu zahlen, um sich füreinander und gegen antidemokratische Meinungsmache einzusetzen. Wer Angst haben muss, die eigenen Partner*innen oder Kinder zu gefährden oder dass die eigene Adresse aufgrund der aktuellen Impressumspflicht in die falschen Hände fällt, überlegt es sich in Zukunft vielleicht zweimal, ob sich der eigene Einsatz wirklich lohnt. So weit dürfen wir es nicht kommen lassen.
Giulia Silberberger vom Goldenen Aluhut, einer gemeinnützigen Organisation, die sich seit Jahren mit dem Monitoring verschwörungsideologischer Inhalte beschäftigt, wünscht sich mehr Grundlagenforschung und vor allem auch einen ganzheitlichen Ansatz zu diesem Thema: »Wir müssten alle Berufsgruppen besser vernetzen, um Erkenntnisse aufeinander aufzubauen und miteinander die richtigen Ansätze zu finden und zu entwickeln. Dafür braucht es gesicherte Finanzierung für die Beforschung dieser Szenen, die Auswertungen und das Monitoring. Genauso benötigen wir auch Pädagogen, die anhand dieser Forschung eigene medienpädagogische Angebote für unterschiedliche Zielgruppen entwickeln. Nur wenn wir die Grundlagen des Verschwörungsglaubens verstehen, können wir für Menschen Alternativangebote schaffen und sie dort abholen, wo sie stehen.«
Beim Thema Medienkompetenz wandert unser Blick schnell zu den Schulen. Sicher: Wir brauchen nicht nur Lehrer*innen, die in Krisenzeiten wie diesen in der Lage sind, »Fernunterricht per Internet als adäquaten Ersatz zum Schulunterricht anzubieten«.13 Sondern auch Lehrer*innen, die verstehen, wo sich junge Menschen informieren oder schlicht unterhalten lassen (sei es TikTok oder die Lieblings-Youtuberin oder ein Musiker, der auf Instagram krude Infos zum Besten gibt), und diese Themen dann aufgreifen, integrieren und hinterfragen. Das Wissen über die Funktionalität von Onlineplattformen und darüber, wie unser neues soziales Mediensystem funktioniert, ist unerlässlich, um einen kritischen Umgang mit Informationen – off- wie online – zu erlernen.
Doch angesichts der Tatsache, dass in Deutschland 95 Prozent aller Haushalte einen Internetanschluss haben,14 ist es nicht schwer, sich auszumalen, wer für einen Großteil der Verschwörungsmythen und -erzählungen im Netz verantwortlich ist: nicht die knapp elf Millionen Schüler*innen, sondern, genau, wir Erwachsenen, ja, auch wir Eltern. Insofern braucht es neben den Weiterbildungsprogrammen von Lehrer*innen ganz generell einen neuen, verantwortungsvollen Kommunikationsumgang mit dem Thema Verschwörungserzählungen.
Genauso wenig wie wir von allen Bürgerinnen und Bürgern eine ständige automatische Weiterentwicklung in technologischer Hinsicht erwarten können, müssen wir begreifen, dass demokratische (Weiter-)Bildung auch jenseits der Schule gefragt ist. Und zwar dort, wo Erwachsene sich aufhalten: in Vereinen, im Job, an den Hochschulen et cetera. Es ist einerseits Aufgabe des Staates, deutlich mehr Finanzierung in Projekte, Programme, medizinische und faktenbasierte Aufklärung zu lenken und so die Bekämpfung von verschwörungsideologischen Inhalten aus der finanziell prekären Nische zu holen. Ebenso sind Politikerinnen und Politiker gefragt, hier kluge Ansätze zu entwickeln, gute Programmförderung aufzubauen, unsere Gesetzgebung auf verschwörungsideologische Lücken hin zu überprüfen und angesichts Zehntausender Menschen, die gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren, neue Ansätze für unser Bildungssystem zu entwickeln.
Die Verantwortung für das Thema liegt aber andererseits genauso bei Wirtschaftsunternehmen, die davon profitieren, in einem demokratisch befriedeten und stabilen Land ihre wirtschaftlichen Tätigkeiten ausüben zu können. Auch sie können zu der Bekämpfung ihren Teil beitragen. So sollten wir über Demokratie-Siegel für Unternehmen nachdenken, Antiverschwörungsformate für Mitarbeitende, aber auch für CEOs, die sich gegen Verschwörungsmythen einsetzen wollen, oder auch verpflichtende Antiverschwörungsideologie-Schulungen für interne Kommunikationsverantwortliche und Social-Media-Manager*innen – auch für betriebsinterne Intranets. Vereine könnten Klauseln gegen derartige Inhalte in ihre Satzungen aufnehmen, um diejenigen zu ahnden, die sie verbreiten. So wie jeder in Deutschland laut Grundgesetz seine freie Meinung äußern darf, haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch das Recht, am Arbeitsplatz nicht mit verschwörungsideologischen Thesen konfrontiert zu werden. Weshalb Betriebsräte zu diesen Themen in Zukunft stärker gefragt sind und damit der Schulungsbedarf hier höher sein dürfte. Gerade weil verschwörungsideologische Inhalte sich oft politisch gegen marginalisierte Gruppen richten und menschenfeindliche Thesen beinhalten, haben Unternehmen die Pflicht, präventiv gegen möglicherweise daraus resultierende Diskriminierungen vorzugehen. Und in Pandemie-Zeiten ist es ebenso wichtig, potenziell gesundheitsgefährdende Theorien zu unterbinden und in unternehmenseigenen Bereichen eigene Ansätze dagegen zu entwickeln.
Ich hatte Glück: Meine Corona-Infektion verlief, wie man so schön sagt, »mittelschwer«, ohne Krankenhausaufenthalt, nach vier Wochen konnte ich wieder arbeiten gehen. Nicht allen geht es so – und auch wenn ich meine Geschichte erzähle, sind viele baff, da sie wirklich davon ausgehen, dass es sich bei dieser Krankheit höchstens um eine symptomlose Grippe handelt. Es sollte in unser aller Interesse liegen, Falschmeldungen und Verschwörungsmythen, die diese Pandemie verharmlosen oder ganz grundsätzlich Menschenleben gefährden, zu unterbinden. Nicht nur, weil ganz offensichtlich Tausende bereit sind, Seite an Seite mit Rechtsextremisten zu demonstrieren. Aber eben auch und gerade deshalb. Ich schlage vor: Fangen wir an. Mit besserer Finanzierung, einem Ausbau der Beratungsangebote, konkreter Vernetzung, mit aktiver Prävention, neuen Bekämpfungsansätzen und einem »Endlich raus aus der Nische«. Noch können wir verhindern, dass verschwörungsideologische Inhalte unsere Demokratie langfristig gefährden oder gar beschädigen. Wir müssen es aber jetzt endlich angehen.
Anmerkungen
1 Vgl. Katharina Nocun/Pia Lamberty: Fake Facts. Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Köln 2020, S. 25. Siehe dazu auch: Jonas Rees/Pia Lamberty: »Mitreißende Wahrheiten: Verschwörungsmythen als Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhang«. In: Andreas Zick/Beate Küpper/Wilhelm Berghan: Verlorene Mitte – Feindselige Zustände. Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2018/19. Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn 2019, www.fes.de/mitte-studie
2 Vgl. Franzi von Kempis: Anleitung zum Widerspruch, S. 108, 109.
3 Vgl. Franzi von Kempis: Anleitung zum Widerspruch, S. 100–104.
4 Siehe dazu auch: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
5 Siehe dazu auch: Franzi von Kempis: Anleitung zum Widerspruch, S. 101–103.
6 Vgl. zu diesem Absatz auch: »Was Facebook gegen Antisemitismus tut – und was nicht«, https://www.br.de/nachrichten/netzwelt/was-facebook-gegen-antisemitismus-tut-und-was-nicht,S8HzFGn, abgerufen am 3.9.2020. »Facebook blockiert Gruppen von ›QAnon‹-Verschwörungstheoretikern«, https://www.wiwo.de/social-media-facebook-blockiert-gruppen-von-qanon-verschwoerungstheoretikern/26111218.html, abgerufen am 3.9.2020.
7 Vgl. »Datenanalyse: Nutzer finden fragwürdige Corona-Informationen vor allem auf Youtube und verbreiten sie über Whatsapp«, https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2020/05/12/datenanalyse-nutzer-finden-fragwuerdige-corona-informationen-vor-allem-auf-youtube-und-verbreiten-sie-ueber-whatsapp, abgerufen am 3.9.2020.
8 Siehe hierzu auch: Katharina Nocun/Pia Lamberty: Fake Facts. Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Köln 2020, S. 38.
9 Katharina Nocun/Pia Lamberty: Fake Facts. Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Köln 2020, S. 151.
10 People of Color.
11 Siehe dazu auch: Katharina Nocun/Pia Lamberty: Fake Facts. Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Köln 2020, S. 239–297 und S. 303. Kirsten Dietrich: »Gefährlicher Verschwörungsglaube – Sinnsuche zwischen Gut und Böse«, https://www.deutschlandfunkkultur.de/gefaehrlicher-verschwoerungsglaube-sinnsuche-zwischen-gut.1278.de.html?dram:article_id=478069, abgerufen am 3.9.2020.
12 Christian Röther: »Warum Verschwörungsideologien die Demokratie gefährden«, https://www.deutschlandfunk.de/proteste-gegen-corona-massnahmen-warum.724.de.html?dram:article_id=482935, abgerufen am: 3.9.2020.
13 Zitat aus: Umfrage bei Lehrern: Schulen digital kaum gewappnet, https://www.tagesschau.de/inland/corona-lehrer-101.html, abgerufen am: 3.9.2020.
14 Vgl. dazu: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/153257/umfrage/haushalte-mit-internetzugang-in-deutschland-seit-2002/#:~:text=Im%20Jahr%202019%20waren%20rund,von%2016%2D74%20Jahren%20aufweisen, abgerufen am: 3.9.2020.