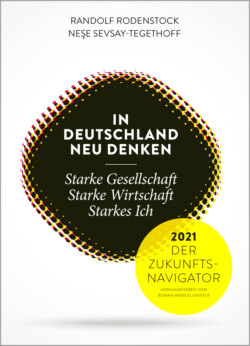Читать книгу RHI Zukunftsnavigator 2021: In Deutschland neu denken - Группа авторов - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеJudith Niehues
Getrübter Blick
… oder als wie (un)gerecht nehmen die Deutschen ihr eigenes Land wahr
Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit, Umsatzausfälle bei Unternehmen und steigende Arbeitslosigkeit – bereits jetzt wird über die möglichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das soziale Gefüge der Gesellschaft und die Verteilung der Krisenlasten debattiert. Wie genau sich die Krise auf die Verteilungsverhältnisse und das soziale Gerechtigkeitsempfinden im Land auswirkt, dazu lassen sich mangels hinreichender Daten zum aktuellen Zeitpunkt noch keine konkreten Aussagen treffen. Bekannt ist hingegen die Einschätzung der Bevölkerung zur sozialen Gerechtigkeit vor der Corona-Krise. Gemäß der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS) gaben im aktuell verfügbaren Erhebungsjahr 2018 knapp 75 Prozent der Befragten an, dass sie die sozialen Unterschiede in unserem Land als »eher nicht« oder »überhaupt nicht« gerecht empfinden. Die mehrheitliche Einschätzung ungerechter Verhältnisse ist zwar nicht neu, mit rund drei Vierteln der Bundesbürger reicht die negative Einschätzung jedoch erstmals wieder an den Höchstwert zu Zeiten der Finanzkrise heran. Der Zeitpunkt des neuerlichen Höchststands in der kritischen Wahrnehmung ist insofern überraschend, als er in eine Zeit sehr positiver wirtschaftlicher Entwicklung fällt, die Arbeitslosigkeit auf den Tiefstand seit der Wiedervereinigung gesunken ist und von den steigenden Reallöhnen erfreulicherweise besonders die niedrigeren Lohngruppen profitieren konnten.1 Da der Blick auf das gesellschaftliche Gefüge gleichwohl überaus pessimistisch ausfällt, stellt sich die Frage, wie überhaupt der subjektive Blick auf die Gesellschaft aussieht und wie die Veränderungen während der letzten Jahre wahrgenommen wurden.
Stabile Verteilungsverhältnisse
Wird nicht nach der Verwirklichung der sozialen Gerechtigkeit im Allgemeinen, sondern konkret nach der vermuteten Entwicklung der Ungleichheit gefragt, fällt die Einschätzung der Bundesbürger ebenfalls eindeutig aus. Gemäß einer Civey-Befragung von 5012 Teilnehmern im Frühjahr 2020 im Auftrag von Spiegel Online waren beispielsweise 43,9 Prozent der Befragten der Meinung, die Ungleichheit der Einkommen habe in den letzten fünf Jahren »eindeutig zugenommen«, weitere 28,6 Prozent teilten die Auffassung, sie habe »eher zugenommen«.2 Möchte man diese Einschätzung mit der realen Entwicklung vergleichen, stellt sich zunächst vor allem die Frage, welche Kennziffern herangezogen werden sollen. Da das verfügbare Einkommen nach Abgaben und inklusive Transfers entscheidend für die Konsum- und Sparmöglichkeiten eines Haushalts ist, steht die Verteilung dieser Nettoeinkommen konventionell im Vordergrund von Armuts- und Verteilungsanalysen.
Zwar liegt die heutige Ungleichheit der verfügbaren Einkommen in Deutschland – wie in vielen anderen Industrienationen auch – höher als noch in den 1980er- oder 1990er-Jahren. Seit 2005 hat sich das Niveau der Einkommensungleichheit jedoch nicht mehr wesentlich verändert.3 Die amtliche Sozialberichterstattung der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder weist beispielsweise auf Basis des Mikrozensus, der größten Haushaltsbefragung Deutschlands, für jedes Jahr zwischen 2005 und 2019 einen gerundeten Gini-Koeffizienten von 0,29 aus.4 Zwar werden die Einkommen im Mikrozensus nur klassifiziert und wenig detailliert abgefragt, dafür garantiert die gesetzlich verpflichtende Teilnahme eine weitgehend konsistente und repräsentative Stichprobe im Zeitablauf.
Es lässt sich sicherlich einwenden, dass es Teilgruppen in der Gesellschaft oder alternative Maße gibt, die auf einen Anstieg der Ungleichheit innerhalb der letzten Dekade hindeuten – die also mit der pessimistischen Wahrnehmung der Bevölkerung übereinstimmen. Zieht man jedoch die einschlägigen Indikatoren zur Messung der Einkommensungleichheit der Armuts- und Reichtumsberichterstattung der Bundesregierung 5 oder auch der amtlichen Sozialberichterstattung heran, dann zeigen die Befunde gleichermaßen, dass sich die Einkommensungleichheit seit mittlerweile mehr als einer Dekade nicht mehr wesentlich verändert hat.
Dieser Befund gilt auch für die Entwicklung der Ungleichheit der Nettovermögen. Entgegen weitläufiger Vermutungen, dass insbesondere die seit der Finanzkrise anhaltende Niedrigzinsphase mit den einhergehenden steigenden Immobilien- und Aktienpreisen zu einem starken Anstieg der Vermögenskonzentration führe, hat sich dieses in den verfügbaren Daten im Zeitraum bis 2017 bisher nicht gezeigt.6 Gleichwohl ist insbesondere die Messung der Vermögensungleichheit mit großen Unsicherheiten behaftet. Beispielsweise ist bekannt, dass die Untererfassung Hochvermögender in Befragungen eine Unterschätzung der Vermögensungleichheit impliziert. Ebenso hat die zusätzliche Erfassung von Vermögenswerten, die im unteren Vermögensbereich eine relativ größere Bedeutung haben (wie beispielsweise der Wert von Fahrzeugen), einen ungleichheitsmindernden Einfluss. Wie sich die Erfassungsprobleme jedoch auf die Entwicklung der Ungleichheit auswirken, lässt sich insbesondere rückwirkend kaum bestimmen.7
Festzuhalten bleibt, dass die Kernindikatoren der Einkommens- und Vermögensungleichheit innerhalb der letzten Dekade eine bemerkenswert stabile Entwicklung aufweisen. Es lässt sich zwar mit Recht kritisch hinterfragen, warum die Ungleichheit trotz der positiven Beschäftigungs- und Wirtschaftsentwicklung der letzten Jahre nicht eindeutig sinkt. In diesem Zusammenhang lassen sich die weiterhin steigende Nachfrage nach hoch qualifizierten Arbeitskräften und dem damit einhergehende Druck auf gering qualifizierte Arbeitsverhältnisse, ein zunehmender Trend zum Alleinleben oder auch die Migrationsbewegungen der letzten Jahre als einordnende Faktoren nennen. Unabhängig von der Bewertung dieser Erklärungsfaktoren verbleibt aber der Befund, dass die Wahrnehmung bezüglich der Entwicklung der Verteilungsverhältnisse deutlich negativer ausfällt, als es die konventionellen Verteilungsindikatoren nahelegen.
Reich sind immer die anderen
Gemäß der bereits zitierten Civey-Erhebung im Auftrag von Spiegel Online halten 74,8 Prozent der Befragten die Verteilung der Einkommen respektive die Verteilung der Vermögen für eher oder auf jeden Fall für ungerecht.8 Auch hier stellt sich die Frage, wie die Verteilungssituation überhaupt von den Bürgern wahrgenommen wird. Aufschluss ergibt in diesem Zusammenhang eine Befragung zur subjektiven Wahrnehmung von Armut und Reichtum, deren Ergebnisse im Rahmen des zweiten Symposiums zur Vorbereitung des 6. Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung vorgestellt wurden.9 Bei der Frage, ab welchem persönlichen Nettomonatseinkommen eine Person in Deutschland als arm gilt, liegen die Befragten mit Werten in der Nähe von 1000 Euro nicht nur nahe beieinander, sondern auch in der Nähe der Schwelle, die am häufigsten im Kontext der Berichterstattung über Armut verwendet wird. Im Mikrozensus 2019 liegt die sogenannte Armutsgefährdungs- oder auch Niedrigeinkommensschwelle für einen Alleinstehenden beispielsweise bei 1074 Euro monatlich, in der aktuell verfügbaren Welle des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) bei 1168 Euro im Jahr 2017.10 Die Werte auf Basis des SOEP liegen trotz des früheren Bezugszeitraumes höher, da bei dem detaillierteren Einkommenskonzept ebenfalls unregelmäßige Einkommenskomponenten und Mietvorteile aus selbst genutztem Wohneigentum berücksichtigt werden. Je nach Datensatz und Befragungszeitpunkt lagen in den letzten Jahren zwischen 16 und 17 Prozent der Bevölkerung mit ihrem verfügbaren Einkommen unter diesem Schwellenwert. Die meisten Bundesbürger glauben jedoch, dass in Deutschland mehr als 30 Prozent der Menschen als arm gelten.
Bei den Einschätzungen zum Thema Reichtum gehen subjektive Wahrnehmungen und statistische Messungen noch weiter auseinander. Die Reichtumsschwelle der amtlichen Statistik liegt bei dem Doppelten des Medianeinkommens der Gesamtbevölkerung. Das Medianeinkommen ist genau das Einkommen, welches die Gesellschaft in eine Hälfte mit niedrigerem und eine Hälfte mit höherem Einkommen aufteilt. Auf Basis der höheren Einkommen des SOEP zählte demnach ein Alleinstehender im Jahr 2017 zu den relativ Reichen, wenn er über ein monatliches Nettoeinkommen von mehr als rund 3890 Euro verfügte. Bei einer Familie mit zwei Kindern unter 14 Jahren liegt der entsprechende Schwellenwert zum relativen Einkommensreichtum bei einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen in Höhe von 8170 Euro. Mit mehrheitlichen Nennungen zwischen 7000 und 10 000 Euro liegen die Schwellenwerte, ab denen jemand in der subjektiven Vorstellung der Bundesbürger als reich gilt, deutlich höher.
Wegen der deutlich höheren subjektiven Reichtumsgrenzen ist es wenig überraschend, dass die (mediale) Kommunikation der statistischen Reichtumsschwellen regelmäßig zu Verwunderung führt. In den Reaktionen auf die Berichterstattung werden viele Gründe gefunden, warum man trotz eines Einkommens oberhalb des Schwellenwerts noch nicht als reich gilt. Sicherlich entspricht die amtliche Reichtumsschwelle nicht dem typischerweise kolportierten Bild eines Reichen, der Villen und Luxusyachten besitzt und völlig frei von materiellen Risiken lebt. Man sollte sich jedoch vor Augen führen, dass nur rund sieben Prozent der deutschen Bevölkerung über ein Einkommen oberhalb der zitierten Schwellenwerte verfügen – also bereits zum häufig zitierten oberen Zehntel der Gesellschaft zählen.
In der Wahrnehmung der Bevölkerung gibt es jedoch deutlich mehr Reiche. Die meisten Schätzungen zum vermuteten Anteil Reicher liegen oberhalb der 20-Prozent-Marke – und das, obwohl die Befragten gleichzeitig deutlich höhere subjektive Reichtumsgrenzen zugrunde legen. Zur Einordnung: Würde man beispielsweise nur diejenigen als »wirklich« reich definieren, die mit einem zu versteuernden Einkommen von 265 000 Euro der Reichensteuer unterliegen (bei einem Alleinstehenden entspricht dies monatlich knapp 12 000 Euro netto), dann zählten hierzu im Jahr 2018 nach Schätzungen der Bundesregierung rund 163 000 Personen 11 und somit weniger als 0,2 Prozent der Bevölkerung.
Die meisten Bundesbürger vermuten somit höhere Anteile armer und reicher Menschen, als es die Daten zu der Thematik nahelegen. Auch Abfragen zur vermuteten gesellschaftlichen Form – ohne konkreten Einkommensbezug – deuten darauf hin, dass die Wahrnehmung der Gesellschaft von den konventionellen statistischen Auswertungen abweicht. In unterschiedlichen Erhebungsformaten ist die Mehrheit der Deutschen der Auffassung, dass die deutsche Gesellschaft am ehesten der Form einer Pyramide ähnele.12 Auch wenn es unterschiedliche Bewertungen darüber gibt, ob die Mittelschicht einer stabilen oder schrumpfenden Entwicklung folgt, sind sich Schichtanalysen einig in dem Befund, dass die Mittelschicht die größte Gruppe der Bevölkerung darstellt. Ähnlich wie bei der Entwicklung der Ungleichheit wird somit auch die gesellschaftliche Struktur wesentlich pessimistischer wahrgenommen, als es Indikatoren zur Schichtabgrenzung für Deutschland nahelegen.
Positive Wahrnehmung der eigenen Situation
Neben der tatsächlichen Entwicklung der Verteilungsindikatoren steht häufig die Vermutung im Raum, dass sich bereits vor der Corona-Krise viele Menschen von der positiven wirtschaftlichen Entwicklung abgehängt fühlten und Abstiegsängste weit verbreitet seien. Befragungsdaten können dieses Bild jedoch nicht bestätigen. Im Gegenteil: In der aktuell verfügbaren SOEP-Erhebung des Jahres 2018 machen sich anteilig so wenige Menschen Sorgen um ihre eigene wirtschaftliche Situation wie zu keinem Zeitpunkt seit Beginn der Befragung im Jahr 1984. Die positiven Einschätzungen decken sich mit Beobachtungen aus der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften. Der Anteil derjenigen, die das Gefühl haben, dass sie weniger als den gerechten Anteil am Lebensstandard erhalten, ist in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich zurückgegangen. Bei der subjektiven Selbsteinordnung sortieren sich immer mehr Menschen in höhere Schichten. Auf einer zehnstufigen Oben-Unten-Skala sortierten sich im Jahr 2018 rund 50 Prozent der Bevölkerung bei einer Sieben oder höher ein. Im Jahr 2006 lag der entsprechende Anteil bei 25 Prozent. Zum damaligen Zeitpunkt fühlten sich deutlich mehr Befragte der Mitte und unteren Mitte der Skala zugehörig. Einhergehend mit der positiven Beschäftigungsentwicklung vor der Corona-Krise zeigt sich auch bei der Entwicklung der Sorgen um den Arbeitsplatz ein überaus positives Bild. Im Jahr 2018 gaben beinahe drei Viertel der Erwerbstätigen an, dass sie sich überhaupt keine Sorgen machen, weniger als fünf Prozent machten sich große Sorgen um die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes.
Es ist wichtig zu betonen, dass diese Befunde keinesfalls implizieren, dass es vor der Corona-Krise keine finanziellen Sorgen gab. Hinter den verbleibenden knapp zehn Prozent der befragten erwachsenen Bevölkerung, die sich im Jahr 2018 große Sorgen um ihre finanzielle Situation machten, steht die substanzielle Zahl von knapp sieben Millionen Erwachsenen, die ihre finanzielle Lage mit großer Besorgnis beurteilen. Im Jahr 2005 teilten jedoch noch knapp 19 Millionen Erwachsene im SOEP diese Einschätzung.
(Un-)Gleichheit und Gerechtigkeitseinschätzungen – kein eindeutiger Zusammenhang
Die Datenlage zeichnet ein weitgehend positives Bild für die Entwicklung seit 2005 – sowohl bezüglich objektiver Indikatoren von Einkommen und Vermögen und noch stärker bezüglich der subjektiven Wahrnehmung der persönlichen finanziellen Lage. Gleichwohl deuten Einschätzungen zum Zustand der Gesellschaft darauf hin, dass die individuell von vielen als positiv empfundene Entwicklung gesamtgesellschaftlich eher negativ beurteilt wird. Die kritische Beurteilung der sozialen Gerechtigkeit geht gleichzeitig mit dem Wunsch einher, dass der Staat die Unterschiede zwischen Arm und Reich reduzieren möge.13
Wenn die Menschen konkret gefragt werden, welche sozialstaatlichen Maßnahmen das Land aus ihrer Sicht gerechter machen, erhalten diejenigen Maßnahmen besonders große Zustimmung, von denen auch die Mitte und die obere Mittelschicht profitieren. Leistungen, von denen ausschließlich weniger privilegierte Gruppen profitieren würden und durch die die Ungleichheit am stärksten reduziert werden könnte, finden hingegen keine mehrheitliche Zustimmung. Werden Finanzierungsfragen mitberücksichtigt, zeigt sich zudem ein sehr begrenzter Ausgabenspielraum für ungleichheitsreduzierende Politik. Breite Zustimmung erhalten nur Maßnahmen, die einzig eine zusätzliche Belastung »der Reichen« bedeuten. Diese Finanzierungsform lässt sich besonders leicht fordern, da sich nur sehr wenige Bundesbürger selbst in hohe Einkommensbereiche einsortieren, geschweige denn sich selbst »als reich« bezeichnen würden, und somit nicht mit einer eigenen zusätzlichen Belastung rechnen. Beobachtungen aus Survey-Experimenten deuten darauf hin, dass insbesondere Gutverdiener von ihrem zuvor geäußerten Umverteilungswunsch abweichen, wenn sie erfahren, dass sie selbst zu dessen Finanzierung beitragen müssten.14
Da gleichzeitig viele Bundesbürger den Anteil der (sehr) Reichen in der Bevölkerung deutlich zu hoch einschätzen, wird zudem auch das Potenzial der Finanzierungsquelle überschätzt. Die Bundesbürger äußern somit zwar mehrheitlich den abstrakten Wunsch, dass die Ungleichheit zwischen Arm und Reich reduziert werden sollte. Mit Blick auf die konkreten Umverteilungswünsche und die Fehleinschätzungen zu den möglichen Finanziers der Maßnahmen ist es jedoch keinesfalls eindeutig, dass die Umsetzung der präferierten Maßnahmen in einer substanziellen Ungleichheitsreduktion resultieren würde.
Zugleich deuten Umfragen darauf hin, dass die Präferenz für Leistungsgerechtigkeit in Deutschland besonders ausgeprägt ist. Mehr als 80 Prozent der Bundesbürger halten eine Gesellschaft dann für gerecht, wenn hart arbeitende Menschen mehr verdienen als andere.15 Größere Gleichheit und ein höheres subjektives Gerechtigkeitsempfinden können sich somit durchaus in unterschiedliche Richtungen bewegen.
Vor Corona war die Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung überaus positiv, die Entwicklung der Verteilungsindikatoren stabil und die Wahrnehmung der individuellen Situation überaus positiv. Gleichwohl fiel der Blick auf die gesellschaftliche Situation sehr kritisch aus. Die Corona-Krise hat der positiven Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung mindestens temporär ein jähes Ende gesetzt. Ob und wie sich die Einschätzungen zur sozialen Gerechtigkeit infolge der Krise verändern werden, wird die nächste Welle der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage zeigen. Unabhängig von der Ungleichheitsentwicklung und anders als bei der Finanzkrise ist es durchaus denkbar, dass die Gerechtigkeitseinschätzungen sogar positiver ausfallen, da die Menschen während der Krise möglicherweise wieder »näher zusammengerückt sind«.
Auf diese Entwicklung deuten zumindest die Ergebnisse einer speziellen SOEP-Cov-Befragung hin, die zeigen, dass die Sorgen um den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft während der Corona-Krise merkbar gegenüber den Vorjahren zurückgegangen sind.16 Zudem bleibt zu hoffen, dass die umfangreichen staatlichen Maßnahmen die negativen Krisenwirkungen so gut abfedern, wie es bei der Finanzkrise gelungen ist. In der Rückschau lassen sich die Jahre vor der Corona-Krise, mit Rekordbeschäftigung, stabilen Verteilungsverhältnissen und sinkenden Sorgen, sicherlich als eine eher »gute Zeit« einordnen – wenngleich die kritischen Gesellschaftsbewertungen der Bürger kaum eine positive Entwicklung erahnen ließen.
Anmerkungen
1 Vgl. Alexandra Fedorets/Markus M. Grabka/Carsten Schröder/Johannes Seebauer (2020): »Lohnungleichheit in Deutschland sinkt«. DIW Wochenbericht, Jahrgang 87, Nummer 7, S. 91–97.
2 SPIEGEL Online, 05.03.2020, https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/buerger-empfinden-deutschland-als-extrem-ungerecht-a-bed86bc6-aecc-4b00-b0a5-a1519ebfc111, abgerufen am 31.08.2020.
3 Vgl. Maximilian Stockhausen/Mariano Calderón: »IW-Verteilungsreport 2020. Stabile Verhältnisse trotz gewachsener gesellschaftlicher Herausforderungen«. IW-Report, Nummer 8, Köln 2020.
4 http://www.statistikportal.de/de/sbe/ergebnisse/einkommensarmut-und-verteilung/a12-gini-koeffizient-der-aequivalenzeinkommen, abgerufen am 31.08.2020. Der Gini-Koeffizient stellt ein häufig verwendetes Ungleichheitsmaß dar. Verfügen alle Bürger über gleich hohe Einkommen, liegt der Gini-Koeffizient bei null. Besitzt ein Bürger alles und alle anderen nichts, liegt der Koeffizient bei eins (maximale Ungleichheit).
5 https://www.armuts-und-reichtumsbericht.de/DE/Indikatoren/Gesellschaft/gesellschaft.html, abgerufen am 31.08.2020.
6 Vgl. Maximilian Stockhausen/Judith Niehues: »Vermögensverteilung: Bemerkenswerte Stabilität«. IW-Kurzbericht, Nummer 81, Köln 2019.
7 Vgl. Judith Niehues/Maximilian Stockhausen (2020): »Ungleichheit(en), ein bekanntes Phänomen?«. ifo Schnelldienst, Jahrgang 73, Nummer 2, S. 3–6.
8 SPIEGEL Online, 05.03.2020, https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/buerger-empfinden-deutschland-als-extrem-ungerecht-a-bed86bc6-aecc-4b00-b0a5-a1519ebfc111, abgerufen am 31.08.2020.
9 Vgl. Jule Adriaans et al. (2020): »Einstellungen zu Armut, Reichtum und Verteilung in sozialen Lagen in Deutschland«. Zweites Symposium zum 6. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, https://www.armuts-und-reichtumsbericht.de/SharedDocs/Downloads/Berichte/zweites-symposium-arb6-praesentation-diw.pdf?__blob=publicationFile&v=1, abgerufen am 31.08.2020.
10 Vgl. Karl Brenke (2018): »Armut: vom Elend eines Begriffs«. Wirtschaftsdienst – Zeitschrift für Wirtschaftspolitik. Jahrgang 98, Heft 4, S. 260–266.
11 Vgl. Bundesregierung: Antwort der Bundesregierung auf Kleine Anfrage – Drucksache 19/8837. Hrsg.: Deutscher Bundestag, Berlin, 29. März 2019, https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/088/1908837.pdf, abgerufen am 31.08.2020.
12 Vgl. Carina Engelhardt/Andreas Wagener (2018): »What do Germans think and know about income inequality? A survey experiment«. Socio-Economic Review, 16 (4), S. 743–767; Judith Niehues (2016): »Ungleichheit: Wahrnehmung und Wirklichkeit – ein internationaler Vergleich«. Wirtschaftsdienst, Jahrgang 96, Heft 13, S. 13–18.
13 Vgl. Judith Niehues (2019): »Subjektive Umverteilungspräferenzen in Deutschland«. IW-Trends, Jahrgang 46, Nummer 1, S. 79–98 und die darin zitierten Quellen für eine weitere Diskussion der Thematik.
14 Vgl. Carina Engelhardt/Andreas Wagener (2018): »What do Germans think and know about income inequality? A survey experiment«. In: Socio-Economic Review, 16 (4), S. 743–767.
15 Vgl. Jule Adriaans/Philipp Eisnecker/Stefan Liebig (2019): »Gerechtigkeit im europäischen Vergleich: Verteilung nach Bedarf und Leistung in Deutschland besonders befürwortet«. DIW-Wochenbericht, Jahrgang 86, Nummer 45, S. 817–825.
16 Vgl. Kühne, Simon/Kroh, Martin/Liebig, Stefan/Rees, Jonas/Zick, Andreas (2020), »Zusammenhalt in Corona-Zeiten: Die meisten Menschen sind zufrieden mit dem staatlichen Krisenmanagement und vertrauen einander«. DIW aktuell Nr. 49.