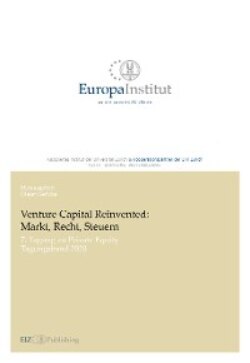Читать книгу Venture Capital Reinvented: Markt, Recht, Steuern - Группа авторов - Страница 11
Rechte an Forschungsergebnissen
ОглавлениеMotor für die rechtliche Entwicklung bezüglich Hochschulerfindungen in der Schweiz und in anderen Industrienationen, wie z.B. Deutschland und Japan, war das Inkrafttreten des sog. Bayh-Dole Act in den USA im Jahr 1980.[24] Dieser sieht vor, dass die Hochschulen, Forschungsergebnisse, die unter Verwendung von Bundesmitteln entstanden sind, selbst verwerten dürfen – zuvor lag dieses Recht bei der U.S. Bundesregierung, die in der Regel nur einfache Lizenzen vergab, sodass sowohl den Universitäten als auch den Unternehmen der Anreiz fehlte, diese Hochschulerfindungen zu verwerten bzw. in diese Erfindungen zu investieren oder sie weiterzuentwickeln.[25] Der Bayh-Dole Act beflügelte den Technologietransfer in den USA ungemein[26] und bildet nach wie vor den rechtlichen Rahmen für Erwerbs- und Lizenzverträge zwischen Schweizer Unternehmen und in den USA ansässigen Forschungseinrichtungen und Universitäten.
In der Schweiz galt zunächst mangels spezifischer Rechtsgrundlage das immaterialgüterrechtliche Schöpferprinzip: Professoren oder sonstigen Angestellten der Hochschule, die im Rahmen ihrer Forschungstätigkeit an der Universität eine Erfindung gemacht hatten, standen die Rechte an dieser Erfindung mangels spezialgesetzlicher Regelungen gemäss den allgemeinen patentrechtlichen Vorschriften zu;[27] Art. 332 OR fand nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und vorherrschender Meinung in der Literatur keine Anwendung auf das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis zwischen Hochschule und Professor bzw. sonstigen Angestellten der Hochschule.[28] In den 1990er Jahren wurden dann auf Bundes- und kantonaler Ebene spezifische Regelungen für das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis an Hochschulen eingeführt.[29] Heute sehen die anwendbaren Hochschulgesetze vor, dass Erfindungen, die von Mitarbeitern in Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit gemacht werden, im Eigentum der entsprechenden Hochschule stehen und von dieser verwertet werden dürfen, wobei der jeweilige Forscher angemessen am Verwertungsgewinn zu beteiligen ist (vgl. z.B. Art. 36 Abs. 1 und 3 ETH-Gesetz; §12 a Abs. 1 UniG ZH). Dies gilt in der Regel auch für andere Immaterialgüterrechte als Erfindungen mit Ausnahme von Urheberrechten. Für Urheberrechte bestehen Sonderregelungen, wobei die ausschliesslichen Verwertungsbefugnisse für Computerprogramme, die von Hochschulangehörigen im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit geschaffen werden, in der Regel ebenfalls bei der Hochschule liegen.[30] Zu beachten ist, dass nur Personen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen, in den personellen Anwendungsbereich dieser Regelungen fallen.[31] Immaterialgüterrechte, die von anderen Personen, insb. Studenten, geschaffen werden, fallen den Hochschulen nur zu, wenn eine Abtretungsvereinbarung mit der Hochschule unterzeichnet wurde.
Ist geklärt, wem die Eigentums- bzw. Verwertungsrechte an den Forschungsergebnissen zustehen, stellt sich die Frage, wie die Rechte in das neu gegründete Spin-off eingebracht werden. Stehen die Forschungsergebnisse im Eigentum der Gründer, erfolgt diese Einbringung in der Regel im Rahmen einer Sacheinlage.[32]
Stehen die Forschungsergebnisse im Eigentum der Hochschule, kommen zwei Möglichkeiten für die Einbringung dieser Rechte in das Spin-off in Betracht: entweder eine Lizenzierung oder eine Übertragung der Rechte als Einlage mit oder ohne Ausgabe von Aktien. Die Hochschulen präferieren in aller Regel klar die Lizenzierung. Dies hat verschiedene Gründe. Zum einen haben die Hochschulen bei einer Lizenzierung bessere Steuerungsmöglichkeiten, um sicherzustellen, dass die Forschungsergebnisse – im Einklang mit dem gesetzlichen Auftrag der Hochschulen[33] – der Gesellschaft möglichst breit zugutekommen. So können sie die Lizenz z.B. auf ein bestimmtes Feld beschränken und die Technologie in anderen Feldern an andere Lizenznehmer lizenzieren. Zudem kann die Hochschule die Lizenz mit Entwicklungs- und Kommerzialisierungsverpflichtungen (sog. „diligence obligations“) oder spezifischen Meilensteinen verknüpfen und Kündigungsrechte oder andere Sanktionsmechanismen für den Fall vorsehen, dass die „diligence obligations“ nicht erfüllt bzw. Meilensteine nicht erreicht werden. Zum anderen hat ein Spin-off häufig auch nicht die finanziellen Möglichkeiten, um eine Technologie zu erwerben. Hier bietet sich ebenfalls eine Lizenz an, da die Zahlungen über den kompletten Lebenszyklus des lizensierten Patents oder Produkts gestaffelt werden können, z.B. mit einer geringeren Vorauszahlung (sog. „upfront payment“) und weiteren Zahlungen beim Erreichen von Meilensteinen.[34] Und schliesslich kann mit einer Lizenz und vertraglichen Kündigungsregelungen für den Fall des Konkurses auch der Konkurs-Gefahr besser begegnet werden.[35] Die Gründer präferieren in der Regel – auch im Hinblick auf zukünftige Investoren oder einen potenziellen Exit – eine Eigentumsübertragung an den Forschungsergebnissen. Allerdings scheitert dies in der Regel an der Bereitschaft der Hochschule und/oder ausreichend liquiden Mitteln des Spin-offs. Gangbarer Weg ist daher in der Regel die Einräumung einer ausschliesslichen Lizenz.
Zudem kann es bei Ausgründungen aus Hochschulen auch zu Interessenkonflikten kommen. Interessenkonflikte können sich insbesondere dann ergeben, wenn sich ein Professor oder sonstiger Angestellter der Hochschule (direkt oder indirekt) mit privaten Mitteln an der Ausgründung beteiligt oder eine operative Rolle oder ein Verwaltungsratsmandat im Spin-off Unternehmen übernimmt. In solchen Situationen ist besonders darauf zu achten, dass Immaterialgüterrechte der Hochschule dem Spin-off Unternehmen nur im Rahmen einer vertraglichen Regelung mit angemessener Gegenleistung zur Verfügung gestellt werden (insb. auf Grundlage eines Lizenzvertrages) und öffentliche Gelder und andere Ressourcen (Infrastruktur, Materialien, Personal) nicht zweckentfremdet werden. So sehen z.B. die sog. Spin-off-Richtlinien der ETH Zürich vor, dass zwar bei der Ausgestaltung der Lizenzkonditionen der negative freie Kapitalfluss des Spin-off Unternehmens berücksichtigt werden kann, insgesamt müssen die Konditionen jedoch marktüblich sein. [36]
Die Hochschulen haben zum Teil spezifische Regelungen zum Umgang mit Interessenkonflikten. So sieht etwa die ETH Zürich vor, dass sich ein Professor mit privaten Mitteln bis max. 20 Prozent an einem Spin-off Unternehmen beteiligten darf.[37] Sind bei der Gründung mehrere Professoren beteiligt, ist die gesamte Beteiligung aller Professoren bei der Gründung auf maximal 30 Prozent zu beschränken.[38] Interessenkonflikte sind gegenüber dem Vizepräsidenten für Forschung und Wirtschaftsbeziehungen offenzulegen.[39] Die Übernahme eines Verwaltungsratspräsidiums oder einer Geschäftsleitungsfunktion in einem Spin-off ist auf dessen Gründungsphase (in der Regel drei Jahre) zu beschränken und muss vom Präsidenten oder der Präsidentin der ETH bewilligt werden.[40] Eine Nutzung von Räumen, Geräten und immateriellen Gütern der ETH Zürich durch ein Spin-off Unternehmen bedarf einer vertraglichen Regelung mit dem Vizepräsidenten für Forschung und Wirtschaftsbeziehungen.[41]