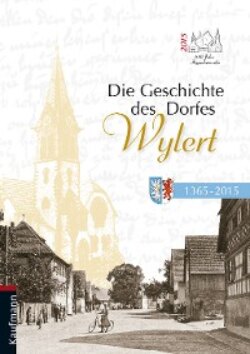Читать книгу Die Geschichte des Dorfes Wyhlert - Группа авторов - Страница 20
Die Nachkriegszeit von Stephan Hurst
ОглавлениеDie Nachkriegszeit
VON STEPHAN HURST
In den ersten Tagen nach dem Kriegsende in Kippenheimweiler kam es auch hier wie in vielen Nachbarorten zu Plünderungen von Fleisch, Eiern und Wertsachen wie Schmuck, Uhren und Fotoapparaten. Ebenso wurden Weinvorräte, Geflügel sowie Stallhasen entwendet, teilweise auch sinnlos aufgebraucht.
Die Mädchen wurden so gut es ging versteckt, um ihnen Schlimmeres zu ersparen. Trotzdem fanden mehrere Vergewaltigungen an Frauen im Dorf durch die französischen Soldaten statt. Besonders gefürchtet waren die nordafrikanischen Soldaten aus Marokko.
Fritz Fleig wurde vom französischen Militär zum neuen Bürgermeister bestimmt. Da er des Französischen und Englischen mächtig war, konnte er sich gut mit der Militärbehörde verständigen. Drohte Ungemach durch betrunkene Soldaten, meist aus den französischen Kolonien, so rief er unverzüglich die Kommandantur an, die dann die Militärpolizei sandte und für Ruhe und Ordnung sorgte. Die Situation im Dorf entspannte sich nach einigen Wochen, und die Zeit des Schreckens wich nach und nach der Hoffnung auf einen Neuanfang.
Die Franzosen nahmen die Vieh- und Tierbestände des Dorfes zusammen mit zwei Elsässern sowie den Kippenheimweiler Bürgern Emil Kuhn und Julius Siefert auf. Es wurden vor allem viele Schweine, Kühe und Pferde beschlagnahmt. Die konfiszierten Tiere mussten von den Landwirten nach Dinglingen an den Bahnhof geführt werden, von wo der Weitertransport nach Frankreich erfolgte. Nicht selten wurde hier und da ein Schwein oder Kalb unterschlagen und von der Dorfbevölkerung schwarzgeschlachtet, auch des Nachts. Da im Dorf französische Patrouillen erfolgten, war dies ein nicht ganz ungefährliches Unterfangen. Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt.
Werner Spathelfer berichtet:
Un wenn die (die französische Militärkontrolle) s’Dorf underieh kumme sinn, no hesch’s gwisst, des het sich so rumgschbroche, schneller wie hit middem Telefon. Un drno hänn sie dr Sau ä weng Schnaps oder Wiin niehgmacht, no sinn die ruhig gsieh un hänn gschlofe uffem Wage, un hänn Schdroh oder Gras druffgworfe un sinn durchs Feld gfahre. Wenn d’Franzose kumme sinn, sinn d’Wäge mit dr Sau druff rumgfahre. Die hänn sich dann nit griehrt, die ware bsoffe. No sinn mir als Kinder halt dänne Franzose hindenoh grennt, dänne Franzose.
Zuerst war von 18 Uhr an Sperrstunde, später von 20 Uhr bis morgens um 8 Uhr. Während dieser Zeit durfte keiner der Dorfbewohner auf der Straße sein. Wurde dennoch einer von der Patrouille aufgegriffen, dann wurde er mitgenommen. Die Radios und die Butterfässer/Plumpfässer mussten, mit Namen versehen, auf dem Rathaus abgegeben werden, damit keine illegale Butter gemacht werden konnte. Nach geraumer Zeit, etwa ein Jahr später, durften diese dann wieder abgeholt werden. Auf dem Land gab es immer etwas zu essen. Allerdings mussten gerade in der Nachkriegszeit die Verwandten aus den umliegenden Städten mit versorgt werden. Das Teilen gerade mit den Verwandten, welche kaum eigenes Essen hatten, war jedoch selbstverständlich.
Alltagsszene aus den 1950er-Jahren: Eugen Gänshirt fegt vor seinem Haus die Straße, die Kühe der Familie Otto Fleig werden von der Weide aus nach Hause gebracht, ein Volkswagen und ein Pferdefuhrwerk passieren gerade die Straße …
Im Hintergrund das heutige Anwesen Bernhard und Elsa Preschle.
Aus Kippenheimweiler wurden Otto Weis, Georg Weis und Emil Frenk im ehemaligen Arbeitsdienstlager von Dinglingen durch das französische Militär interniert. Dort wurden die ehemaligen NSDAP-Funktionäre aus Südbaden (Ortsgruppenleiter, Ortsbauernführer, einfache Mitglieder) zusammengeführt und zur Arbeit abgeurteilt. Die Angehörigen versuchten gelegentlich, ihnen am Lager Lebensmittel zuzuschieben. Über ihre genaue Haftdauer ist nichts Genaues bekannt, das Lager in Dinglingen wurde jedoch 1948 aufgelöst.
In den ersten Tagen nach Kriegsende lagen Munition und Waffen im Dorf frei herum: Für die Kinder war die Versuchung groß, sich diese anzueignen. Ein gefährliches und bisweilen auch leider tödliches Unterfangen.
Werner Spathelfer erinnert sich an einen tödlichen Unfall:
Werner Spathelfer: Do sinn jo ieberal Munitione rumgläge nachem Krieäg glich, also acht Dag schbäder oder so. Un do sinn, ich weiss dr Schuelkamerad vun mir, der war so ald wie ich, un dr Brueder, der het Heinz gheiße, un der isch, mir Kerli sinn halt ieberall rumgrennt un so … Ingrid Karl: Des hänn ihr eigentlich nit derfe? Werner Spathelfer: Ha doch, s’isch jo frei gsiehne, d’Franzose ware jo alle furt. Ingrid Karl: Aber vun dr Müdder halt nit? Werner Spathelfer: Achso fun daheim, die hän halt Angscht kahn um uns, aber dr hesch hald alles gfunde, Pulverschdängli, im Feld ieberall isch Zeigs rumgläge. Un do isch obedruff ä Panzerfauscht gläge. Un dr Heinz het des Ding in d’Händ gnumme un het mit dem ä weng gschbielt, un au ä weng dra rum glopft. Un pletzlich isch des losgange, un annäre Panzerfauscht, geht jo d’Munition vornüs, un hindenüs gibt’s ä Schdichflamm. Die hesch mien immer so hebe, dass hinde frei war. Un no hets ä Schdichflamm hindenüs gänn vunneme Meter un die Schdichflamm isch uff dr Heinz (Weis, *1935, †1945) un het anfange bränne un isch verbrennt. Un no sinn d’Anita Scheffler un d’Sleifir Martha un noch ä Frau relativ noh an der Bunger schbaziere gloffe, s’war ammä Sonndag, un do sinn die hiehgrennt un hänn d’Mändel ieberne deckt, aber der het halt schun brennt, bis die hiehkumme sinn, un no hänn sie ne halt, do hets jo noch kei Rotkriezwäge un nix so gänn, no hänn sie ne, wiesienä denn in ä Krangehüs hänn, weiss ich jetzt au nimmi, un no ischer gschdorbe, jaja. Un dann war fier uns Jungi dr Krieäg rum. D’Väddere ware dann nunit alli d’heim, no hesch halt schun ä wengeli Freilauf ghan, weisch, dr Müdder hesch halt au nimmi so ghorcht, wie dr halt hesch solle. Un drno hets wieder ä wenig ebbs z’kaufe gänn, un no hesch sell un des wieder kriägt, no war des halt alles ä weng lockerer un besser. Un dann isch ä scheni Zitt kumme. Dü hesch nit so lebe kenne im Saus un Braus. Aber im Prinzip hesch ä scheni Jugend genosse. Was uns halt gfehlt het, war in dr Schuel die einahalb Johr, des het dann schun ä weng gfehlt, aber des isch dann au kumme, nochher (lacht).
Die zerstörten Gebäude galt es wieder zu reparieren. Nennenswerte Hilfsmittel gab es dabei nicht:
Renate Weis-Schiff: In ejer Hüs isch jo au a Bomb nieh. Hilde Schiff: A Granat, ja. Renate Weis-Schiff: S’war jo au viel kabütt. Hilde Schiff: Jaja, un des hänn mir no alles sälber miän uffbäue, mir hänn jo nix bekumme drfier, mir hänn Bachschdein (Backsteine) butzt un hänn in Eigeleischtung des Hüs miän einigermaße herrichte.
Das Leben normalisierte sich in der Nachkriegszeit zusehends. Die Kriegsgefangenen kehrten teilweise erst nach Jahren wieder nach Kippenheimweiler aus der Gefangenschaft zurück, einige blieben vermisst. Für die Angehörigen und die betroffenen Familien war dies ein Leben voll schmerzhafter Ungewissheit. Denn unklar war oft, ob der Mann, Vater oder Bruder überhaupt je wiederkam oder ob dessen Schicksal für immer im Dunkeln blieb.
Wilhelm Hertenstein mit seinem Kuhfuhrwerk auf dem Weg nach Hause („s’Lise Jerge Wilhelm“, *1891, †1972). Im Hintergrund das Anwesen Hurter, heute: Sofie Schell / Familie Renate Lögler.
Die Rentnerbank in der Lindenstraße: Ein beschauliches Bild Anfang der 50er-Jahre, das heute (fast) verschwunden ist. V. l. n. r.: Franz Schröder (*in Ostpreußen 1888, †1955), August Weinacker (Wagner, *1865, †1951), Georg Hurst(*1878, †1962), Wilhelm Berne (*1872, †1963). Auf dem Gelände im Hintergrund befindet sich heute der evangelische Kindergarten.
Auf dem Heimweg vom Milchhäusle: Renate Weis-Schiff geb. Siefert (*1939) und Trudel Herrenknecht geb. Siefert (*1944) Mitte der 50er-Jahre. Kinder hatten früh Verantwortung zu übernehmen und waren für vielerlei Arbeiten voll eingeplant.
Verdienter Feierabend bei Familie Bohn. Nach getaner, wohl harter Arbeit strahlt Gerhard Bohn trotzdem eine spürbare Zufriedenheit aus. Neben ihm Sohn Reinhard Bohn sowie seine Frau Mathilde Bohn geborene Weis verw. Siefert.
Hilde Schiff und Renate Weis-Schiff berichten über die Flüchtlinge:
Hilde Schiff: Oja, mir hänn viele im Dorf ghan. Des isch jo genauso gsieh, dü hesch sounsoviel qm Wohnraum derfe hahn, un fir s’ander hesch Flichtling bekumme, hesch miän Flichtling zu dir nämme. Renate Weis-Schiff: Des war nit nur dr Burgermeischter, wu iteilt hett, do sinn au Fremdi drbie gsieh, des denkt mir au noch vun d’heim üs, do isch a Abordnung do irgendwu kumme. Uns hänn sie d’heim au niegsetzt. D’Großmüdder het in ihrem Zimmerli glebt un mir zwei (Anmerkung: Renate und ihr Bruder Richard Siefert) hänn mian bi dr Müdder im Schlofzimmer schlofe: Ei Zimmer het sie no derfe owe beanschbruche, un d’Kuchi owe un ein Zimmer hett mian vermietet were. Hilde Schiff: Vieli sinn vum Rheinland kumme. Üsgebomdi au. S’Hurschte Maxe, denkt dir noch sell klei Hiesli, die hänn alle d’Halfti abgann un hänn sich mian beschränke. Renate Weis-Schiff: Sie sinn jo nit verwehnt gsi in sellene Johre un mir jo au nit. Die sinn froh und dankbar gsieh, wenn sie guet uffgnumme wore sinn, was die hinder sich ghan hänn. Die wu gar nix meh ghet hänn. Die sinn oft middem Koffer kumme un meh war nit drbie sunscht. Hilde Schiff: Hajo, des ware armi Litt, nit.
Erst durch die Währungsreform am 20. Juni 1948 war es der Bevölkerung möglich, wieder vernünftige Waren für ihr Einkommen zu erhalten. Die Währungsgesetze der westlichen Alliierten sahen eine Barquote pro Kopf der Bevölkerung von 60 DM vor, von denen 40 DM am Sonntag, dem 20. Juni 1948, ausgezahlt wurden; der Rest folgte etwa zwei Monate später.
Auch für die ins Dorf kommenden Flüchtlinge war es eine schwere Zeit, hatten sie doch oft bis auf weniges alles verloren: ihren Besitz, ihr Haus, ihre Grundstücke – und ihre Heimat.
Mit wenig, dem, was auf dem Leiterwagen oder dem Handkarren Platz hatte, mit den Kindern und Angehörigen, kamen sie aus den Ostgebieten nach einer weiten, beschwerlichen und oft unvorstellbaren Odyssee mit Leid und Entbehrung im Westen an, auch in Kippenheimweiler.
Die damals als Flüchtlinge Angekommenen fanden sich relativ zügig zurecht. Die Arbeit in der Landwirtschaft war für viele der Neubürger die erste Möglichkeit, wirtschaftlich Fuß zu fassen. Das Verständnis der Bevölkerung für die schwierige Lage der Flüchtlinge war groß, und entsprechend war die Hilfsbereitschaft eine Selbstverständlichkeit.
Ein vertrautes Bild der ausgehenden 50er-Jahre: Herbert Hurst (*1936) war von 1968 bis 1999 als Verwaltungsangestellter im Dienst der Gemeinde und betrieb bis Mitte der 1980er-Jahre seine Landwirtschaft im Nebenerwerb wie viele im Dorf. Die Reben hatte er bis 2007. In 272 Sitzungen schrieb er während seiner Dienstzeit exakt 1.408 Tagesordnungspunkte nieder und war im Rathaus eine Institution: So ging man in Kippenheimweiler in Verwaltungs-, Renten- oder öffentlichen Angelegenheiten nicht ins Rathaus, sondern einfach zum Herbert.
Bei einem Gartenfest des MGV Sängerrunde: Gefeiert wurde schon immer ausgiebig und gesellig so wie hier, v. l. n. r.: Julius Stubanus, Emil Fleig, Albert Traber, ?, Julius Zipf, ?, Georg Siefert, Friedrich Fleig.
Aufmerksam verfolgen die Landfrauen in der Küche der „Linde“ die Zubereitung von Speisen, v.l.n.r.: Landwirtschaftslehrerin Wissel sowie unter anderem Hilda Siefert, Luise Zipf, Sieglinde Siefert, Hilde Schiff, Mathilde Zipf, Lena Fleig, Lina Weinert.