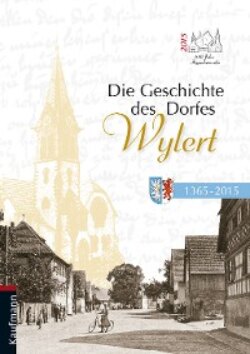Читать книгу Die Geschichte des Dorfes Wyhlert - Группа авторов - Страница 21
Ein 75-jähriger Altwylerter erinnert sich von Kurt Hertenstein
ОглавлениеEin 75-jähriger Altwylerter erinnert sich
VON KURT HERTENSTEIN
Sehr geehrte Leser und Betrachter dieses Buches!
Sehr begeistert bin ich vom Gelingen dieses Werkes mit den vielen Bildern, wozu an der Spitze Herr Stephan Hurst mit zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beigetragen hat. Besonders erfreut war ich darüber, als ich Ende März 2014 in einer Besprechung bei Stephan Hurst die Younglady Anna-Luise Labelle angetroffen habe. Sie half auch aktiv bei der Gestaltung des Buches mit, obwohl sie mit ihren Eltern lange Zeit in Kanada lebte.
Kurz nach Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde ich am 29. Januar 1940 in Kippenheimweiler geboren. Damals war in der Regel die Hebamme zuständig, besonders in der ländlichen Region. In meinem Falle war es Frau Christina Zipf, die Ehefrau vom Bahnbeamten Hermann Zipf. Die zwei waren die Urgroßeltern unserer Buchmitverfasserin Anna-Luise Labelle. Als mein Vater Ludwig Hertenstein einmal Fronturlaub bekam, war natürlich die Wiedersehensfreude mit seiner Frau, meiner Mutter Lydia geb. Zipf, so überwältigend, dass neun Monate später meine Schwester Margrit geboren wurde. Doch dann stand die Mutter mit dem landwirtschaftlichen Betrieb wieder alleine da. Glücklicherweise standen die Dorfbewohner zusammen; besonders die Familie Studer mit den ältesten Buben Richard, Bernhard und dem Vater Karl seien hier dankenswert erwähnt. Bei schweren Erntearbeiten halfen sie immer mit. Mein Vater Ludwig war nicht lange in Kriegsgefangenschaft. Er war in Frankreich bei einem landwirtschaftlichen Betrieb interniert und es ereilte ihn kurz vor Kriegsende ein Herzinfarkt im Alter von 42 Jahren. Nach der Behandlung in einer Straßburger Klinik kam er nach Hause. Das dritte Kind, mein Bruder Gerhard, kam zur Zeit der Währungsreform am 14. Juni 1948 zur Welt und ich höre noch heute meinen Vater sagen, dass er die Hebamme noch mit Reichsmark bezahlt habe, welche dann zu 90 Prozent abgewertet worden war.
Zu dieser Zeit wurden die Kinder auf dem Land stark zur Mithilfe in der Landwirtschaft herangezogen. Neben der Arbeit im Feld in den Sommermonaten musste ich auch im Winter ran; der Vater war als Holzmacher im Gemeindewald tätig. Dorthin mussten wir Schüler immer das Mittagessen bringen, zu Fuß bis in den „Dürren Schlag“ im Unterwald. Meistens waren wir zwei Stunden unterwegs. Dann begann die Arbeit zu Hause mit Rübenputzen, Heu vom Heuschober herunterwerfen, die Stallhasen füttern, die Eier aus den Hühnernestern holen oder in der Rübenmiete auf dem Feld weiße Rüben und Runkelrüben holen. Da kam keine Langeweile mit null Bock auf wie oft in der heutigen Zeit. Doch an frostigen Tagen blieb auch mal Zeit zum Schlittschuhlaufen, meistens bei der „Hanfrözi“, beim Rebweg am Bahndamm. Dort in dem großen Weiher konnte man übrigens im Sommer auch baden gehen. In den ersten Nachkriegsjahren fuhr dort immer 10 Minuten vor 16 Uhr der Amerikanerzug vorbei mit Soldaten oder Zivilpersonen. Nicht umsonst warteten wir am Bahndamm, bis Päckchen voller Bohnenkaffee oder Schokoladentafeln von den Fahrgästen aus dem Zug geworfen wurden. Eishockey wurde damals auch schon gespielt.
Natürlich war die „Kinderarbeit“ in der Landwirtschaft nicht ganz ungefährlich. Im Alter von sieben Jahren musste ich abends immer Rüben rätschen. Die Rübenmühle hatte an der unten frei liegenden Walze viele Stahlzähne, die in gebogener Form ca. 5 cm lang und 1 cm stark waren. Die Mühle war etwa 1,50 m hoch, frei hängend und mit zwei Flacheisen an der Wand befestigt. Oben war ein Kasten aus Holz, in den die Rüben eingefüllt wurden. Als die Mühle am Laufen war, angetrieben vom Futterschneidemotor mit 1 kW, hielt ich mich oben am Einfüllkasten fest und zog mich hoch, die Füße an der Wand auf die Flacheisen gestellt. Ich wollte ja nur mal sehen, was da drinnen ablief, doch meine Neugier wurde bestraft. Danach nahm die Entwicklung ihren Lauf und ich war vermutlich der erste Mensch in Deutschland, der unter Zuhilfenahme des linken Knies einen Motor zum Stehen brachte. Vater war zum Rübenholen in der Scheune und hörte das Stottern des Motors. Da er der Meinung war, es sei eine Rübe zwischen Riemen und Antriebsrad geraten, rief er mir von draußen zu: „Kurt, stell ab!“ Vor Angst gab ich jedoch keine Antwort. Vater kam in den Futtergang und sah die Bescherung. Er stellte den Motor aus und befreite mich aus der misslichen Lage: Einer der Stahlhaken hatte sich in mein Schienbein unterhalb des Knies eingegraben. 1947 war es mit Krankentransporten noch nicht so weit her. Meine Eltern setzten mich in den Schesenwagen und Mutter marschierte mit mir nach Kippenheim zum Hausarzt Dr. Eggs neben der Eisenhandlung Müller in der Hauptstraße. Dieser nähte die offene Wunde ohne Narkose zu.
Wir drei Kinder bei Hertensteins in der Bahnhofstraße wurden „in der Zucht und Vermahnung zum Herrn“ erzogen und mussten regelmäßig zum Gottesdienst. Dafür sorgte hauptsächlich die Großmutter Christine, welche eine sehr fromme Frau war. Und als nach Pfarrer Wiederkehr Pfarrer Henschke die evangelischen Kirchengemeinden Kippenheim und Kippenheimweiler übernahm, konnte man einen Anstieg der Kirchgängeranzahl feststellen. Sein Slogan war: „Ein Sonntag ohne Gottesdienst ist kein Sonntag.“ Auch das Opfergeld beim Gottesdienst stieg etwas an, denn wenn der Pfarrer um das Opfergeld bat, war sein Spruch immer: „Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.“
Bekanntlich wurden ja während des Zweiten Weltkrieges in den meisten Kirchen die Glocken zum Bau von Geschützen und sonstigen Waffen demontiert. Die Weihe der neuen Glocken 1949 war auch schon für mich im Alter von neun Jahren ein feierliches Ereignis, vor allen Dingen die technische Seite mit dem Hochziehen der Glocken in den Turm. Auf dem großen landwirtschaftlichen Anhänger der Familie Frenk waren die Glocken zunächst durchs Dorf gefahren worden, flankiert von den ganz in Weiß gekleideten Mädchen im Alter von ca. 14 Jahren. Auf dem Kirchvorplatz fand der Einweihungsgottesdienst statt. Auch der Gemeinderat und der damalige Bürgermeister Friedrich Fleig gestalteten die Feier mit.
Bei uns Buben entwickelte sich ständig eine große Sucht danach, die Glocken zu läuten. Unzählige Male begab auch ich mich zu Mesners (Familie Siefert) und trat vom Kirchplatz aus an das Küchenfenster, um die Schlüssel für die Kirche zu erhalten. Bereitwillig bekam ich diese dann durch Frau Frieda Siefert oder die Tochter Erika (heute: Frau Bohnert) ausgehändigt.
Im Jahr 1949 wurde der Sportverein gegründet. Es gab am Anfang nur die Abteilung Fußball. Einige Wylerter Fußballer spielten damals in Kippenheim. Nach der Gründungsversammlung im Gasthaus „Linde“ wurde dem Fußballbezirk Offenburg eine Mannschaft für die C-Klasse gemeldet. Wir Jugendliche kickten schon vorher meistens hinter dem Dreschschopf auf der dortigen Wiese. Als ich 17 Jahre alt war, sprach mich der damalige erste Vorsitzende, Hauptlehrer Karl Herrmann, an mit der Frage: „Willst du nicht Schriftführer machen beim Sportverein?“ Ich war etwas perplex, doch wusste ich, dass der erste Schriftführer des Vereins, Richard Studer, infolge seiner Heirat nach Offenburg umgezogen war und sein Nachfolger Kurt Gäßler beruflich nach Karlsruhe zog. So nahm ich diese Tätigkeit an und versah sie – mit kleinen Unterbrechungen wie zum Beispiel 18 Monate Wehrdienst bei der Bundeswehr – 27 Jahre lang. Auch hinterher lag mir der Verein immer sehr am Herzen, mich freute einfach die Arbeit mit der Jugend. Mit 17 Jahren war ich auch als Trompeter und Flügelhornist in die Musikkapelle eingetreten unter Dirigent Richard Werfel. Dieses Musizieren war übrigens der Übergang zur Gründung der Tanzkapelle Hertenstein durch den Musikkollegen Bruno Hertenstein. Er sagte damals Anfang 1959 sinngemäß: „Ich spiele Akkordeon, Hans Heck Gitarre, Heinz Berne Saxophon“, und zu mir, „du spielst Schlagzeug.“ Ich hatte keine Ahnung, spürte aber immer schon einen gewissen Rhythmus in mir. Freundlicherweise lieh mir Richard Baier sein Schlagzeug aus, wofür ich ihm heute noch dankbar bin. Es wurden daraus 55 Jahre in verschiedenen Tanzkapellen bis Ende 2013. Zuletzt waren es 15 Jahre im Senioren-Akkordeonorchester Friesenheim. Immer ging ich mit Fröhlichkeit und Begeisterung an die musikalische Arbeit und kam immer mehr zur Erkenntnis: Wenn die Menschen immer gut arbeiten, singen und musizieren und das biblische Gebot „Seid allzeit fröhlich!“ halten würden, dann gäbe es bestimmt keine Kriege auf der Welt.
Wir Hertensteins in der Bahnhofstraße wurden „s’Schange“ genannt. Der Großvater hieß Christian – im Elsass sagte man dazu „Chrischang“. Somit war mein Vater der Schange-Ludwig. Wir Kinder: dr Schange-Kurt, die Schange-Margrit und dr Schange-Gerhard. Unser Vater war im ganzen Dorf der Holzsäger. Er besaß eine fahrbare Kreissäge, deren großes Sägeblatt angetrieben wurde durch einen 5 PS starken Elektromotor. Bis etwa zu seinem 65. Lebensjahr betrieb er die Holzsägertätigkeit im Dorf. Der Motor hatte einen eigenen Stromzähler, die Kilowattstunden wurden zusammen mit den Hauszählern abgelesen. Den Strom holte unser Vater direkt an den Oberleitungen im Dorf, die er mittels Steigbügeln bestieg. Auf der Kabelrolle hinten am Sägefahrzeug befanden sich ca. 150 m Kabel. Meistens wurden im Umfeld mehrere Sägetermine zusammengelegt. Im Schopf des Ökonomiegebäudes zu Hause befand sich eine große Schrotmühle, mit der das Getreide der Kundschaft zu Viehfutter gemahlen wurde. Mit dem Leiterwägelchen oder sonstigen Fahrzeugen brachten die Dorfbewohner das Getreide in Jutesäcken. Das Mahlen eines Zentners brachte in den 1950er/60er-Jahren etwa 2 DM ein. Als Antrieb der Schrotmühle diente ebenfalls der 5-PS-Motor auf der Kreissäge. So hatten ich und auch später mein Bruder Gerhard fast täglich Gelegenheit, die Arbeit an der Schrotmühle zu verrichten, und wir kamen daher nicht auf dumme Gedanken. Die Konstruktion der Kreissäge und der Schrotmühle verdankten wir dem Onkel Heiner, Heinrich Zipf, Bruder von Lydia Hertenstein, unserer Mutter. Er war leider im Zweiten Weltkrieg gefallen und hinterließ die Ehefrau Berta aus Langenwinkel mit Sohn Klaus.
Zu unserem landwirtschaftlichen Betrieb gehörten auch Reben: zwei kleine Stücke mit 10 Ar „Im Ehrental“ an der Straße nach Sulz, ein weiteres Stück zu 5 Ar in der Gemarkung Kippenheim im Gewann „Haselstaude“. Bekanntlich war in der damaligen Zeit Ackerbau und Viehzucht dominierend im Dorf. Dieses wurde seinerzeit von etwa 650 Einwohnern bewohnt.
Alles Weitere aus der geschichtlichen Entwicklung des Dorfes ist ja im Buch erfasst; lediglich auf die damalige Volksschule möchte ich noch kurz eingehen. Hier ging es äußerst streng zu. Mit Fräulein Wöhrle und Lehrer Herrmann war selten zu spaßen. Oft gab es „Tatzen“ von der Lehrerin oder eine „Watschen“ vom Herrn Lehrer. Eine Geschichte erzählte man schon damals im Dorf. Ein Schüler musste sich – bäuchlings – auf den Tisch legen, da er mit einem Stock vom Lehrer auf den Po geschlagen werden sollte. Der Schüler hatte dies zuvor schon geahnt und einen dicken Atlas in die Hose geschoben. Zum Pech des Schülers schaute der Atlas jedoch etwa 2 cm aus dem Hosenbund raus. Als der Lehrer dies sah, war er nicht mehr zu bremsen, schäumte vor Wut und schlug so um die 20 Mal zu.