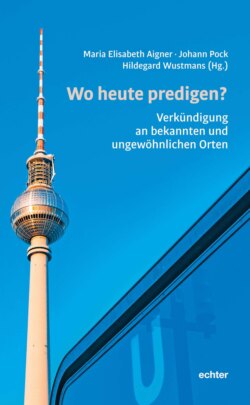Читать книгу Wo heute predigen? - Группа авторов - Страница 10
ОглавлениеDie Predigt beim Gottesdienst in der Schule und ihre Bedeutung
Christoph Buda
1. Schule als missionarischer Ort in einer säkularisierten Gesellschaft
Am Beginn des 21. Jahrhunderts leben wir in einer komplexen, stark säkularisierten Gesellschaft, in der das Thema Religion immer stärker in den privaten, fast intimen Bereich der eigenen Lebensführung und Lebensentscheidung ausgelagert wird. Im öffentlichen Leben spielt es kaum mehr eine Rolle.1
In der Schule ist das (noch) anders, da es den Pflichtgegenstand Religion2 gesetzlich verankert in Österreich gibt und die jungen Menschen in Ausbildung, ungeachtet, ob sie diesen besuchen oder nicht, praktisch täglich damit konfrontiert werden – einerseits durch die Schülerinnen und Schüler, die an ihrem konfessionellen Religionsunterricht teilnehmen, andererseits durch Religionslehrerinnen und Religionslehrer, die ihnen ja nicht nur als Fachlehrerinnen und Fachlehrer begegnen, sondern einfach als Lehrerinnen und Lehrer. Diese sind Teil der Schulgemeinschaft und stehen ihnen immer wieder als Ansprechpersonen in verschiedenen Situationen des Schulalltags zur Verfügung. Mit einem Mal wird Religion ein Teil der Lebenswirklichkeit, auch für jene, die zuvor damit vielleicht noch niemals wirklich in Berührung gekommen sind.
Damit beinhaltet die Schule, wie kaum ein anderer Ort (abgesehen vom Friedhof), eine pastorale und missionarische Chance, in Menschen für etwas Interesse zu wecken, was sie in ihrem sonstigen Lebensumfeld kaum bis gar nicht mehr wahrnehmen – Religion.3 Es liegt an der Person der Religionslehrerin/des Religionslehrers, diese auch zu nützen und sich den damit verbundenen Herausforderungen zu stellen. Dort, wo das geschieht, wird vieles möglich.
2. Religiöse Übungen im Schulalltag
Religion lebt vom Glauben des einzelnen und vom gemeinsamen Tun, wie dem Feiern von Gottesdiensten. In unserer Schule4 bemühen wir uns um eine Kultur des Feierns. Das bedeutet, dass die Feste, auch religiöse, in das schulische Geschehen integriert sind und jede Schülerin und jeder Schüler sowie jede Lehrperson dazu eingeladen ist. Fixe Bestandteile unseres gemeinsamen Lebens und Arbeitens in der Schule sind:
• Ein Eröffnungsgottesdienst am Beginn des Schuljahres in der Pfarrkirche.
• Eine Adventkranzsegnung in der Aula5 der Schule.
• Ein vorweihnachtlicher Gottesdienst am letzten Tag vor den Weihnachtsferien in der Aula der Schule unter Mitwirkung des Schulchores6.
• Ein sehr lebendig gestalteter Gottesdienst in der Osterzeit mit wechselnden Schwerpunkten (Auferstehung, Himmelfahrt oder Pfingsten).
• Ein Abschiedsgottesdienst am letzten Tag vor den großen Ferien.
• Das Fest der Umkehr und Versöhnung.
In der Regel feiern wir alle Schulgottesdienste als Wortgottesfeiern, weil die Feier der Hl. Messe erfahrungsgemäß oftmals eine Überforderung einer nicht unbeträchtlichen Zahl von Schülerinnen und Schülern darstellen würde. In Klassen, in denen der Wunsch nach einer gemeinsamen Messfeier auftaucht, besteht die Möglichkeit, in einer Religionsstunde eine Tischmesse7 zu feiern, die von der Klasse vorbereitet wird.
3. Die Bedeutung der Predigt beim gemeinsamen Feiern
3.1. Die Vorbereitung der Predigt
In Zeiten, in welchen Einzelne kaum mehr eine traditionelle Glaubensbildung mitbringen, bedeutet faktisch jede Predigt auch die Chance einer christlichen Grundlagenvermittlung.8 Damit erscheint aber auch klar, dass jede Predigt ihren Anfang in der Religionsstunde und im persönlichen Gespräch mit Schülerinnen und Schülern nimmt. Im Idealfall ist die Predigerin/der Prediger auch die Religionslehrerin/der Religionslehrer. Dort, wo das nicht möglich ist, erscheint es sinnvoll, ja fast notwendig, dass sich die/der Predigende im persönlichen Kontakt mit den jungen Menschen ein Bild macht, wo diese stehen, was ihre Interessen sind und welche Sprache sie sprechen. Mit anderen Worten, sie/er sollte selbst aus dem Bereich der Jugendarbeit kommen oder sich dort zumindest zuhause fühlen, Mimik und Gestik von Jugendlichen richtig einschätzen und deuten können, In-Worte kennen und auch den Mut haben, solche gezielt einzusetzen. Dabei handelt es sich nicht um eine Anbiederung an die Jugendlichen, sondern um das Zeugnis, dass man die Jugend und ihre Sprache kennt und ernst nimmt. Religion und religiöses Reden ist zeitlos. Entscheidend ist, dass religiöse Inhalte verständlich vermittelt werden. Wo eine Sprache verwendet wird, die nicht der Zielgruppe entspricht, gehen die Inhalte leicht verloren! Auch zeigt die eigene Erfahrung, dass einzelne wichtige Aussagen, von denen man die Hoffnung hat, dass sie den Schülerinnen und Schülern im Gedächtnis und im Herzen bleiben, im Dialekt gesprochen werden, weil das sehr oft die Aufmerksamkeit steigert.
Bei der Wahl der Schriftstellen, die beim gemeinsamen Feiern gelesen werden, ist es entscheidend, darauf zu achten, dass diese zum einen dem Anlass entsprechen und dem Jahreskreis angepasst sind, zum anderen ist es von grundlegender Bedeutung beim Gottesdienst in der Schule, dass die ausgewählten Perikopen selbstsprechend sind. Sie sollen also keiner hochtrabenden und tiefsinnigen bibeltheologischen Auslegung und Erklärung bedürfen, sondern die Kernaussagen der Texte sollen von den Zuhörenden unmittelbar verstanden werden. Besonders sinnvoll erscheint es, Bibelstellen zu verwenden, die bereits in einzelnen Klassen Thema des Unterrichtes waren, weshalb ein Teil der Schülerinnen und Schüler bereits Vorwissen dazu mitbringt. Es ist der vielleicht ureigene Sinn jeder Homilie, dass diese die Hörerin/den Hörer aufbaut und diese/dieser aus dem Gehörten einen persönlichen Nutzen erkennen kann.9 Für Jugendliche im Rahmen ihres schulischen Daseins bedeutet es oftmals bereits ein Erfolgserlebnis, wenn diese aus einem gehörten Text auf Anhieb einen allgemein gültigen Sinn erkennen können und sich auch noch ein Bezug zum eigenen Leben eröffnet.
Als Letztes gilt es nun, einen Gedanken zu formulieren, den man in die Herzen seiner Zuhörerinnen und Zuhörer einpflanzen möchte. Es geht um die Botschaft, die man weitergeben möchte.10 Sie soll, wenn sie ankommt, etwas in den Mitfeiernden verändern, und sei es nur das Aufflackern der Überlegung, dass das Wort Gottes wirklich etwas mit der eigenen Person und dem eigenen Leben zu tun hat. Religion ist Teil der Lebenswirklichkeit des Kollektivs.
Die erfolgreiche Vorbereitung der Schulpredigt geht meines Erachtens somit von vier Grundvoraussetzungen aus:
• Dem Wissen um die Lebenswirklichkeit der Jugendlichen und einem persönlichen Bezug dazu.
• Der wohlüberlegten Auswahl passender Bibeltexte.
• Der Umsetzung in einer die Jugend ansprechenden Sprache.
• Einem einfachen, aber treffenden Grundinhalt, den man weitergeben möchte.
3.2. Die Durchführung der Predigt als interaktives Geschehen
Der Einstieg in die Predigt erinnert auf den ersten Blick vielleicht an ein in vielen Kirchen durchaus übliches Predigtgespräch mit Kindern. Wichtig ist, sich sofort die Aufmerksamkeit seines Gegenübers zu holen und bei sich zu behalten. Eine Eröffnungsfrage wie: „Ist jemandem von euch irgendetwas an dem eben Gehörten aufgefallen?“ oder: „Warum sind wir hier heute überhaupt so zusammen?“, bringt in der Regel immer eine brauchbare Antwort, von der aus weitergegangen werden kann. Jetzt kommt es darauf an, die Antwort geschickt und wie zufällig in die Richtung zu lenken, in die man sich inhaltlich begeben will. Schülerinnen und Schüler sind es gewohnt, Fragen gestellt zu bekommen und wissen auch, dass von ihnen sinnvolle Antworten erwartet werden. Diese simple Erkenntnis ist, meiner Einschätzung nach, entscheidend für das Gelingen des gemeinsamen religiösen Feierns und damit auch der Predigt am Ort der Schule.
Der Gottesdienst an sich durchbricht schon den Alltag in der Schule und eröffnet eine neue Sichtweise auf das dortige Miteinander, die liturgische Kleidung ebenso. Wir sind da, wo wir es gewohnt sind zu sein, und trotzdem ist in dieser Stunde manches anders.
Das direkte Anreden und Einbeziehen, ja das freie Mitredenlassen der Einzelnen stellt den Brückenschlag zwischen dem, was wir heute hier tun – feiern – und dem, was wir sonst hier tun – arbeiten – dar, zwei Geschehen, die eine Lebenswirklichkeit darstellen – meine Lebenswirklichkeit. Noch verstärkt wird dieses Empfinden, wenn die Schülerinnen und Schüler, die sich einbringen, vom Prediger/von der Predigerin mit ihren Namen angesprochen werden.11 Die Person, die die Predigt hält, wird als Lehrer_in, Lehrende/r – nicht Belehrende/r – wahrgenommen.
Die predigende Person hat es in der Hand, mehr und mehr die eigene religiöse Erfahrung mit der Selbstwahrnehmung der Jugendlichen zusammenzuführen und diese erspüren zu lassen, dass das, was sie bewegt, auch das sein kann, was die jungen Menschen berührt und anspricht. Formulierungen wie du und ich – wir, sind dafür ein brauchbares Instrument.
3.2.1. Praxisbeispiel – Vorweihnachtsgottesdienst
Als passende Texte für den Schulgottesdienst bieten sich hier unter anderem die Schriftstellen aus der Heiligen Nacht an.12 Grundgedanke der Verkündigung in diesem Beispiel ist, dass Gott uns so nah wie nur möglich kommen möchte, damit wir ihn und sein Wort wirklich verstehen können – von Mensch zu Mensch.
„Ist euch bei der Lesung aus dem Lukasevangelium etwas aufgefallen?“, kann die Einstiegsfrage lauten. Sofort werden einige sagen, dass da etwas gefehlt hat.13 Schritt für Schritt erarbeitet man jetzt mit den Jugendlichen, was gefehlt hat und was das bedeutet: Was heißt geboren werden? Ein neuer Mensch tritt in die Welt. Baby zu sein, heißt hilflos zu sein, sich anvertrauen zu müssen, andere zu brauchen etc. Hast du schon einmal die Erfahrung gemacht, Hilfe zu brauchen? Hast du es schon erlebt, dass andere dich gebraucht haben? Wen kannst du als Mensch am besten verstehen? – einen anderen Menschen! Du und ich, wir können einander verstehen.
Schritt für Schritt werden am Beispiel der Weihnachtsgeschichte göttliche Offenbarung und eigene Lebenserfahrung miteinander verwoben. Wenn die Predigt gelingt, gehen die Schülerinnen und Schüler mit dem Gedanken ins Weihnachtsfest, dass Gott Mensch wird, weil er möchte, dass wir ihn verstehen und auch verstehen, was es überhaupt bedeutet, Mensch zu sein, füreinander da zu sein, zueinander zu stehen, sich auf andere verlassen zu können, verstanden zu werden und ähnliches mehr. All das sind Werte und Anliegen, die gerade Jugendlichen in der Pubertät nicht egal sind.
3.2.2. Die Predigt in der Schule als ökumenisches und interreligiöses Geschehen
Immer mehr wird, nach meiner Erfahrung, die vor Jahren noch sprichwörtliche Schulmesse, zu der man halt hingehen hat müssen, von einem offen gestalteten christlichen Gottesdienst abgelöst, zu dem alle in der Schule vertretenen christlichen Konfessionen eingeladen sind. Dieser ist in der Regel sehr ansprechend und altersgerecht vorbereitet. Somit wird das gemeinsame Feiern am Ort des Lernens zum Spiegel einer komplexen und pluralen Gesellschaft, ohne dabei die eigene Identität zu verlieren. In den letzten Jahren ist vor allem die Zahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Bereich der orthodoxen Kirchen und des orientalischen Ritus gestiegen. Besonders spannend wird es, wenn auch Jugendliche anderer, nicht christlicher Religionen und Schülerinnen und Schüler ohne religiöses Bekenntnis der Einladung zum gemeinsamen Feiern folgen.14
Hier zeigt sich am stärksten, welche Bedeutung einer Schulpredigt heute zukommt. Sie erhebt den Anspruch, christliche, katholische Inhalte und Werte so zu vermitteln, dass jene, die sich (zumindest formal) zum Christentum bekennen, in ihrer eigenen, durch die Taufe grundgelegten Identität angesprochen und gestärkt werden. Zugleich hat sie aber auch die Aufgabe, alle anderen, für die das nicht zutrifft, authentisch und ansprechend darüber zu informieren, was Christen glauben, was ihre Werte sind, und wofür diese stehen. Damit wird auch offenkundig, was die immer präsent zu seiende Leitidee jeder Predigt im schulischen Bereich sein sollte, nämlich das Ins-Wort-Bringen dessen, was in einer funktionierenden Schulgemeinschaft gelebt wird: Wir sind eine Gruppe von Menschen mit unterschiedlichen kulturellen und religiösen Wurzeln, die gemeinsam arbeitet und lebt und immer stärker zu einer tragfähigen Gemeinschaft zusammenwächst, in der die und der Einzelne sich in ihrer/seiner Individualität angenommen, wertgeschätzt und beheimatet fühlt. Die eigene christliche Identität und das Anderssein meiner Mitschülerin und meines Mitschülers werden nicht als sich widersprechende Lebensentwürfe gegenübergestellt, sondern als zwei existierende Lebenswirklichkeiten wertschätzend nebeneinander platziert.
Es entspricht meiner Erfahrung, dass Kinder und Jugendliche weit weniger Berührungsängste und Vorbehalte gegenüber anderen Kulturen, Hautfarben und Religionen haben als ihre erwachsenen Mitmenschen. Deshalb ist es wichtig, dass in einer Predigt bei jungen Menschen in der Schule diesem Umstand Rechnung getragen wird. In einer Zeit, in der religiöser Fanatismus, Ausgrenzung und nationalistisches Denken immer mehr Menschen verunsichern und verbale und körperliche Gewalt die ganze Welt in ihren Bann zieht, kann eine gut durchdachte Predigt im Schulgottesdienst, die von biblischen Grundsätzen ausgeht, die Gefühle junger Menschen aufgreift und Alternativen zu gängigen rechten und linken Populismen aufzeigt, ein nicht zu unterschätzender Baustein zur Vorbeugung und zum Verhindern jeglicher Radikalisierung sein. Zusammen zu feiern, sich gemeinsam ansprechen zu lassen, ist ein integrativer Vorgang, der das Miteinander stärkt, ohne die eigene Identität zu verletzen oder aufzuheben.
3.3. Gibt es eine Nachhaltigkeit der Predigt? – Reflexion und gelebte Umsetzung
Eine Predigt, die einem selbst gelungen erscheint, muss noch lange nicht bei den Mitfeiernden so angekommen sein, wie man es sich selbst erhofft hatte. Jede/jeder, die/der Predigterfahrung mitbringt, wird zustimmen, dass das Feedback, egal ob positiv oder negativ, eine wertvolle Hilfestellung für jede weitere Vorbereitung und Predigtarbeit darstellt.
Anders als bei Pfarrgottesdiensten, was meiner Erfahrung entspricht, kommt nach einer Feier in der Schule selten bis nie jemand, der über die Predigt eine Rückmeldung geben möchte. Zumindest gilt das für die Schülerinnen und Schüler, die ja die eigentliche Zielgruppe darstellen. Aus dem Kreis der Kolleginnen und Kollegen, der Lehrerinnen und Lehrer, findet sich in der Regel immer jemand, der das Gehörte meist positiv kommentiert. Interessant ist aber das, was die Jugendlichen davon mitgenommen haben.
Aus diesem Grund erscheint es mir unerlässlich, dass die Religionslehrerin und der Religionslehrer – ungeachtet, ob sie es waren, die gepredigt haben oder nicht – die Predigt und ihren Inhalt nach dem Gottesdienst in geeigneter Form im Kreis der jungen Menschen noch einmal zum Thema machen.15 So kann gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern darüber reflektiert werden, ob und wo der Inhalt der Predigt in Bezug zum Leben der Schulgemeinschaft und der/des Einzelnen steht.
Der entscheidende Aspekt, ob die Botschaft der Predigt ankommen kann oder nicht, liegt in der lebbaren und gelebten Umsetzung. Ich bin der Überzeugung, dass jenes berühmte Wort vom Wasser predigen und Wein trinken16 gerade am Ort der Schule niemandem in den Sinn kommen darf, wenn er Predigt und predigende Person nebeneinander stellt.17 Der Inhalt der Predigt, ihr sozialer Anspruch, ihr Sitz im Leben und die Gottbezogenheit müssen am Leben und Handeln der Person, die dafür steht, erkennbar sein. Wo das nicht der Fall ist, wird eine formal noch so gute Predigt ins Leere gehen. Auf Nachhaltigkeit darf dort gehofft werden, wo Authentizität herrscht. Glaubwürdigkeit ist hier die oberste Prämisse.
4. Predigt ist nicht Unterricht – Zusammenfassende Schlussbemerkungen
Zu predigen an sich ist eine der wenigen Möglichkeiten für Seelsorgerinnen und Seelsorger, genuin Theologie zu betreiben, ein eigenes Profil zu entwickeln und mit Hilfe der eigenen Lebens- und Gotteserfahrung anderen eine Wirklichkeit zu erschließen, die das Leben jener Personen maßgeblich positiv zu verändern vermag.18 Ausgehend von der biblischen Grundlage werden bis dato vielleicht unerkannte Lebensmöglichkeiten erschlossen.
Besonders in der Schule beim gemeinsamen Gottesdienst, der den schulischen Alltag aufbricht, eröffnet das Chancen, die nicht ausgelassen werden dürfen, um Gott – Kirche – Religion in einer größtenteils säkularisierten Gesellschaft wieder ins Bewusstsein zu rufen und diese neu und (hoffentlich) ansprechender zu positionieren, als es vielerorts von Jugendlichen erlebt wird. Die Predigt liegt hier in der Mitte der Wortgottesfeier, nicht als belehrende Bibelerklärung, sondern als Medium, welches mir ermöglicht, mich selbst einzubringen und die eigenen Lebenserfahrungen in einem neuen Licht unter Anleitung und Führung einer kompetenten Person anders als bisher zu deuten. Das Wirken Gottes soll im eigenen Leben erkannt werden können.
Wichtig scheint es mir festzuhalten, dass die Predigt bzw. der Gottesdienst nicht einfach eine zusätzliche Religionsstunde sind. Im Unterricht geht es um die Aufbereitung und Vermittlung von Inhalten, die klar durch den Lehrplan definiert sind. Es geht um (Glaubens-)Wissen, das weitergegeben werden soll. Im schulischen Alltag sprechen wir heute bewusst von Religionsunterricht (Weitergabe von Wissen) und nicht mehr von Katechese (Glaubensunterweisung). Was Schülerinnen und Schüler daraus machen, bleibt in der Regel ihnen überlassen. Es verhält sich ähnlich wie Theorie und Praxis. In den Stunden wird Theorie vermittelt, im Gottesdienst, wenn er gelingt, wird eine mögliche praktische Erfahrung eingeübt oder zumindest ausprobiert. Es verhält sich wie beim Schwimmenlernen. In der Schulstunde wird erklärt, wie es geht. Der Gottesdienst ist jener Moment, wo die Schülerinnen und Schüler das Bad betreten und ihre Füße ins Wasser halten. Bei der Predigt steigt die Predigerin/der Prediger ins Wasser und lädt die Mitfeiernden ein, es ihr/ihm gleichzutun. Wer es ausprobiert, hat die Chance, ein neues Ufer zu erreichen.19
Auch stellt die Predigt die Möglichkeit dar, Brücken zu anderen Konfessionen zu bauen und integrative Impulse zu setzen, die des Verbindende vor des Trennende setzen, ohne dabei die eigene Identität in Frage zu stellen bzw. die eigenen Wurzeln abzuschwächen.
Für Vorbereitung und Gelingen der Predigt ist es wichtig, die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler zu kennen und ihre Sprache zu sprechen. Die biblischen Texte sind gezielt auszuwählen und so zu erklären, dass es den Jugendlichen von sich aus möglich ist, den Bezug zum eigenen Leben zu erkennen. Christliche Religion und christliche Werte sollen als Bereicherung und Hilfe für das eigene Dasein erschlossen und verstanden werden.
So kann die Predigt am Ort der Schule zu einem missionarischen Geschehen werden, das Menschen, die in einer entscheidenden Phase ihrer Entwicklung stehen, das Christentum als echte, lebensbejahende und sinnstiftende Alternative in einer zerrissenen und oftmals sinnentleerten Welt erschließt.
Literatur und Quellen
Bellmann, Werner, Heinrich Heine, Deutschland. Ein Wintermärchen. Erläuterungen und Dokumente, revidierte Ausgabe, Stuttgart 2005.
Der große Sonntags-Schott für die Lesejahre A – B – C, Freiburg im Breisgau 1975.
Mödl, Ludwig, Art. Homilie. II. Liturgisch, in: LThK3 Bd 5 (Sonderausgabe), Freiburg/Br. 2006, 249.
Müller, Klaus, Art. Predigt. VIII. Praktisch-theologisch, in: LThK3 Bd 8 (Sonderausgabe), Freiburg/Br. 2006, 533-534.
Religionsunterrichtsgesetz in der derzeit geltenden Fassung, nachzulesen auf der Homepage des Bundeskanzleramtes: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundes normen&Gesetzesnummer=10009217&ShowPrintPreview=True [Nov 2016].
1 Allerdings lässt es sich beobachten, dass politische Parteien, wenn es in ihr Konzept passt, gerne auf das Thema Religion zurückgreifen. Eine echte Auseinandersetzung mit Religion und religiösen Inhalten ist das, nach meinem Verständnis, aber nicht. Um gelebten Glauben und ein authentisches Glaubenszeugnis handelt es sich hier nicht. Es wird gezielt mit Verunsicherungen und Ängsten von Menschen gespielt, um diese auf die eigene politische Seite zu ziehen.
2 Vgl. RUG §1.
3 Es sei hier angemerkt, dass andere Kasualien, wie Hochzeiten, Taufen etc., nach meiner Meinung nicht mit Religionsunterricht und Trauerfeier vergleichbar sind. Dass sie ebenfalls pastorale Chancen bieten ist unbestritten. Jedoch ist die Ausgangslage eine völlig andere. Religion ist, wie bereits oben erwähnt, ein Pflichtgegenstand. Der Tod eines (geliebten) Menschen ist eine Realität, der man sich stellen muss und wo man keine Wahl hat.
4 Mittelstufe, Schüler im Alter von 10 bis 14 Jahren.
5 Dort, wo keine Aula zur Verfügung steht, kann auch der Turnsaal oder ein anderer geeigneter Ort innerhalb des Schulgeländes genutzt werden. Wichtig erscheint mir, dass wir dort gemeinsam feiern, wo wir auch zusammen arbeiten.
6 Es vertieft das schulische Gemeinschaftsgefühl, den Chor und die Musiklehrenden zum Mitgestalten einzuladen.
7 Wir verstehen unter einer Tischmesse eine Hl. Messe, die im Klassenverband, um einen als Altar gestalteten Tisch sitzend, im Klassenzimmer gefeiert wird.
8 Vgl. Müller, Predigt, 534.
9 Vgl. Mödl, Homilie, 248.
10 Es versteht sich von selbst, dass das für jede Predigt bzw. Homilie gilt. Jedoch ist hier die Herausforderung und die damit verbundene Hoffnung sowie der Wunsch, Erfolg zu haben, besonders hoch, weil es sich um eine Personengruppe handelt, die in der Regel an traditionellen Gottesdiensten kaum mehr Teil nimmt und vielleicht durch das Gehörte und dadurch Erfahrene wieder den Wunsch verspürt, Kirche auch am Ort neu kennen zu lernen. Es ist eine Chance, die Kirche und das, was sie den Menschen anzubieten hat, gerade auch heute in unserer Zeit durch das in der Schule Erlebte wieder interessant werden zu lassen.
11 Er/Sie kennt meinen Namen. Ich werde gehört. Das, was ich sage, zählt.
12 Natürlich in modifizierter Form: Lesung Jes 9,1-2.5; - Evangelium Lk 2,15.
13 Wir haben das Evangelium mit dem Weggehen aus Nazareth enden lassen.
14 Natürlich gilt die Einladung zum christlichen Gottesdienst den Angehörigen der christlichen Bekenntnisse, aber es wäre meiner Meinung nach grundlegend falsch, Menschen, die mitfeiern möchten, auszuschließen. Ich selbst wurde einmal von einem islamischen Kollegen gefragt, ob er mit seinen Schülerinnen und Schülern bei unserem Gottesdienst dabei sein dürfe, was ich bejahte. Es darf aber keineswegs jemand dazu genötigt werden. Deshalb liegt es in der Verantwortung der Schule, für jene Schülerinnen und Schüler, die das nicht möchten, eine eigene Beaufsichtigung mit Alternativangebot zu gewährleisten.
15 Hier wird deutlich, dass es sehr zu begrüßen ist, wenn die Religionslehrerin oder der Religionslehrer den Dienst der Predigt beim Schulgottesdienst übernimmt, weil sie/er im Anschluss die Möglichkeit hat, die dort eingebrachten Gedanken im Unterricht erneut aufleben zu lassen und weiterzudenken.
16 Die Redewendung stammt von Heinrich Heine.
17 Das sollte natürlich generell gelten. Jugendliche haben aber oft einen besonders sensiblen Gerechtigkeitssinn, der bei fehlender Deckungsgleichheit zwischen Predigt und predigender Person die grundsätzliche Wahrheit der Botschaft so in Frage stellt, dass diese nicht mehr angenommen werden kann.
18 Vgl. Müller, Predigt, 533.
19 Mir ist bewusst, dass dieser Vergleich, wie jeder andere auch, Schwächen enthält und zur Diskussion einlädt.