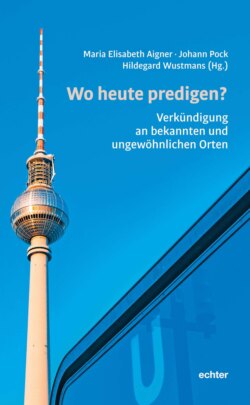Читать книгу Wo heute predigen? - Группа авторов - Страница 11
Оглавление„Missionspredigt“
Hans Hütter
Sind „Missionspredigten“ ein eigener „Predigtort“? Diese Frage ist gleich zu Beginn zu stellen, denn meistens wurden sie in Kirchen und in Gemeindegottesdiensten gehalten. Dort haben sie jedoch in einem speziellen pastoralen Setting stattgefunden und sie haben Eigenheiten vorzuweisen, die sie von der Predigtpraxis im Rahmen der „ordentlichen Seelsorge“ unterscheiden. Insofern kann man sie als eigenständigen „Predigtort“ betrachten.
Volks- und Pfarrmissionen wurden von vielen Ordensgemeinschaften gepredigt, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil auch von geistlichen Bewegungen wie etwa dem Cursillo, der „Bewegung für eine bessere Welt“1 oder der „Charismatischen Erneuerung“. Die Predigt hatte in jeder dieser Gruppierungen einen etwas anderen Stellenwert mit unterschiedlicher Ausprägung. Dieser Beitrag beschränkt sich auf die Missionspredigt, wie sie von einer dieser Gemeinschaften gepflogen wurde. Ich selbst bin Mitglied der Kongregation der Redemptoristen und habe seit 1972 an vielen missionarischen Projekten in Pfarrgemeinden mitgewirkt.
1. Die Missionspredigt in der Tradition der Redemptoristen
Mission ist ein Wesensmerkmal der Kirche. Sie ist gesandt, die Frohe Botschaft allen Menschen zu verkünden. Sie kommt diesem Auftrag in vielgestaltiger Weise nach, und jeder Getaufte sowie jede ihrer Gliederungen nimmt an dieser Sendung teil. So hat auch jede Ordensgemeinschaft und jede geistliche Bewegung ihre je eigene Ausprägung der Mission entfaltet.
Die Kongregation der Redemptoristen weiß sich von ihrem Gründungscharisma her der ausdrücklichen Verkündigung der Frohen Botschaft verpflichtet. Alfons Maria von Liguori (1696 – 1787), der Gründer der Redemptoristen, knüpft selbst an eine vorgefundene Praxis an und geht mit seinen Leuten vor allem in die kleinen Dörfer und Ortschaften im Königreich Neapel, um dort den Menschen das Evangelium neu zu verkünden. Die meisten Menschen im Hinterland der größeren Städte waren ohne systematische religiöse Unterweisung aufgewachsen und wurden von keinem seelsorglichen Programm erreicht. Die bevorzugten Mittel dieser Missionen waren Predigten und Katechesen an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen. Die Abendpredigten als sogenannte „große Predigt“ waren als Bekehrungspredigt angelegt. Es galt, die Menschen emotional zu berühren und zur Umkehr zu bewegen. Die „predica grande“ war den großen Könnern vorbehalten. Manche setzten auch dramatische Mittel der Inszenierung ein. Ein für uns ungewöhnliches Stilmittel war z.B. das Singen in einem eigenen Predigtton, der die Menschen emotional aufwühlte.2 Zeichen und Akt der Umkehr war der Empfang der Sakramente in Form einer Lebensbeichte und der heiligen Kommunion. Auch auf öffentliche Versöhnungsakte zwischen Streitparteien wurde großer Wert gelegt. Ort der Predigt, der Katechesen und des Sakramentenempfangs war die jeweilige Pfarrkirche. Tagsüber wurden Prozessionen an öffentlichen Plätzen mit kurzen Ansprachen gehalten, um die Bevölkerung zu den Missionsveranstaltungen einzuladen.3 In der Kirche wurden während des Tages Katechesen angeboten und einzelne Gruppen durch spezielle Predigten auf die persönliche Beichte vorbereitet. Am Abend folgte jeweils als Höhepunkt die große Missionspredigt, die „predica grande“.
Nachdem die Redemptoristen durch das Wirken des hl. Klemens Maria Hofbauer (1751–1820) nördlich der Alpen Fuß gefasst hatten, begannen sie in der Mitte des 19. Jahrhunderts auch dort Volksmissionen zu halten.4 An manchen Orten wurden diese zu ungewöhnlich großen Veranstaltungen, zu denen eine unvorstellbar große Zahl von Menschen zusammenströmte.5
Im deutschsprachigen Raum haben sich die Volksmissionen gehalten, solange die Kirche volkskirchlich verfasst war, also etwa bis zum Vatikanum II. Vom Kirchenrecht waren sie im Rhythmus von zehn Jahren für alle Pfarrgemeinden vorgeschrieben (vgl. CIC/1917 cc 1349). Nach dem Zweiten Weltkrieg waren Volksmissionen sehr gefragt. Man begann aber schon vor dem Zweiten Vatikanum nach einer Erneuerung dieser Form der außerordentlichen Seelsorge Ausschau zu halten.6 Die Predigten erfuhren z.B. in dieser Zeit eine stärkere christologische Ausrichtung. Von Frankreich ausgehend verfolgte man auch die Idee von Milieumissionen. Man wollte damit eine stärkere Nachhaltigkeit erreichen. Milieu wurde damals aber noch nicht in dem Sinn verstanden, wie der Begriff gegenwärtig im Zusammenhang mit den Milieustudien gebraucht wird. Man beobachtete mit Sorge, dass infolge der Industrialisierung das Leben in Städten und in Arbeiterwohngebieten immer weniger christlich und kirchlich geprägt war. Durch groß angelegte Gebietsmissionen wollte man ein katholisches Milieu wiederherstellen.
Weitere Erneuerungsbemühungen gab es nach dem Zweiten Vatikanum. Es begann sich inspiriert von der neuen Gemeindetheologie eine stärkere Ausrichtung auf Gemeindebildung, bzw. Gemeindeerneuerung durchzusetzen. Die Gemeinde wurde als Trägerin der Mission und zugleich als Lebensraum, in dem Mission stattfand, verstanden. Die Bezeichnung Volksmission wurde durch „Gemeindemission“ oder „Gemeindeerneuerung“ ersetzt. Es bildete sich auch eine neue Rollenverteilung heraus. Während bisher Missionen nur von Priestern gehalten wurden, begannen nun Laien missionarische Initiativen mitzugestalten und mitzutragen. Missionare, die von außen in eine Gemeinde kamen, verstanden sich als Impulsgeber und Berater.
Dieses erneuerte Konzept erlebt seit einigen Jahren neuerlich eine Krise, da die hohe Mobilität und neue Medien das gewohnte Beziehungsgefüge in unserer Gesellschaft tiefgreifend verändert haben und immer noch verändern. Zum gesellschaftlichen Wandel kamen in vielen Diözesen Reorganisationsmaßnahmen hinzu, die viele Kräfte binden. Damit werden missionarische Initiativen vor große Herausforderungen gestellt.
2. Spezifische Merkmale der Missionspredigt der Redemptoristen
Nicht zuletzt durch persönliche Erfahrung – als Kind habe ich 1958 in meiner Heimatgemeinde noch eine Volksmission im alten Stil erlebt und seit 1972 war ich selbst immer wieder an missionarischen Seelsorgeprojekten beteiligt – habe ich an der Missionspredigt Spezifika wahrgenommen, die mir nach wie vor bedenkenswert erscheinen.
2.1. Existenzielles Betroffensein
Missionspredigten unterscheiden sich von anderen Predigten darin, dass diese darauf abzielten, existenziell betroffen zu machen. Erreicht wurde Betroffenheit vor allem durch Erzählen von Selbst-Erlebtem, durch anschauliche exemplarische Beispiele, Parabeln, durch eine bilderreiche Sprache sowie durch Vergleiche und Metaphern.
Es wäre schwer zu ertragen, wenn die Predigt jeden Sonntag so tief unter die Haut ginge, dass sich die Hörer_innen davon existenziell betroffen fühlten. Auch reicht der zeitliche Rahmen einer Predigt im Gemeindegottesdienst normalerweise nicht, um auf existenzielle Lebensfragen ausreichend Antwort zu geben, denn über kognitive Lösungsangebote hinaus braucht es Hilfen zur emotionalen Verarbeitung. Missionspredigten fanden daher in einem speziellen Setting statt. Sie dauerten für gewöhnlich auch länger als Predigten im normalen Gemeindegottesdienst. Als Regel galt: Eine Predigt darf lang dauern, wenn sie nicht langweilig ist.
Nach Paulus kommt der Glaube vom Hören (Röm 10,17). In der Überlieferung der Synoptiker bedauert Jesus, dass Menschen hören und doch nicht hören (vgl. Mk 4,12 und Jes 6,9f), bzw. fordert er auf: „Wer Ohren hat zum Hören, der höre!“ (Mk 4,9). Hören wird hier offenbar als ein komplexerer Vorgang als das akustische Wahrnehmen und das kognitive Aufnehmen und Einordnen des Gesagten verstanden. Die Medien wissen darum und haben Strategien entwickelt, wie sie ihre Adressat_innen nicht nur auf der Verstandesebene erreichen, sondern möglichst tief ins Bewusstsein und auch ins Unbewusste eindringen. Die Missionspredigt versuchte mit den Mitteln der Rhetorik zu einem umfassenden Hören zu führen. Das war aber immer auch eine Gratwanderung des guten Geschmacks.
2.2. Grundthemen des Lebens und Glaubens
Um die existenziellen Fragen der Hörerinnen und Hörer anzusprechen, spielt die Auswahl der Themen eine besondere Rolle. Tief in die Erinnerung vieler älterer Katholik_innen hat sich die Höllenpredigt als Markenzeichen der Volksmission eingeprägt. Diese gehört zwar schon lange nicht mehr zum Missionsrepertoire, das „respice finem“ klingt aber nach wie vor in vielen Themen an. Wichtige Themenbereiche waren die Frage nach dem Sinn des Lebens, nach dem Gottesbild und der persönlichen Gottesbeziehung, Jesus Christus als Erlöser, der aus Liebe zu den Menschen sein Leben hingegeben hat, Tod und Auferstehung, die Notwendigkeit der Umkehr und der Versöhnung mit Gott und den Mitmenschen, sowie Fragen einer christlichen Lebenspraxis und Spiritualität: Gebet, Wort Gottes, Eucharistie, Gemeinde u. a. m. Nicht fehlen durfte in einer redemptoristischen Mission Maria als Vorbild christlichen Lebens und Glaubens.7
Alfons M. von Liguori war in seiner persönlichen Lebensgeschichte vom Geheimnis der Liebe Gottes, das sich in Christus geoffenbart hat, so tief berührt, dass dieses Motiv zum Grundton seines Lebenswerkes wurde und er diese Ausrichtung auch von den Missionaren seiner Gemeinschaft einforderte.
Nach Möglichkeit waren Missionspredigten in Feiern eingebettet: Feiern der Tauf- und Firmerneuerung, Buß- und Versöhnungsfeiern, Totengedenk- und Auferstehungsfeiern, eine Prozession oder Wallfahrt zu einem Marienbild oder Marienaltar… Stimmige und zugleich stimmungsvolle Feiern können Herz und Gemüt bewegen und zur persönlichen Auseinandersetzung mit existenziellen Lebensthemen hinführen. Feiern boten immer auch Anlass, verschiedene Gruppen in die Gestaltung einzubeziehen: Chöre, Musikkapellen oder Ensembles, Traditionsgruppen, Einsatzkräfte wie Feuerwehr und Erste Hilfe – alles, was eine Gemeinde aufbieten konnte.
2.3. Katechetische Elemente
Die Missionspredigt enthielt meist auch katechetische Elemente. Ursprünglich orientierte sich die Themenreihe einer Mission an den großen theologischen Traktaten und die Prediger waren angehalten, die Predigt so aufzubauen, dass sie das ganze Thema abdeckt. „Eine gute Missionspredigt erschöpft das Thema, den Prediger und die Hörer“ hieß es scherzhaft. Der Aufbau einer Predigt war so gestaltet, dass er einen systematisch-inhaltlichen Leitfaden zum jeweiligen Thema anbot, den sich die Hörer_innen einprägen konnten. Immer wieder traf ich Menschen, die von früheren Missionen die einzelnen Predigtpunkte so tief in Erinnerung hatten, dass sie diese nach Jahrzehnten noch aufzählen konnten.
Neben den Missionspredigten gab es auch sog. Standeslehren für Männer, Frauen, Burschen, Mädchen und Kinder. Diese boten Gelegenheit, auf moralische Fragen, die diese Menschengruppe besonders betrafen, einzugehen. Gleichzeitig dienten sie der Vorbereitung auf die persönliche Beichte. Im Laufe der Zeit mutierten die Standeslehren zu Angeboten für bestimmte Zielgruppen: Senior_innen, Erwachsene, Jugendliche und Kinder, Eheleute, Alleinstehende oder auch Geschiedene und Wiederverheiratete. Auf diese Weise wollte man auf zielgruppenspezifische Interessen und auf Fragen der christlichen Lebensgestaltung konkreter eingehen.
2.4. Die Gemeinde als Ort der Missionspredigt
Mission und Umkehr brauchen einen Raum, in dem sie stattfinden können. Paulus ging in Athen auf den Areopag und holte sich dort eine Abfuhr. Normalerweise hielt er, wenn er in eine Stadt kam, Ausschau nach einer Synagoge, in der Juden zusammenkamen und Gottesdienst feierten. Die Predigten der Apostelgeschichte beginnen meist mit dem Nacherzählen der Heilsgeschichte und erzählen diese dann um. Dies setzt einen gemeinsamen Verstehenshorizont voraus.
Sehr oft wird mit Mission die Vorstellung verbunden, dass sich jemand hinstellt, ein mehr oder weniger persönliches Glaubenszeugnis gibt und so zu predigen beginnt. Das impliziert die missionstheologisch fragwürdige Haltung „ich habe die Frohe Botschaft, die Wahrheit, den besseren Glauben und bringe diese den noch nicht Gläubigen“. In der Tradition der Volks- und Gemeindemission gingen die Missionare einen anderen Weg. Sie begannen ihre Verkündigung mitten in der Gemeinde.
Die kirchlichen Dokumente der letzten Jahre heben drei Zielrichtungen der Mission hervor. Evangelii Gaudium nennt als Erstes die „gewöhnliche Seelsorge“, „an zweiter Stelle erwähnen wir den Bereich der ‚Getauften, die jedoch in ihrer Lebensweise den Ansprüchen der Taufe nicht gerecht werden‘“, und schließlich die „Verkündigung des Evangeliums an diejenigen, die Jesus Christus nicht kennen oder ihn immer abgelehnt haben“ (EG 14). Die Enzyklika Evangelii Nuntiandi des Papstes Paul VI. spricht von Evangelisierung bzw. Neuevangelisierung und meint damit, dass wir uns auf allen Ebenen – persönlich, als Gemeinde, als Kirche – neu dem Angebot und Anspruch des Evangeliums stellen und uns vom Evangelium umgestalten lassen, ein jeder persönlich, aber auch bis in alle Bereiche unserer Lebenskultur hinein (vgl. EN 20).
Meiner Erfahrung nach ist eine solche Evangelisierung nicht ohne die Einbettung in irgendeine Form von Gemeinde möglich. Es braucht einen Raum, in dem das Evangelium fruchtbar werden und wachsen kann. Schwierig ist dies natürlich in einer Zeit, in der das ganze Beziehungsgefüge im Umbruch ist, in der Strukturreformen notwendig sind, in der sich Beziehungsgeflechte dank höherer Mobilität und neuer Kommunikationstechniken geändert haben und immer weiter verändern. Predigt als Auslegung der Frohen Botschaft, als Miteinander-Teilen des Wortes Gottes setzt Gemeinschaft voraus, ereignet sich in Gemeinden. Missionspredigt ist eine Inszenierung des Wortes Gottes im Raum der Gemeinde. In ihr findet das Wort Gottes einen Echoraum und kann es Wellen schlagen.
2.5. Über Gemeindegrenzen hinaus
Auch wenn die Missionspredigt auf Gemeinde angewiesen ist, möchte sie über die Grenzen der Gemeinde hinaus wirken. Mit dem Missionsauftrag Christi sind alle Menschen gemeint. Die Glaubensund Gemeindemission hatte immer auch zum Ziel, Menschen über die Gemeindegrenzen hinaus zu erreichen. Dazu wurden vielen Versuche unternommen: Hausbesuche, Zielgruppenangebote, Diskussionsveranstaltungen im öffentlichen Raum usw. Dabei erlebte sie, dass Strategien, wie sie in anderen gesellschaftlichen Bereichen erfolgreich angewendet werden (wie z.B. in der Werbung, in der Wirtschaft oder in der Politik) in jenen Zusammenhängen, in denen es um Glaubensfragen geht, nicht in gleicher Weise funktionieren. Im Bereich des Glaubens braucht es persönlichen Kontakt.
Um Menschen, die nur wenig am Gemeindeleben teilnahmen, ansprechen zu können, suchte die Gemeindemission in den jeweiligen Gemeinden Personen, die sich in das missionarische Bemühen einbeziehen ließen und den Kontakt zu den anderen herstellten. Sie wurden gebeten, im privaten oder im halböffentlichen Rahmen Freunde, Arbeits- oder Vereinskolleg_innen zu Gesprächen „über Gott und die Welt“ einzuladen, an denen dann ein Missionar von auswärts teilnahm. Dabei hat sich bewährt, ein Thema vorzuschlagen, das einerseits die Eingeladenen anspricht, andererseits aber auch Gespräche über Glaubensfragen zulässt. Meistens begannen solche Gespräche bei tagesaktuellen oder gruppenspezifischen Themen, gingen dann weiter zu den jeweiligen „heißen Eisen“ der gesellschaftlichen und kirchenpolitischen Diskussion und boten meist auch Gelegenheit, die damit verbundene persönliche Glaubensebene anzusprechen. Auf diesem Weg gelang es mitunter, mit Milieus ins Gespräch zu kommen, die sich von kirchlichen Angeboten nur selten eingeladen fühlten. Das Besondere an diesem Vorgehen bestand darin, dass ein Gruppeninsider einen Gesprächsraum herstellte, in den eine Person von auswärts Impulse einbringen konnte, die sonst nicht zur Sprache kamen. Nicht selten wurde bei solchen Begegnungen ein Grundvertrauen aufgebaut, auf das persönliche Einzelgespräche folgen konnten.
2.6. Zeugen des Glaubens
Eine wichtiges weiteres Merkmal der Missionspredigt ist das damit verbundene Glaubenszeugnis. Es ist kaum möglich, über existenzielle Fragen zu reden, ohne sich dabei selbst in der eigenen Glaubenshaltung und Überzeugung einzubringen.
Dabei sind meines Erachtens zwei Ebenen zu unterscheiden. Jede/r Sprecher_in zeigt beim Reden von seiner/ihrer eigenen Person mehr, als ihm/ihr zunächst selbst bewusst ist. Neben Sachkompetenz ist Authentizität ein wesentlicher Teil jeder Glaubwürdigkeit. Dies gilt in besonderer Weise für die Predigt. Jeder Prediger, jede Predigerin, gibt immer auch ein Glaubenszeugnis. In der sonntäglichen Predigt und bei Ansprachen zu verschiedenen Anlässen der Gemeinde muss der Prediger/die Predigerin damit jedoch sehr behutsam umgehen, denn aus dem eigenen Leben zu erzählen kann leicht ins Peinliche abgleiten. Und die Echtheit der Verkündigung wird im Alltag der Gemeinde laufend überprüft.
Diese Grenze verläuft meiner Beobachtung nach in außerordentlichen Predigtsituationen anders als in der normalen Gemeindepredigt. Im Zusammenhang grundlegender Glaubensthemen sind die Hörerinnen und Hörer daran interessiert, was der Prediger, die Predigerin ganz persönlich glaubt und wovon diese überzeugt sind. In dialogischen Gesprächssituationen wird sie oder er nicht selten ausdrücklich danach gefragt. Jedoch auch in der monologischen Form der Missionspredigt werden Inhalte erwartet, aus denen der persönliche Glaube des Predigers erschlossen werden kann. Die Grenzen des guten Geschmacks verlaufen in dieser außerordentlichen Situation zwar anders, sind aber auch hier zu beachten.
Noch eine letzte Beobachtung: Nicht unwesentlich für das Glaubenszeugnis war das Miteinander des jeweiligen Missionsteams. Nach außen hin sollten sie sich ergänzen, um möglichst viele Menschen anzusprechen, miteinander sollten sie modellhaft Gemeinschaft vorleben.
3. Ausblick
Zusammenfassend kann die Tradition der Volks- und Glaubensmission als ein „Verkündigungsformat“ gelesen werden, das es verstand, unterschiedliche Ebenen und Aspekte der Glaubensverkündigung zusammenzufassen und miteinander zu verbinden; vergleichbar mit „Sendeformaten“, wie wir sie vom Hörfunk oder Fernsehen her kennen. Solche Formate müssen immer neu gefunden und entwickelt werden. Volks-, Gemeinde- oder Glaubensmissionen, wie sie noch im 20. Jahrhundert im deutschen Sprachraum gehalten wurden, „funktionieren“ heute nicht mehr. Die Rahmenbedingungen dieses Seelsorgeformats sind vielfach nicht mehr gegeben. Die Missionspredigt enthält Erfahrungen, die auch für künftige pastorale Projekte bedenkenswert sind. Es lohnt sich meines Erachtens darüber nachzudenken, wie diese für missionarische Initiativen in unserer Zeit genutzt werden könnten.
Gegenwärtig wird oft von der Notwendigkeit einer Neumission geredet. „Europa ist wieder Missionsland geworden“, heißt es da und dort.8 „Mission first!“ gab Kardinal Christoph Schönborn als Motto mit auf den Weg für den Diözesanen Entwicklungsprozess der Erzdiözese Wien.9 Wenn wir jedoch Mission als fortgesetzte Evangelisierung verstehen und begreifen, dass jede Person und jede Generation in jeder Epoche das Evangelium für sich neu entdecken muss, und dass jede/r Getaufte sich ein Leben lang bemühen muss, „Christus anzuziehen“, (vgl. Gal 3,27 und Eph 4,22 ff), sollten wir eher sagen: Europa ist Missionsland geblieben und hat sich in den verschiedenen Epochen dieser Aufgabe auf vielfältige Weise immer wieder neu gestellt. Nun steht eine neue Phase der Evangelisierung Europas an, in der es gilt, den neuen Entwicklungen in unserer Gesellschaft Rechnung zu tragen. Es genügt nicht, alten Wein in neue Schläuche zu füllen, wie dies mitunter versucht wird.
3.1. Existenzielles Betroffensein und Verkündigung
Kirchliche Seelsorge hat in den letzten Jahrzehnten auf die veränderten Lebenssituationen der Menschen auf vielfache Weise reagiert und die seelsorglichen Angebote in Lebensbereichen, in denen existenzielle Lebenskrisen erlebt werden, wie z.B. in Krankenhäusern, im Pflegebereich, in Gefängnissen usw., ausgebaut und vor allem qualitativ verbessert. Auch auf Gemeindeebene gibt es viele neue Initiativen wie Besuchsdienste, qualifizierte Begleitung von Sterbenden und Trauernden… Haupt- und ehrenamtliche Kräfte engagieren sich in der Notfallseelsorge und der Krisenintervention.
Die Erfahrungen der traditionellen Missionsbemühungen stellen uns vor die Frage: Finden die existenziellen Fragen der Menschen in der ausdrücklichen Verkündigung genügend Beachtung? Kann auf diese Fragen an den vorgegebenen Verkündigungsorten wie etwa den sonntäglichen Gottesdiensten und den Kasualien ausreichend eingegangen werden? Ich sehe noch viel Platz für neu zu entwickelnde Verkündigungsformate, die sich dieser Aufgabe stellen. Was die Missionspredigt in der Vergangenheit mit rhetorischen Mitteln eingebettet in liturgische Inszenierungen angestrebt hat, müsste unter den gegenwärtigen medialen Bedingungen neu angegangen werden.
Grundlegende Lebensfragen ändern sich weniger rasch als die Lebenssituationen, in denen sie uns begegnen. Die uralten Themen treten in alten und neuen Lebens-Geschichten und in kleinen und großen Erzählungen auf. Sie werden nicht mehr nur verbal vorgetragen, sondern in vielfältigen Ausgestaltungen. Musik, Bilder und Bildsequenzen sind bevorzugte Formen der Kommunikation geworden.
In diesem Zusammenhang gewinnt die Bibel einen neuen Stellenwert in der religiösen Kommunikation. Denn auch sie erzählt gerne. Es gilt jedoch, diese große Erzählung neu zu erschließen. In der Vergangenheit wurde sie oft als Repertoire von Regeln und Vorschriften gesehen und genutzt. Sie enthält jedoch die Glaubenserfahrungen und Lebensweisheiten vieler Generationen. Als solche ist sie jedoch nur einem relativ kleinen Kreis von Menschen vertraut. Zusehends an Bedeutung für die Verkündigung gewinnen neue Zugänge zu biblischen Texten. Bibelgespräche in kleinen Gruppen, aber auch Bibliolog und Bibliodrama sind Möglichkeiten, sich in einer Weise mit Bibeltexten auseinanderzusetzen, dass deren Bedeutung für das eigene Leben hier und heute spürbar und bewusst wird. Sie sind darauf angelegt, dass sie die Personen, die sich darauf einlassen, ganzheitlich ansprechen und zur Auseinandersetzung mit den anderen Teilnehmer_innen führen. Manche dieser Formen können auch direkt in einem Gottesdienst eingesetzt werden.
3.2. Gemeinde neu
Rainer Bucher hat neben anderen Pastoraltheolog_innen darauf hingewiesen, dass Gemeinde nicht mehr in dem Sinne „funktioniert“, wie dies in den Jahren nach dem Konzil angedacht war.10 Trotz aller Veränderungen wird sich auch in Zukunft das Leben der Kirche in gemeindlichen Zusammenhängen vollziehen. Auch wenn der Einzelne mehr als in der Vergangenheit in Glaubensdingen seinen eigenen Weg geht und Menschen sich in größeren Räumen vernetzen und Beziehungen herstellen, braucht es auch in Zukunft Orte und Räume, wo „zwei oder drei“ im Namen Jesu zusammenkommen, gemeinsam auf das Wort Gottes hören und seine Gegenwart erfahren.
Auch hier gilt es, die neuen Möglichkeiten zu nützen und Gemeinde neu zu denken und aufzubauen. Das Wachsen der Gemeinde zu fördern, war in der Vergangenheit ein Teilziel der Missionen. Dies wird auch in Zukunft gelten. Erschwert wird dies zwar durch neue gesellschaftliche Milieubildungen und die Schwierigkeit, Milieugrenzen zu überschreiten, aber umgekehrt bieten die neuen Netzwerke und Kommunikationskanäle neue Möglichkeiten, neue Verbindungen herzustellen.
3.3. Persönliche Überzeugungen – überzeugende Persönlichkeiten
Eine entscheidende Rolle für die Wirkung einer Mission hatte die Persönlichkeit der Missionare: ihre Glaubwürdigkeit, Überzeugungskraft, Sachkompetenz, rhetorische Kompetenz, Kommunikationsfähigkeit… Sie hatten als Prediger, Liturgen, Gesprächspartner und eventuell auch als Beichtväter in verhältnismäßig kurzer Zeit die Herzen der Menschen zu gewinnen. Es ist meines Erachtens kein Zufall, dass Missionen von Orden gehalten wurden. Ordensgemeinschaften konnten schon im Vorfeld auf die Teambildung achten und spezifische Weiterbildung betreiben und haben mit ihrer spezifischen Ausrichtung immer auch Menschen mit bestimmten Talenten angesprochen.
Die Anforderungen haben sich im Laufe der Zeit noch weiter ausdifferenziert und die Erwartungen sind heute noch höher denn je. Weitere, zusätzliche, Kompetenzen – Stichwort neue Medien, neue Kommunikationsformen11 – sind notwendig, um in der Gegenwart anzukommen. Eine Person wird das nicht in sich vereinigen können. Ein neues, sich ergänzendes Miteinander im Team müsste meines Erachtens entwickelt werden.
Die „Missionspredigt“ und ihre Einbettung in ein historisch gewachsenes Seelsorgekonzept kann wichtige Impulse für die Fortsetzung der Evangelisierung in Europa und auch in anderen Ländern geben. Die wichtigste Erkenntnis ist für mich, dass es das Zusammenwirken vieler Komponenten braucht und dass Evangelisierung nicht mit eindimensionalen Konzepten gelingen kann. Die Erfahrungen mit der Volks- und Gemeindemission bestärken mich in der Vision, dass es in Zukunft neue seelsorgliche „Formate“ geben wird, die alte und neue Kommunikationsformen nutzen, um mit möglichst vielen Menschen über Grundfragen des Lebens und des Glaubens in Dialog zu treten.
Literatur
Bucher, Rainer, …wenn nichts bleibt, wie es war. Zur prekären Zukunft der katholischen Kirche, Würzburg 2012.
Fuchs, Alois, 150 Jahre Pfarre Roggendorf, Eggenburg 1934.
Krieger, Walter / Sieberer, Balthasar (Hg.), Missionarisch Kirche sein, Linz 2008.
Polak, Regina, Mission in Europa? Auftrag – Herausforderung – Risiko, Innsbruck 2012.
Schedl, Alfred, Das Ringen um eine zeitgerechte Volksmission in Österreich. Eine historische Besinnung (1823-1985), in: Spicilegium Historicum C.Ss.R 33, 1985, Fasc. 1, 229-241.
Sievernich, Michael, Mission der Weltkirche, in: Stimmen der Zeit 222 (5/2004), 289-220.
Springer, Franziscus, Mission in Nucera. 9.11.-11.12.1823. Spicilegium Historicum C.Ss.R 4, 1956, Fasc. 1, 28-43.
1 Die Bewegung für eine bessere Welt (Movimento per un mondo migliore) ist eine Geistliche Gemeinschaft, die 1952 von P. Riccardo Lombardi SJ gegründet wurde.
2 Bei einem Besuch in einem Kloster in der Nähe von Neapel im Jahre 1982 demonstrierte uns ein Mitbruder, der diese Form der Predigt noch beherrschte, diese neapolitanische Tradition.
3 1823, also kurz nach der Anerkennung der Redemptoristen in Österreich durch Kaiser Franz I., sandte die Ordensleitung P. Franziscus Springer nach Neapel, um zu erkunden, wie dort Volksmissionen gehalten wurden. Er verfasste einen ausführlichen Bericht, der im Spicilegium Historicom C.Ss.R. (Jahr 4, 1956, Fasc. 1, 28-43) veröffentlicht ist.
4 Seit der josephinischen Kirchenreform waren diese verboten.
5 Im Büchlein „150 Jahre Pfarre Roggendorf“ (Bezirk Horn) wird von einer Volksmission im Jahre 1852 berichtet, zu deren Predigten jeweils mehrere Tausend Missionsteilnehmer_innen gekommen sein sollen. Auch wenn die Zahlen stark übertrieben scheinen, sind es erstaunlich viele. (Vgl. Fuchs, 150 Jahre Pfarre Roggendorf.)
6 P. Alfred Schedl gibt im Spicilegium Historicum C.Ss.R (Jahr 33, 1985, Fasc. 1, 229-241) einen Überblick über die Entwicklung der Volksmissionen in Österreich.
7 Volksmissionen wurden auch von anderen Ordensgemeinschaften gepredigt. Eine jede hatte ihre eigene Tradition und setzte eigene Akzente. Inhaltlich orientierte man sich an den großen Themenkreisen der Theologie: Gott, Erlösung, Eschata, Sakramente und Maria als die große Mittlerin, die zu Christus und zu Gott hinführt.
8 Vgl. Sievernich, Mission der Weltkirche.
9 Diözesaner Entwicklungsprozess Apg 2.1 der Erzdiözese Wien 2012.
10 Vgl. Bucher, …wenn nichts bleibt, wie es war.
11 Seit dem Einzug der sog. neuen Medien in das alltägliche Leben sind neue Kommunikationsmöglichkeiten für jedermann verfügbar. Vor allem die jüngere Generation drückt sich in Bildern, Videos und Musik aus. Wer mit ihnen kommunizieren will, muss nicht nur die Technik, sondern auch die Sprache der Bilder und der Musik beherrschen.