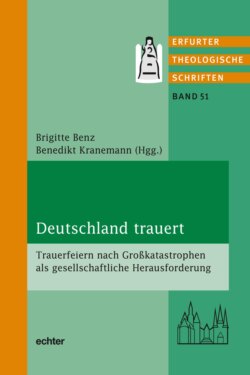Читать книгу Deutschland trauert - Группа авторов - Страница 10
ОглавлениеKollektive Trauer und ihre Rolle im Aufarbeitungsprozess einer Schule
Christiane Alt
Wenig mehr als 9 Minuten währte der Mordfeldzug des Täters, der sechzehn Menschen das Leben kostete, über 500 Schüler und 50 Lehrer/innen, Schulangestellte und Mitarbeiter einschließlich ihrer Angehörigen und Familien zu Opfern und Betroffenen werden ließ.
Dem steht ein jahrelanges Ringen der Gemeinschaft um Verarbeitung und Rehabilitation gegenüber.
Anders als bei Unglücken, bei denen Menschen zufällig zu einer Schicksalsgemeinschaft werden, zurückkehren in bekannte Strukturen, die Stabilität bieten können, wird in diesem Fall ein bestehender Organismus in seiner Gesamtheit verletzt und zahlreichen Einflüssen unterworfen, die mitunter eine Eigendynamik entwickeln und somit Gesundung schwerfallen lassen.
Am späten Nachmittag des 26. April 2002, nachdem das Gebäude evakuiert war, die Rettungs- und Erstbetreuungsmaßnahmen eingeleitet – eine ganze Stadt in Sprachlosigkeit verharrte, die Meute der Berichterstatter von Gebäude und einzelnen Betroffenen zunehmend Besitz ergriff, offenbarte sich der erste große Verlust einer Notwendigkeit, um Trauer zulassen zu können: Der Verlust der Struktur, der Verlust des Bekannten!
Das Schulgebäude war Tatort, Ermittlungsstandort, Medienobjekt und Pilgerstätte und vor ihm wuchs das Meer an Blumen und Trauergaben.
Die Schulgemeinde hatte ihr Zuhause verloren.
Hier begann die Akutphase, die alle Verantwortlichen herausforderte, denn entgegen auch anderen Vorstellungen galt es jetzt, die Gemeinschaft zusammenzuhalten, Trauerbegleitung professionell anzubieten und Raum dafür zu geben.
Wir fanden im Erfurter Rathaus diesen Raum für eine Woche, da der damalige Oberbürgermeister spontan und unkonventionell die artikulierten Bedürfnisse der Schulangehörigen aufnahm.
Mit mehr als 50 Traumatherapeuten und Psychologen aus ganz Deutschland, 80 Lehrkräften, die sich bereiterklärten, Schüler/innen eine Art Alltag zu geben, Seelsorgern und Helfern wurde Alltag simuliert, der keiner war – dennoch war die Ahnung des Bekannten – morgens in die „Schule“ zu gehen, vertraute Menschen zu treffen und Gesprächspartner zu haben, unverzichtbar für das Trauern des Einzelnen in und mit der Gemeinschaft.
Im Angesicht des erlittenen Verlustes artikulierte sich Trauer auch durch Wut- und Trotzreaktionen. Die Schüler/innen, die nur wenige Tage vor dem Abitur standen, manifestierten ihren Willen jetzt weiterzumachen – die gesamte Schülerschaft, unterstützt durch die Eltern und Lehrer, stellte der Tat den starken Willen zur Rückkehr in die Realität entgegen; den Weg vom Opfer zum Agierenden.
Ein Interimsgebäude wurde in einem atemberaubenden Zusammenspiel von Behörden, Institutionen und freiwilligen Helfern in dieser einen Woche zum funktionsfähigen Schulbau vorbereitet. Damit war die Hülle für die 2. Phase des Trauer- und Aufarbeitungsprozesses gegeben.
Schulische Abläufe mussten mit dem psychologischen Betreuungskonzept kompatibel werden. Traumabewältigung und Fortsetzung der Schullaufbahnen galt es zu koordinieren.
Hier zeigte sich, dass kollektive Trauer nur dann zur Progression gelangen kann, wenn Transparenz, Kommunikation und Partizipation die Leitlinien des Handelns aller Beteiligten, besonders der Verantwortungsträger, darstellen.
Im Mittelpunkt der inhaltlichen Arbeit steht das Gespräch. Runde Tische, Arbeitsgruppen, Workshops, Schulzeitung und Arbeit an Projekten, die sich aus der entstandenen Situation ableiten ließen, wurden unerlässliche Instrumente, um Trauerrituale, Formen des Gedenkens an die Opfer, Umbau des ehemaligen Schulstandortes und die Annahme des Geschehens in den Alltag „dieser Schule“ konsensfähig zu entwickeln.
Drei Jahre währte diese Phase im Interimsobjekt, da die Schule – ein Denkmal, gebaut 1908 – unter Berücksichtigung des Ereignisses umfangreich umgebaut wurde. Ziel war, Vertrautes zu bewahren, dem Haus seine Ursprünglichkeit nicht zu nehmen; da zu verfremden, wo dem, der zurückkehren will und kann, keine neuen Verletzungen widerfahren, und Bedingungen entstehen zu lassen, die die Schule von heute braucht, um einen Lernort zu schaffen, für die Nutzer, die das traumatische Ereignis verarbeiten – aber auch die Schüler- und Lehrergeneration, die in die Gemeinschaft kommt und die Geschichte des Hauses als Außenstehende annehmen kann.
2005 erfolgte der mehr als ein Jahr lang vorbereitete Rückzug und eröffnete die 3. Phase: das Ankommen.
Im Rahmen einer Projektwoche – professionell begleitet und pädagogisch aufbereitet – erfolgte die Rückkehr in das Stammhaus vor den Sommerferien. Partizipation nach den eigenen Möglichkeiten war maßgebliches Kriterium, Rückkehr und Ankommen zu gestalten. Dabei wurden Wege beschritten, die keine Vorbilder hatten.
Zuhören, Hinsehen, Reflektieren, das Unproduktive benennen und die optimale Lösung suchen: Dieses Zusammenspiel kann als Instrumentarium für den Aufarbeitungsprozess resümiert werden.
Da, wo es galt, Entscheidungen gegen eine Rückkehr zu treffen, waren Optionen und Angebote verfügbar.
Anzumerken ist hier, dass die Anzahl der Schüler/innen und Lehrer/innen, die diesen Weg für sich wählten, sehr gering ist; und dass diese Entscheidungen bereits zeitnah zum Ereignis gefällt wurden.
Auch das Trauerritual zum jährlichen Gedenken an die Opfer ist einer Entwicklung unterworfen.
Waren zunächst der Staatstrauerakt und die Gedenkveranstaltung zur ersten Wiederkehr des 26. April auf dem Erfurter Domplatz Rituale kollektiver Trauer, ist seit 2004 das jährliche Gedenken vor dem Schulgebäude ein selbstbestimmtes Gedenken.
Schüler, Lehrer und Ehemalige bereiten langfristig das Konzept des Rituals vor. Dabei lässt sich eine hohe Schüleraktivität und -kreativität erkennen, die auch nach dem Verlassen der Abiturienta 2010 – dem letzten Jahrgang unmittelbar involvierter Schüler/innen – ungebrochen ist.
Das Schulritual wird öffentlich durchgeführt und ermöglicht dem Angehörigen, dem Bürger der Stadt sowie ihren Besuchern die Teilnahme. Die Schule öffnet sich im Anschluss als Stätte der Begegnungen. Diese beiden Positionen stellen die Säulen des Rituals dar.
Die inhaltliche Gestaltung des Rituals und die Begegnungsformen sind offen für aktuelle Entwicklungen in der Schulgemeinde.
Kollektive Trauer hat das Potential, dem Einzelnen Kraft und Halt aus der Gemeinschaft zu geben, obgleich ihr Sog auch rückschlagend wirken kann.
Daher lässt sich aus unseren Erfahrungen bestätigen, dass der Begriff der „Kontinuität“, den der Soziologe Prof. Tilmann Allert als Umgangsform mit dem Tod entwickelt hat, im Aufarbeitungsprozess für die Schule eine entscheidende Rolle gespielt hat.
Auch nach mehr als 16 Jahren kehren Ehemalige zurück, die inzwischen ihre Biografien nach der Schule fortsetzen, deren traumatische Erlebnisse Bestandteil ihres individuellen Wegs geworden sind, um immer dann im Besonderen wieder in der Schule Gesprächspartner und Verlässlichkeit zu treffen, wenn das Ereignis zurück und in ihr aktuelles Leben greift.
Das Gutenberg-Gymnasium in Erfurt hat den 26. April 2002 als Teil der Schulgeschichte angenommen. Die Schule fügt sich durch ihr Profil in die Erfurter Schullandschaft ein – die Annahme als Lernort ist für Eltern und Schüler ungebrochen. Sie ist aber auch ein Haus, in dem immer dann auf Erfahrungen zurückgegriffen wird, wenn eine ähnlich schockierende Tat die Menschen erneut erschüttert – Erfahrungen im Umgang zwischen Menschen mit gleichen Schicksalsschlägen – Erfahrungen mit den immer gleichen Abläufen der „Blitzlichtgewitter“, den Reden und Statements und unserer scheinbaren Ohnmacht gegenüber dem Phänomen …