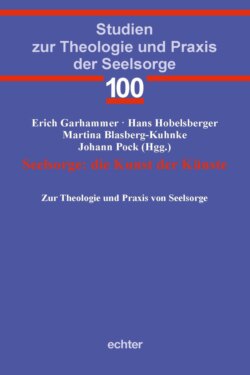Читать книгу Seelsorge: die Kunst der Künste - Группа авторов - Страница 13
ОглавлениеDorothee Haart
Neue Entwicklungen der Krankenhausseelsorge im ökonomisierten Gesundheitswesen
Zehn Jahre liegt die Veröffentlichung meiner Dissertation ‚Seelsorge im Wirtschaftsunternehmen Krankenhaus‘ zurück. Mein Anliegen war damals, vor dem Hintergrund neuer Gesetzgebung Prozesse der Ökonomisierung im Gesundheitswesen zu verfolgen und den Strukturwandel im Krankenhaus nachzuvollziehen: Welche Bedeutung hat der Wandel eines Krankenhauses zum Wirtschaftsunternehmen für die Menschen, die dort arbeiten und die Patient*innen, die auf Heilung hoffen? Schließlich galt es, die Auswirkungen für die Arbeit der Krankenhausseelsorge aufzuzeigen und Anregungen zu geben, wie sie sich positionieren kann. Im Folgenden sollen angesichts neuer Herausforderungen diese Fragen weiter geführt werden.
Folgen des Wettbewerbs im Gesundheitswesen
Was vor zehn Jahren noch als Prognose angekündigt war, ist heute Realität geworden. Die Einführung des auf DRG (Diagnosis Related Groups) basierenden Abrechnungssystems ab 2004 hat die Krankenhäuser zu mehr Wirtschaftlichkeit veranlasst und die Privatisierung im Krankenhaussektor beschleunigt. Waren 1991 noch 46,0 Prozent der Krankenhäuser in öffentlich-rechtlicher, 39,1 Prozent in freigemeinnütziger und 14,8 Prozent in privater Trägerschaft, so sind 2015 nur noch 29,5 Prozent der Krankenhäuser in öffentlich-rechtlicher, 34,7 Prozent in freigemeinnütziger und bereits 35,8 Prozent in privater Hand (Statistisches Bundesamt, 9).
Im Jahr 2016 hat sich der Deutsche Ethikrat in seiner Stellungnahme ‚Patientenwohl als ethischer Maßstab für das Krankenhaus‘ mit den Entwicklungen im Krankenhauswesen befasst mit der Begründung, dass „durch eine vorrangige Fokussierung auf Ausgabenverringerung seitens der Krankenkassen und Ertragssteigerung auf Seiten der Anbieter Effekte entstanden, die im Hinblick auf das Patientenwohl als maßgeblicher normativer Maßstab Anlass zur Sorge geben“ (Deutscher Ethikrat, 7). Kritisch bewertet wird etwa die Konzentration auf besonders gewinnbringende Behandlungsverfahren bis hin zu Anreizen für ethisch problematisches ärztliches Handeln (Deutscher Ethikrat, 124). Permanente Interventionen und Nachjustierungen seitens des Gesetzgebers versuchen dem zu begegnen, doch im hoch komplexen DRG-System tun sich immer wieder neue Fehlentwicklungen auf. „Seit 2009 kam es im Durchschnitt jedes Halbjahr zu Änderungen unter anderem des Krankenhausfinanzierungsgesetzes, des Krankenhausentgeltgesetzes und des GKV-Versorgungsstrukturgesetzes“ (Deutscher Ethikrat, 34). In dem Papier werden vor allem Patientengruppen mit besonderen Bedarfen aufgeführt, die durch Anreize des DRG-Systems häufiger benachteiligt werden: Kinder und Jugendliche, hochaltrige Menschen mit geriatrischen Erkrankungen, mit Demenz, mit Behinderung, Multimorbide oder Patient*innen mit Migrationshintergrund (Deutscher Ethikrat, 94–114).
Für Ärzteschaft, Pflege und Gesundheitsberufe ist im Rahmen der Ökonomisierung der Aufwand an Administration gestiegen; hohes aktuelles Wissen über neueste Konditionen und präzise Dokumentation sind notwendig, um finanzielle Verluste zu vermeiden. Dies tritt als zeitraubende Anforderung neben die patientengerechte Versorgung. Als ein Kernproblem macht der Ethikrat daher auf den Mangel an Kommunikation zwischen Behandlern und Patient*innen aufmerksam (Deutscher Ethikrat, 134). Verschlechterte Arbeitsbedingungen infolge Zeitmangels und chronischer Überlastung vergrößern den gegenwärtigen Fachkräftemangel im Krankenhaus.
Viele Kliniken haben inzwischen dieses Problem erkannt. Vor dem Hintergrund des Wettbewerbs sowohl um Patient*innen als auch um Personal gewinnen Rankings der Mitarbeiter- und Patientenzufriedenheit zunehmend an Bedeutung. Zertifizierungsprogramme greifen mittlerweile auch die ‚weichen Faktoren‘ der Krankenhausarbeit auf. Als Beispiel sei genannt der Verbund ‚Qualitätskliniken.de‘ unter Beteiligung großer privater Träger (Asklepios, Rhön, Sana) und auch Universitätskliniken, in dessen Leitfaden für ‚Ethik & Werte‘ unter anderem das Maß an Kultursensibilität erfasst wird, die Berücksichtigung religiöser Werte und auch das Angebot der Seelsorge.
Das Interesse der Kliniken an Krankenhausseelsorge wächst
Erwartungsgemäß ist somit inzwischen auch die Krankenhausseelsorge mehr in die Aufmerksamkeit der Klinikträger gerückt. Stellen bisher noch die beiden großen Kirchen Personal und Finanzen für die Seelsorge zur Verfügung, zeichnet sich jetzt vermehrt eine Bereitschaft von Klinikseite ab, sich an der Finanzierung zu beteiligen. Der leitende Geschäftsführer der größten deutschen privaten Klinikkette Helios macht klar: „Je stärker sich die Seelsorge in Richtung der ‚emotional orientierten‘ Betreuung von Patienten/Angehörigen bewegt, (und nicht allein ‚religiös orientierte‘ Betreuung im Blick hat … Ergänzung D. Haart) desto mehr muss sie finanziert werden aus Krankenhausbudgets“ (De Meo 2017). In seinem Beitrag beim 1. Ökumenischen Kongress der Krankenhausseelsorge in München stellt er fest, dass die Krankenhausseelsorge gerade aufgrund ihrer Rolle in der Klinik schwer zu ersetzen sei, sofern es um emotionale Belange gehe. Eine Fortbildungsinitiative des Helioskonzerns für Ärzteschaft und Pflegepersonal mit dem Ziel einer professionelleren emotionalen Begleitung habe wenig Anklang gefunden mit der Begründung, dass eine Zusatzqualifizierung in ‚Emotionaler Begleitung‘ nur schwer vereinbar sei mit der ärztlichen bzw. pflegerischen Rolle. Die Krankenhausseelsorge ist somit durchaus auch aus Nutzenperspektive interessant, glaubt man den Äußerungen eines führenden gewinnorientierten Klinikkonzerns.
Wenn also in absehbarer Zeit nicht nur konfessionelle Kliniken, sondern auch öffentliche und private Träger beginnen, sich an der Finanzierung von Seelsorgestellen zu beteiligen – eine Entwicklung vergleichbar den USA, wobei hierzulande erst nur an eine anteilige Kostenbeteiligung gedacht ist – wirft das für die Zukunft eine Menge Fragen auf: Wer wird künftig die Inhalte der seelsorglichen Arbeit bestimmen, wer wird ihre Qualität überprüfen? Werden sich Seelsorger*innen im Sinne einer ‚Option für die Armen‘ noch besonders den Schwachen und Benachteiligten im Krankenhaus zuwenden können? Oder werden sie ausschließlich nach den Maßgaben des medizinisch-ökonomischen Systems und gemäß einer Leistungsabrechnung durchaus auch kostenbewusst aktiv werden müssen? Wo Kirchen und Klinikträger sich die Kosten teilen, muss dies sorgfältig ausgehandelt werden, damit Krankenhausseelsorge weiterhin im Geist des Evangeliums geschieht. S. Borck, Verantwortlicher im Bereich Seelsorge der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, schlägt vor, dafür ‚Bündnisse für Seelsorge im Krankenhaus‘ zu schließen: „Klinik-Leitung und kirchliche Leitung, auch in ökumenischer Gemeinschaft, kommen in regelmäßigen Abständen zusammen (…) und vereinbaren, was genau zu tun ist“ (Borck 2017).
Die Kirchen haben noch keine Strategie
Hierzu braucht es allerdings kompetente, überregional wirkende, in der Kirchenleitung verankerte Personen, die mit der Materie vertraut sind und auf Augenhöhe zu den Klinikkonzernen Auftrag und Profil kirchlicher Seelsorge theologisch begründet sicherstellen. Denn die Krankenhausseelsorge arbeitet mit anderen, im Krankenhaus fremden Prämissen. Sie darf nicht in den Leitkategorien des medizinischen oder des ökonomischen Denksystems der Klinik aufgehen, um ihrem beruflichen Selbstverständnis treu zu bleiben. Sie muss ihre fremde Sicht ins Krankenhaus einbringen können und wird „in gewisser Weise randständig bleiben müssen, weil sie immer für eine an den Rand gerückte Wirklichkeit in der Krankenhauswelt steht“ (Haart 2006, 269).
Leider gestaltet sich die Entwicklung in den Kirchen nicht diesen Anforderungen entsprechend. In den Bistümern und Landeskirchen ist die Krankenhausseelsorge unterschiedlich organisiert: teilweise ist sie an die Seelsorgeämter angebunden, teilweise an die Kirchenkreise oder Dekanate. Die katholische Kirche steuert derzeit weiter in Richtung Dezentralisierung: die dienstliche Verantwortung für die Krankenhausseelsorge wandert vielerorts weg von den bischöflichen Seelsorgeämtern zu den Leitern der neu errichteten Großpfarreien. Die Folgen sind fatal: Diese Kleinteiligkeit in der Verantwortung macht den Dialog mit großen Klinikverbünden schwierig und zudem eine Verständigung in der Ökumene fast unmöglich. Ökumenische Kooperation ist aber dringend notwendig, um den Klinikträgern mit starkem inhaltlichen Profil zu begegnen und auch, um nicht durch interne Konkurrenz die Prozesse zu behindern. Dass auch heute, nach 10 Jahren, trotz wachsenden Bewusstseins in der Ökumene noch keine nennenswerten Fortschritte gemacht sind, liegt überwiegend daran, dass viele Bistümer und Landeskirchen aufgrund unklarer interner Zuständigkeiten nicht ins Gespräch auf Leitungsebene kommen. Mehr wäre da möglich, trotz der nicht überall deckungsgleichen kirchlichen und staatlichen Territorialgrenzen! Als gelungenes Beispiel sei hier die Rahmenvereinbarung zur Klinikseelsorge zwischen der Diözese Rottenburg-Stuttgart und der evangelischen Landeskirche in Württemberg erwähnt (Traub, Karrer 2016).
Nachwuchsmangel in der Krankenhausseelsorge
Aus Sicht der Kirchenverantwortlichen bleibt die Seelsorge jenseits der Ortspfarrei ein Randphänomen der Pastoral. Bisher berief man sich auf mangelnde finanzielle Mittel. Heute rückt ein anderes Phänomen in den Vordergrund: das fehlende pastorale Personal. Bistümer und Landeskirchen gehen unterschiedlich mit der neuen Situation um. Einige kürzen Stellen in der Krankenhausseelsorge, obwohl die Kliniken wachsenden Bedarf anmelden und anteilig refinanzieren. Aus kirchenpolitischer Sicht wird man das Stellenverhältnis nicht vom territorialen in Richtung eines kategorialen Einsatzes vergrößern wollen, auch wenn finanzielle Mittel für letzteren Bereich zur Verfügung stehen. Als Konsequenz droht der kirchliche Rückzug aus dem wichtigen gesellschaftlichen Feld des Gesundheitswesens, obwohl gerade hier den Kirchen und ihrer Seelsorge von externer Seite eine hohe Plausibilität und Relevanz zugemessen wird.
Die konfessionellen Klinikträger, besorgt um ihr christliches Profil, entwickeln heute erste Strategien, dem Nachwuchsmangel im kirchlichen Personal zu begegnen. Einige unterstützen Initiativen, Ehrenamtliche für die Seelsorge zu qualifizieren. Inzwischen gibt es vielerorts gute Ausbildungsstandards und Konzepte mit hoher Qualität, die allerdings auch hohe Ressourcen der Hauptamtlichen einfordern, berücksichtigt man zudem die ungewisse Dauer des jeweiligen Engagements. Ehrenamtlicher Einsatz umfasst meist nur einige Wochenstunden, deckt ausschließlich die Einzelseelsorge ab, ist nicht erreichbar für Krisenintervention. Ehrenamtliche werden institutionell nicht in gleicher Weise eingebunden wie Hauptamtliche. Sie können die theologisch und pastoralpsychologisch ausgebildete Seelsorge allenfalls ergänzen, jedoch keineswegs ersetzen. Das Ehrenamt ist zudem keine unbegrenzte Ressource, unter sozialpolitischem Einspardruck hat inzwischen ein regelrechter Wettbewerb um ehrenamtliche Kräfte begonnen.
Ein zweites Modell stützt sich auf einen Personal-Mix: unter der Leitung einer Theolog*in wird eine Abteilung ‚Krankenhausseelsorge‘ in der Klinik eingerichtet, die aus Quereinsteigern verschiedener Gesundheitsberufe zusammengesetzt ist. In konfessionellen Häusern geschieht dies aus einer Tradition heraus, dass früher Ordensleute, meist aus der Pflege kommend, irgendwann seelsorgliche Tätigkeiten übernahmen. Uneinheitlich ist bislang der Umfang der Qualifikation: geben sich einige Kliniken mit einer 6-wöchigen Weiterbildung in ‚Klinischer Seelsorgeausbildung‘ (KSA) zufrieden, werden an anderen Standorten aufwändigere Weiterqualifikationen organisiert (z. B. 4-jährige Ausbildung im Bistum Münster inklusive theologischem Fernstudium). Eine problematische Entwicklung bahnt sich hier an, ausgelöst durch den wachsenden Bedarf und das abnehmende kirchliche Angebot an Seelsorge: durch Senkung der Anforderungen in Ausbildung und Aufgaben droht diese Profession in die Beliebigkeit zu geraten. Den Titel ‚Seelsorger*in‘ können schließlich viele tragen, auch ohne theologische Ausbildung, denn der Seelsorgebegriff ist gesetzlich nicht geschützt. Alle, die sich den Kranken zuwenden, machen dann im christlichen Krankenhaus irgendwie ‚Seelsorge‘. An manchen Kliniken werden Teilaufträge in der Seelsorge vergeben an Personal, das auch weiterhin in Medizin, Pflege oder Sozialarbeit eingesetzt ist. Wie hier den zu erwartenden beruflichen Rollenkonflikten begegnet werden will, bleibt unbeantwortet. Auch wer hier ‚Geistlicher‘ im Sinne des staatlich garantierten Zeugnisverweigerungsrechtes und des Seelsorgegeheimnisses ist, bleibt bisher ungeklärt. Hier müssten die Kirchen kritischer nachfragen. Bemerkenswert ist zumindest, dass gerade die kirchlichen Einrichtungen hier den Anfang machen. Andere Kliniken werden deren Beispiel folgen.
Bisher sind aus den öffentlichen oder privaten Klinikverbänden noch keine Initiativen bekannt, dem Nachwuchsmangel in der Krankenhausseelsorge zu begegnen. Doch erste Andeutungen aus dem Helios-Konzern zeigen, dass die Monopolisierung der Seelsorge in kirchlicher Verantwortung keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Wo die Kirchen kein seelsorgliches Personal zur Verfügung stellen, so De Meo, müssen sich „die Krankenhäuser zum Ausbau eigener Servicebereiche hierfür entschließen, bzw. entsprechende Leistungen ggf. von anderen Dritten ‚einkaufen‘“ (De Meo 2017). Auch diesen Servicebereichen dürfte man künftig den Titel ‚Seelsorge‘ nicht verwehren.
Neue Zugangswege zur Krankenhausseelsorge
Soll die professionelle christliche Krankenhausseelsorge künftig weiter Bestand haben, müssen die Kirchen neue Wege wagen. Als erstes gilt es, aktiv für kirchlichen Nachwuchs zu werben für einen durchaus reizvollen kirchlichen Beruf. Die deutsche Seelsorgestudie zur Berufszufriedenheit in der katholischen Pastoral bescheinigt besonders den kategorialen Seelstorgefeldern wie der Krankenhausseelsorge eine hohe Attraktivität (Baumann 2004, 194 ff). Bisher gibt es jedoch keinen direkten beruflichen Zugang zur Krankenhausseelsorge. Theologiestudium und berufspraktische Ausbildung (Vikariat o. ä.) sind gänzlich auf die territoriale Seelsorge hin ausgerichtet. Erst aus einem gemeindlichen Arbeitsfeld heraus und mit nochmaliger pastoralpsychologischer Weiterbildung ist der Weg in die Krankenhausseelsorge möglich.
Neue Interessenten könnten gewonnen werden durch einen eigenen Hochschulabschluss zur Krankenhausseelsorge. Für Menschen mit einem anderen sozial- oder humanwissenschaftlichen akademischen Abschluss wäre ein Masterstudiengang ‚Krankenhausseelsorge‘ bzw. ‚Seelsorge im Gesundheitswesen‘ mit einer sich anschließenden berufspraktischen Ausbildung ebenfalls eine Brücke zu diesem Beruf. S. Borck schlägt einen Studiengang vor „… ohne drei alte Sprachen, aber bewusst im Studium auf Auslegung, Hermeneutik und Deutung setzend (…) mit umfangreichem Seelsorge-Lernen, mit kommunikativer und humanwissenschaftlicher, mit ethischer und mit gottesdienstlicher und Ritualkompetenz“ (Borck 2017). Denkbar wäre, dass die theologischen Nachweise aus den Fakultätsbereichen der evangelischen, der katholischen Theologie oder auch anderer Religionen erbracht werden. Unverzichtbar für die spätere Praxis bleibt jedoch die Einbindung in und die Beauftragung durch eine Religionsgemeinschaft. Eine mehrjährige berufspraktische Ausbildung (vergleichbar einem Vikariat), die sich an das mehr wissenschaftlich geprägte Studium anschließt, fände ihren Ort in Feldern des geistlichen Lebens der jeweiligen Kirche oder Religionsgemeinschaft und diente auch der persönlichen Entfaltung der geistlichspirituellen Beheimatung. Am Ende käme für nicht ordinierte Seelsorger*innen eine Art ‚Missio‘ in Frage, vergleichbar der Regelung für die Religionslehrer*innen im Deutschen Schulsystem. Kircheneigene Schulämter nehmen hier die Fachaufsicht wahr, bei kirchlich bestellten Lehrer*innen ebenso die Dienstaufsicht. So fiele die Krankenhausseelsorge nicht unter die Qualitätssicherung und den Abrechnungsmodus des Gesundheitssystems und verlöre nicht ihr unabhängiges Profil.
Die Akademisierung der Krankenhausseelsorge durch einen eigenen Lehrstuhl würde auch den Anforderungen gerecht, die vermehrt aus dem Gesundheitssystem an die Seelsorge gerichtet werden: die akademische Aus- und Weiterbildung der medizinischen und pflegerischen Berufe in Kompetenzen wie Spiritual Care, Kultursensibilität, Medizinethik und Berufsethik. Seelsorge und Gesundheitsberufe könnten sich in Studium, Aus- und Weiterbildung wechselseitig um die professionelle Perspektive des je anderen ergänzen.
Ein akademischer Studiengang ‚Seelsorge im Gesundheitswesen‘ ermöglicht es auch, sich zwei weiteren Herausforderungen zu stellen, die seit den 10 Jahren meiner Dissertation erst jetzt mehr ins Zentrum gerückt sind: der wachsenden Bedeutung von Spiritual Care im Gesundheitswesen und der vermehrten Berücksichtigung von Interkulturalität und Interreligiosität im Behandlungskontext.
Verhältnisbestimmung Krankenhausseelsorge und Spiritual Care
Nicht durch Initiative der Kirchen sondern des Gesundheitssystems selbst hat Spiritual Care zugunsten einer ganzheitlichen Betreuung des Menschen in Praxis und Forschung an Bedeutung gewonnen. Vorreiterin ist die Palliativmedizin, welche laut WHO-Definition die Berücksichtigung spiritueller Bedürfnisse und spirituellen Schmerzes (Total-Pain-Konzept von Cicely Saunders) als Grundbestandteil der Behandlung betrachtet. Spiritual Care beruht hier auf einem weiten Spiritualitätsbegriff, der für Patient*innen aller Religionen und Weltanschauungen kompatibel ist. Die derzeit am weitesten rezipierte Definition für ‚Spiritualität‘ formulierte 2010 die Europäische Gesellschaft für Palliativmedizin: „Spiritualität ist die dynamische Dimension menschlichen Lebens, die sich darauf bezieht, wie Personen (individuell und in Gemeinschaft) Sinn, Bedeutung und Transzendenz erfahren, ausdrücken und/oder suchen, und wie sie in Verbindung stehen mit dem Moment, dem eigenen Selbst, mit Anderen/m, mit der Natur, mit dem Wesentlichen (significant) und/oder dem Heiligen“ (www.eapcnet.eu Übersetzung T. Roser).
Gegenwärtig entspannt sich eine Diskussion um das Verhältnis zwischen Krankenhausseelsorge und Spiritual Care. Wie definiert und positioniert sich christliche Krankenhausseelsorge gegenüber einem solchen von der Medizin favorisierten Verständnis von Spiritualität? Kritische Stimmen wenden sich gegen die Vagheit des Spiritualitätsbegriffs. Sie sei „der Preis der Entkonkretisierung und Entsinnlichung der Religion“ (Karle 2010, 554). Des Weiteren befürchtet I. Karle eine Tendenz der Seelsorge, sich therapeutischem Zweckdenken und ‚spirituellen Copings‘ anzugleichen und somit ihre Rolle zu verwässern. Therapeutisches Denken sei allzu einseitig auf Akzeptanz von Krankheit und Tod ausgerichtet und gebe kaum Raum für Widerstand und Klage und die Würde, die auch in der Untröstlichkeit liege. Sicherlich sind diese Einwände berechtigt und können nicht oft genug für die Schärfung des seelsorglichen Selbstverständnisses vorgebracht werden. Auch die von D. Nauer aufgeführten ‚Inkompatibilitäten‘ (z. B. das Neutralitäts-Postulat als Anspruch an eine christlich motivierte und inspirierte Seelsorge) gilt es ernst zu nehmen (Nauer 2015, 144 ff).
Jedoch liegt dieser Debatte häufig ein Missverständnis zu Grunde: Krankenhausseelsorge kann ja nicht gleich gesetzt werden mit der Spiritual Care eines Behandlungsteams bzw. einer Klinik. „Spiritual Care ist kein Synonym für Krankenhausseelsorge“, so E. Frick, „und auch nicht an die Seelsorge delegierbar“ (Frick 2012, 68). T. Roser sieht keine, wenn auch oft befürchtete, Konkurrenz zwischen Seelsorge und Spiritual Care (Roser 2015, 233). Für ihn ist Spiritual Care ein übergreifender Organisationsbegriff. Spiritual Care sei eine Anforderung an alle Professionen im Krankenhaus, zu der die Krankenhausseelsorge auf Basis kirchlicher Trägerschaft und organisationaler Unabhängigkeit einen spezifischen Beitrag leiste, gemäß ihrer Rolle und ihres Selbstverständnisses. Spiritualität ist kein Begriff mehr, auf den die Kirche ein Patentrecht hat. „[D]er Begriff Spiritualität ist aus dem Bereich von Kirche und Religion in die säkulare Welt hinübergewandert“ (Weiher 2009, 218). Trotzdem bleibt es Aufgabe der kirchlichen Krankenhausseelsorge, eine theologisch verantwortbare Begleitung und Unterstützung auch für ‚Nicht- oder Andersgläubige‘ innerhalb ihrer je eigenen Spiritualität zu gewährleisten. E. Weiher hebt diese Aufgabe hervor als kirchlichen Grundvollzug in Form einer ‚Spirituellen Diakonie‘ (Weiher 2009, 219). So gesehen sollte Krankenhausseelsorge nicht Abgrenzung sondern Sprachfähigkeit zeigen gegenüber Nicht-Kirchenmitgliedern bei der Frage, was eine in Krisen tragfähige Spiritualität sein kann. Konkurrenz ist allenfalls zu befürchten, wenn die Kirchen kein eigenes, gut qualifiziertes Personal mehr dafür zur Verfügung stellen.
Die Debatte um Spiritual Care spiegelt letztlich die Auseinandersetzung wider, die auch meiner Dissertation zugrunde lag: geht die Krankenhausseelsorge ganz auf im pflegerisch-medizinischen Denksystem zugunsten einer ‚Behandelnden Seelsorge‘ (Haart 2007, 239 ff) oder etwa im betriebswirtschaftlichen Management (Haart 2007, 255 ff), oder bleibt sie ihrem Auftrag durch das Evangelium treu? Krankenhausseelsorge bleibt eine Gratwanderung im Gesundheitswesen, und umso wichtiger bleibt das stete Ringen um die eigene, theologisch reflektierte Position. Bisher erfährt die Selbstreflexion allerdings durch schwache kirchliche Strukturen nur geringe Unterstützung. Ein Lehrstuhl ‚Seelsorge im Gesundheitswesen‘ böte hier andere Möglichkeiten der Forschung und Lehre. S. Peng-Keller, Theologe und Professor für Spiritual Care in Zürich, will aus der Perspektive interprofessioneller Forschung den Begriff Spiritual Care weniger auf eine bestimmte Konzeption angewandt sehen sondern als ‚Gattungsbegriff‘ behandeln und als Überbegriff für sehr unterschiedliche Modelle und Ansätze. Für die Praxis der Krankenhausseelsorge merkt er an: „Zu den Fragen, die innerhalb des interdisziplinären Spiritual Care-Diskurses geklärt werden müssen, gehört auch jene nach dem spezifischen Beitrag und Profil einer durch religiöse Gemeinschaften beauftragten Krankenhausseelsorge. Wenn es eine Pluralität von Spiritual Care-Modellen gibt und ‚Spiritual Care‘ nicht mit einem einzigen Modell identifiziert werden darf, stellt sich für die Praktische Theologie die Aufgabe differenzierter Verhältnisbestimmung zu spezifischen Modellen und Ansätzen“ (Peng-Keller, 180).
Spiritual Care als Forschungsgebiet liegt heute überwiegend in der Hand anderer Professionen wie Medizin, Soziologie, Psychologie und Pflegewissenschaften mit eigener Methodik. „Auffällig ist, dass dabei in der Regel nicht auf Forschungsmethoden der Religionswissenschaften oder Theologie zurückgegriffen wird, sondern ganz eigene, zumeist empirisch validierbare Verfahren sozial- und naturwissenschaftlicher Art entwickelt werden“ (Leget 2015, 227). Hier wären eigene theologische wissenschaftliche Studien notwendig. Im anglo-amerikanischen Spiritual-Care-Diskurs ist etwa die rein medizinische Sichtweise nicht unumstritten. Soziologische und theologische Beiträge kritisieren eine Engführung des klinisch-therapeutischen Spiritual-Care-Modells mit seiner individualisierten Sicht. Ausgeblendet blieben hier die gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Kontexte und Ansätze, die für mehr Gerechtigkeit und Solidarität im Gesundheitswesen stehen (Peng-Keller, 180).
Krankenhausseelsorge im Interreligiösen Diskurs
Ein weiteres Phänomen hat die Krankenhausseelsorge in den letzten Jahren neu beschäftigt: die kulturelle Vielfalt sowohl der Patient*innen als auch des Personals ist in die Aufmerksamkeit der Kliniken gerückt. „‚Interkulturelle Kompetenz‘ wird als Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts bezeichnet“ (Deutscher Ethikrat, 66). Viele Krankenhäuser verpflichten sich als Mitglieder der Unternehmensinitiative Charta der Vielfalt (www.charta-der-vielfalt.de) dazu, die Verschiedenheit ihrer Mitarbeiterschaft zu respektieren und zu unterstützen. Laut Charta der Vielfalt gehören Religion und Weltanschauung sowie die ethnische Zugehörigkeit zur inneren Dimension des Menschen, sind also am engsten mit der Persönlichkeit verknüpft, ebenso wie das Alter und das Geschlecht.
In heutiger Zeit sind es vor allem Menschen islamischer Kulturkreise, die im Krankenhaus unter Fremdheit leiden und die auch der Seelsorge bedürfen, wie die Deutsche Islamkonferenz 2017 in ihrem Abschlussdokument zur Seelsorge in öffentlichen Einrichtungen festhält: „Die Etablierung einer islamischen Krankenhausseelsorge ist vielmehr als die mit Abstand größte Aufgabe in der Fläche anzusehen, was den offensichtlichen Bedarf an religiös-seelsorglicher Begleitung von Menschen islamischer Religionszugehörigkeit in Deutschland betrifft“ (Deutsche Islamkonferenz, 4). Erste Modellprojekte, die überwiegend auf die Schulung von ehrenamtlichen islamischen Seelsorger*innen hinausliefen, gestützt durch Module der kirchlichen Klinischen Seelsorgeausbildung, waren nur anfangs hilfreich: „Die Islamkonferenz stellt zugleich fest, dass diese zumeist zeitlich befristeten Modellprojekte unter einer Reihe von Gesichtspunkten an ihre Grenzen stoßen. Als eine Hauptschwierigkeit ist die fehlende Kooperation mit bereits etablierten islamischen Religionsgemeinschaften oder das Fehlen eines religionsverfassungsrechtlich legitimierten Ansprechpartners zu nennen“ (Deutsche Islamkonferenz, 5). Konkret mangelte es den islamischen Ehrenamtlichen an einer von vielen Klinikleitungen eingeforderten Beauftragung durch ihre Religionsgemeinschaft, die die fachliche und dienstliche Aufsicht mit einschließt.
Die Deutsche Islamkonferenz fordert hierzu die islamischen Organisationen bzw. Religionsgemeinschaften auf, die Rahmenbedingungen für eine Etablierung islamischer Krankenhauseelsorge zu klären, welche auch die Schaffung hauptamtlicher Strukturen in den Blick nimmt. Denn: „Zudem ist der Mangel an Rückbindung der ehrenamtlich in der Seelsorge Tätigen an eine professionalisierte hauptamtliche Struktur problematisch, da diese bislang fehlt, aber eigentlich unerlässlich ist, um die Betreuung der Seelsorgerinnen und Seelsorger sicherzustellen, die Zuständigkeiten, Grenzen des Auftrags und Fragen der Aufsichtspflicht zu klären sowie Qualitätssicherung durch Supervision zu gewährleisten“ (Deutsche Islamkonferenz, 5).
Eine grundsätzliche Schwierigkeit besteht darin, dass die Islamische Theologie aus ihrer Tradition her keine eigene Seelsorgetheorie kennt (Cimsit, 14 Fußnote 3). Ganz am Anfang steht daher noch die Entwicklung von theologisch fundierten Konzepten der islamischen Krankenhausseelsorge. Hier sind die universitären Zentren für Islamische Theologie gefragt, eigene Forschung zu betreiben und auch zur Ausbildung von qualifiziertem Personal und zur Schaffung von Möglichkeiten der Fortbildung beizutragen (Deutsche Islamkonferenz, 5 f). Erste Lehrstühle haben diese Arbeit begonnen, etwa das Zentrum für Islamische Theologie in Heidelberg mit einem Masterstudiengang für Praktische Islamische Theologie für Seelsorge und Soziale Arbeit oder das Institut für Islamische Theologie der Universität Osnabrück mit einem Studiengang Gemeindepädagogik und Seelsorge. Es ist zu erwarten, dass die hier ausgebildeten islamischen Seelsorger*innen eine höhere Akzeptanz durch die örtlichen Islamischen Verbände erfahren als die Ehrenamtlichen der auf kirchlichem Seelsorgeverständnis gestützten Institute. Hier, an den Universitäten, muss auch der Ort sein, an dem der dringend notwendige interreligiöse Diskurs stattfinden kann um die theologischen Grundlagen der Seelsorge, etwa bei Fragen zum jeweils zugrunde liegenden Menschenbild oder zum je religiös gedeuteten Krankheitsverständnis.
Ausblick
Nicht zuletzt auf dieser Tatsache beruht mein Vorschlag, dass die wissenschaftliche Weiterentwicklung der ‚Seelsorge im Gesundheitswesen‘ einen Ort in den Universitäten findet. Dort kann, im wissenschaftlichen Diskurs mit anderen Professionen des Gesundheitswesens (beispielsweise zu Spiritual Care), die Seelsorge ihre theologische Perspektive einbringen. Im Dialog der Religionen ist ihr aufgetragen, ihr Selbstverständnis interkulturell zu bedenken. Ob in den konfessionseigenen Hochschulen diese Diskurse in gleichem Maße möglich sind, oder ob eine Ausbildung dort eher die konfessionelle Isolation befördert, wäre als Frage noch zu klären – jedenfalls wäre eine ‚geistliche‘ Beauftragung für Seelsorge verknüpft mit der sich anschließenden praktischen Ausbildung in der jeweiligen Religionsgemeinschaft. Nur im steten Austausch und in der professionellen Selbstvergewisserung bleibt die Krankenhausseelsorge schließlich eine relevante Größe im Expertensystem Krankenhaus.