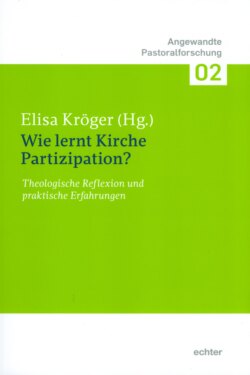Читать книгу Wie lernt Kirche Partizipation - Группа авторов - Страница 10
ОглавлениеMartin Pott
Projekt „Verantwortung teilen“ – Mosaikstein einer diözesanen Pastoralentwicklung
Im Frühjahr 2013 hat das Bistum Aachen als erste deutsche Diözese einen Kooperationsvertrag mit dem neu gegründeten „Zentrum für angewandte Pastoral-forschung“ (ZAP) der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum abgeschlossen. Im „ZAP-Konfigurator“ mit seinen sieben inhaltlichen Linien sollte sich das Projekt auf der Linie der „Partizipation“ bewegen. Anlass für dieses Kooperationsprojekt war damals die im November 2013 erstmals bevorstehende Wahl der neuen Synodalgremien auf Ebene der pastoralen Räume. Diese pastoralen Räume, von denen es 71 gibt, haben im Bistum Aachen den Namen „Gemeinschaften der Gemeinden“. Neben dem aktuellen Anlass gab es aber einen tieferen Grund für dieses Vorhaben: Es sollte sich einfügen in den „Prozess Weggemeinschaft“ des Bistums, der seit nunmehr über 25 Jahren eine Pastoral verfolgt, die in der Gottsuche die jeweilige Lebenssituation der Betroffenen unbedingt ernst nimmt und die Menschen als Expertinnen und Experten ihres eigenen Lebens und Glaubens ansieht. Vom ZAP erhoffte sich das Bistum wissenschaftliche Expertise, die Möglichkeit der Kommunikation mit vergleichbaren Projekten in anderen Diözesen sowie vor allem in Person der für das Aachener Projekt zur Verfügung gestellten wissenschaftlichen Mitarbeiterin Elisa Kröger eine wichtige „Außenperspektive“, theologische und Exposure-Kompetenz und Inspirationen jedweder Art.
Im Folgenden wird das Projekt, das unter dem Label „Verantwortung teilen“ firmiert, in vier Abschnitten aus der Sicht eines unmittelbar im Projekt involvierten Bistumsmitarbeiters dargestellt. Zunächst geht es (1) um die Kontextualisierung des Projekts in Geschichte und Geist des Bistums Aachen; zum Zweiten (2) soll die strategische Funktion des Projektes in der diözesanen Pastoralentwicklung thematisiert werden. Es folgt dann (3) die Bewertung des Projektertrags aus Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer wie des Bistums, ehe es abschließend (4) um die bleibende Herausforderung geht, die sich nach drei Jahren Erfahrung mit „Verantwortung teilen“ abzeichnet.
1. KONTEXTUALISIERUNG
1.1 COMMUNIO ALS THEOLOGISCHE LEITKATEGORIE
Der frühere Aachener Bischof Klaus Hemmerle hat im Jahr 1989 den Impuls „Weggemeinschaft“ ins Bistum Aachen gegeben.1 Er verstand den Impuls nicht als Vorgabe von oben, sondern als Einladung zu einem Prozess! Theologisch hat er im Begriff der Weggemeinschaft; zwei zentrale Begriffe des Zweiten Vatikanums miteinander verknüpft: den des Volkes Gottes unterwegs und den der Communio. „Communio“ rückte als theologischer Zentralbegriff in der nachvatikanischen Phase immer mehr in den Vordergrund.2 Stärker als der Begriff des „Volkes Gottes“ betont Communio die interpersonale Dimension. Communio ist zunächst Gabe Gottes. Erst im zweiten Schritt erwächst daraus die Auf-Gabe für die Kirche, ihrerseits Gemeinschaft mit Gott und untereinander anzuzielen (vgl. LG 1). In ihrer Ekklesiogenese darf Kirche sich theologisch von der innertrinitarischen Communio leiten lassen.3 Vater, Sohn und Geist sind trialogisch aufeinander bezogen. Ihre Kommunikationsstrukturen sind reziprok und symmetrisch. Hemmerle betont:
„In der Communio gibt es nicht die Unterscheidung zwischen nur Gebenden und nur Nehmenden. Auch die Annahme will durch die Gabe selber zu einem gebenden, Wert schaffenden und partnerischen Geschehen ‚entbunden‘ werden. Aber auch das Geben ist ein Beschenktwerden.“4
So zu reden setzt voraus, dass Personsein nicht als reine Individualität, sondern im Sinne eines beziehungsontologischen Denkens als Gleichursprünglichkeit von Individualität und Relationalität verstanden wird.
Die Brisanz dieser communio-theologischen Linie für die Ekklesiologie und noch mehr die Ekklesiopraxie ist enorm. Vielleicht ist dies der Grund dafür, dass ihre Umsetzung in ekklesiale Organisationsstrukturen weitgehend noch aussteht? Denn, was würde daraus für das Ganze der Glieder des Volkes Gottes, gleich ob am gemeinsamen Priestertum aller oder zusätzlich am ordinierten Dienstamt teilhabend, folgen? Klaus Hemmerle drückt es so aus:
„Nur wo das Subjektsein aller in der Kirche, nur wo die Angewiesenheit auch jener, die Charismen zu beurteilen haben, auf die Charismen anderer, jener, die Dienste zu ordnen haben, auf diese Dienste und jener, die zu verkünden haben, auf den ‚produktiven‘ Glauben anderer zur Geltung kommt, ist das Maß von Communio eingelöst.“5
Teilhabe am Ganzen meint eben nicht die Inanspruchnahme eines Stückes vom Kuchen als Eigenes, „vielmehr ist das Ganze in jedem und ist jeder im anderen, und die Weise, wie das Ganze im Einzelnen enthalten ist, und das Einzelne dem anderen das Ganze auf je seine Weise schenkt, ist maßgeblich“6. Aus genau dieser konstitutiven wechselseitigen Ergänzungsbedürftigkeit erwächst die Wahl von „Verantwortung teilen“ zum Projekttitel. Es geht nicht darum, die unabtretbare subjektive Verantwortung zu schmälern oder sich davon zu dispensieren. Es geht vielmehr darum, dass Alle ihre je persönliche Verantwortung als ganze und ungeteilte dann dennoch so mit den Anderen in Kontakt bringen, dass, ohne dass etwas von dem Einzelnen verloren ginge, sich darin für Alle das Ganze tiefer erschließt und eine ermergente Qualität aufscheint.
1.2 PLURALE PASTORAL
Weggemeinschaft ist für Hemmerle die Sache und Methode eines neuen Denkens. Der Inhalt und die Vermittlung des Inhalts gehören für ihn untrennbar zusammen. Hemmerles Nachfolger im Bischofsamt, Bischof Dr. Heinrich Mussinghoff (1995 bis 2015), führte den Weggemeinschafts-Gedanken auf seine Art fort. Als ein Bischof, der gerne und viel mit Partnern aus dem christlich-jüdischen und dem interreligiösen Dialog zusammen war, lag ihm jede Verengung fern. Er warb für eine katholische Weite, die er besonders auch durch die in Aachen ansässigen Werke MISEREOR, missio und Kindermissionswerk repräsentiert sah. Bischof Mussinghoff war zu keiner Zeit für einen Rückzug auf die kirchliche Sozialgestalt der Pfarrei zu haben. Ihm war die Pluralität kirchlicher Präsenzformen heilig. Neben klassischen kategorialen Seelsorgefeldern wie der Krankenhaus-, JVA-, Hochschul-oder Behindertenseelsorge fielen in seine Amtszeit der Ausbau von Citypastoral und Trauerpastoral, Hospizarbeit und Seelsorge in der Arbeitswelt. Im neuen Nationalpark Eifel wurde ebenso eine Nationalparkseelsorge eingerichtet wie aktuell für den neuen Campus der Aachener RWTH-Universität eine kirchliche Präsenz in Planung ist.
1.3 SYNODALE KIRCHE
Schon die frühere Satzung für die Pfarrgemeinderäte im Bistum Aachen sprach davon, dass der PGR teil an der Gemeindeleitung habe. Der Wert synodalen Miteinander-auf-dem-Weg-seins hat Tradition im Bistum. Dabei ist die Synodalität durchaus umstritten, vor allem wenn es konkret wird in der Frage, wer was wann entscheiden soll und darf. Zu dieser auch fünfzig Jahre nach dem Konzil noch bestehenden Spannung gehört ein in Lumen Gentium 12 angelegter Konflikt, den Jochen Hilberath so beschreibt:
„Wenn das Volk Gottes mit Hilfe des Geistes in den überlieferten Glauben ‚mit rechtem Urteil tiefer eindringt und ihn im Leben voller anwendet‘ (LG 12), dann braucht es in der Kirche Kommunikationssituationen und Verfahrensweisen, damit das Bemühen um einen consensus fidelium aus dem sensus fidei heraus möglich und fruchtbar wird.“7
Eine Kirche, in der das Volk Gottes im ernsten Sinne des Wortes am Weg partizipiert, mutiert zwangsläufig vom erratischen Block zu einer „fließenderen“ Form.8
1.4 BESONDERE FORMEN DER LEITUNG
Aus der Grundsympathie für eine partizipativ angelegte Pastoral entstehen im Bistum Aachen zwei besondere Formen der Leitung der Pfarrei.9 Seit 1993 wird in einer begrenzten Zahl von Fällen die Leitung der Pfarrei nach c. 517 § 2 CIC/1983 praktiziert. Von der Anwendung dieses Kanons kann der Diözesanbischof bei Priestermangel Gebrauch machen. Er kann dann andere Personen an der Wahrnehmung der Seelsorgsaufgaben beteiligen und muss ihnen einen Priester, der nicht kanonisch ernannter Pfarrer ist, als sogenannten „Moderator der Seelsorge“ an die Seite stellen. Anders als andere Bistümer in Deutschland beauftragt das Bistum Aachen nie Einzelpersonen und keine Hauptberuflichen. Beauftragt werden vielmehr kleine Gruppen freiwillig Engagierter aus der Pfarrei. Damit wird deutlich, dass dieser Kanon auch nur Anwendung finden kann, wenn die Pfarrei schon vorher wesentlich von ehrenamtlichem Engagement getragen ist und insofern die Ressource von Freiwilligen reichhaltig vorhanden ist. Dem mit der Pfarreileitung nach c. 517 § 2 CIC/1983 beauftragten Freiwilligen sowie dem bestellten moderierenden Priester wird dann aus dem Pastoralteam des pastoralen Raums ein pastoraler Mitarbeiter/eine pastorale MitarbeiterIn, meistens Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten, als professionelle Begleitung mit einem bestimmten Beschäftigungsumfang an die Seite gestellt. Ein zweites besonderes Leitungsmodell ist als diözesanes Recht verankert und verdankt sich dem ersten Bistumstag 1996. Es ist das Modell „Gemeindeleitung in Gemeinschaft“ aus dem Jahr 1998, das ebenfalls eine erweiterte Pfarreileitung vorsieht, in diesem Fall aber bei vorhandenem kanonisch ernannten Pfarrer. Hier leiten vom Pfarreirat gewählte und vom Bischof beauftragte Ehrenamtliche zusammen mit Mitgliedern des Pastoralteams und dem Pfarrer die Pfarrei. Die Leitung erfolgt gemeinschaftlich, was nicht heißt, dass alle Rollen verschwimmen.
Beide Wege sind anspruchsvoll und erfordern viel Kommunikation und Koordination. Von daher verwundert nicht, dass die Modelle nur in einer begrenzten Zahl von Pfarreien des Bistums Anwendung finden, zur Zeit aktuell in vier (Pfarreileitung nach c. 517 § 2 CIC/1983) bzw. drei (Pfarreileitung nach „Gemeindeleitung in Gemeinschaft“) Pfarreien.
1.5 NEUORDNUNG DER PASTORALEN RÄUME
Diese besonderen Leitungsformen für einzelne Pfarreien sind eingebettet in das seit 2000 verfolgte Konzept neuer pastoraler Räume. Wie in den meisten deutschen Diözesen hat es Strukturanpassungen aus Anlass des Priestermangels und wegen der veränderten Zugehensweisen der Menschen auf Kirche gegeben. So ist das Bistum Aachen aktuell in 71 pastorale Räume eingeteilt, die zwischen 7.000 und 25.000 Katholiken umfassen. 27 dieser Räume bestehen nach umfassenden Fusionsprozessen in der Rechtsform einer Pfarrei. Die anderen Räume bestehen aus 2 bis 19 selbständig existierenden Pfarreien, vor allem im ländlichen Raum. Für die pastoralen Räume hat der Bischof erstmals 2005 pastorale Leitlinien erlassen, die 2011 in revidierter Form bestätigt wurden.10
Alle 71 Gemeinschaften der Gemeinden haben parallel zu diesen Prozessen der Strukturanpassung erstmals ein „Pastoralkonzept“ für ihren pastoralen Raum erarbeitet. Auf diese Weise sollte sichergestellt werden, dass nicht nur die „Organisation GdG“ ein Update erfährt, sondern vor allem auch der „Organismus GdG“ in seiner lebendigen Vielfalt gesehen und kultiviert wird. Auch wenn die Qualität dieser Konzepte durchaus verschieden ausfällt, so ist dennoch ein Anfang gemacht auf dem Weg einer mittelfristigen Pastoralplanung. Das Instrument ist vielerorts Katalysator für die Debatte um die Vision von Kirche, um Grundsätze des Handelns, um sozialraumorientierte und milieusensible pastorale Zielsetzungen, um schmerzhafte Abschiede und hoffnungsvolle Aufbrüche. Im Rahmen der Etablierung der pastoralen Räume sowie der Fusionsprozesse wurde 2013 auf der Grundlage einer neu entwickelten Satzung zum ersten Mal eine „GdG-Rats-Wahl“ durchgeführt, d. h. das entscheidende synodale Gremium der Ebene „Kirche am Ort“ ist nun der „Rat der Gemeinschaft der Gemeinden“ (GdG-Rat).11 Unterhalb des GdG-Rats ist es möglich, Pfarreiräte und/oder Gemeinderäte zu installieren, die lokale Zuständigkeit und Verantwortung haben. Dagegen ist der GdG-Rat „Planungs- und Entscheidungsorgan in allen grundlegenden Fragen der Pastoral, unbeschadet der Rechte der in den Pfarreien der Gemeinschaft der Gemeinden kanonisch ernannten Pfarrer“ (Satzung §3, 1). Der GdG-Rat ist ein pastorales Leitungsorgan: „Der GdG-Rat hat teil an der Leitung der Gemeinschaft der Gemeinden.“ (Satzung § 3, 3) Die Brisanz dieser Satzungspassagen ist noch längst nicht zu allen vorgedrungen, geschweige denn, dass sie schon die allgemeine Praxis prägen würde. „Verantwortung teilen“ will die Vorstände der GdG-Räte mit den Chancen, aber auch der Verantwortung dieser Satzungsaussagen so in Kontakt bringen, dass sie erkennen und dann auch praktisch umsetzen können, was an synodaler Sprengkraft hier enthalten ist (siehe unten Kapitel 4.).
Nach dem Motto „Global denken – lokal handeln“ soll der GdG-Rat aus seiner überörtlichen Perspektive beurteilen und entscheiden, was pastoral besser lokal vor Ort anzugehen und umzusetzen ist und was angemessener und wirkungsvoller auf der Ebene des ganzen pastoralen Raums oder in noch einmal existierenden Substrukturen passieren soll. Gemäß dem von Christian Bauer geprägten Wortspiel „Nähe und Weite statt Enge und Ferne“ wahrt die neue Satzung strikt das Subsidiaritätsprinzip und weitet gleichwohl den Blick in eine Raumdimension, die vor allem im städtischen und rand-städtischen Raum eher dem Lebensgefühl und den Bewegungsräumen der Zeitgenossinnen und Zeitgenossen entspricht.12
1.6 NEUE WEGE GEHEN – GRÜNDEN!
Das bisher skizzierte Profil der bistümlichen Pastoralentwicklung schärfte Bischof Dr. Heinrich Mussinghoff gegen Ende seiner Amtszeit noch einmal durch die Akzentuierung der Motive des „neuen Wegs“ und des „Gründens“ – und zwar einerseits gegenüber seinen MitarbeiterInnen und Mitarbeitern im pastoralen Dienst:
„Neue Gestalten von Kirche pflanzen, neue Formen von Gemeinschaften und Gemeinden gründen, das scheint mir tatsächlich ein Gebot der Stunde zu sein. Über das Wachsen entscheidet Gott – aber schaffen wir das, eine neue ‚Gründerphase‘ einzuläuten? […] Wir brauchen aber eine neue Balance zwischen der Verteilung von Phantasie, Energie und Zeit auf den Kanon von Grunddiensten einerseits und auf Aufbrüche andererseits.“13
Andererseits auch gegenüber den gewählten Pfarrgemeinderäten im Bistum:
„In dem Maße, wie wir das Taufbewusstsein aufbauen, können wir falschen Klerikalismus abbauen. Damit meine ich nicht nur den Klerikalismus, der manche Priester oder andere beauftragte Seelsorgerinnen und Seelsorger zuweilen meinen lässt, jenseits ihrer Kontrolle dürfe nichts passieren. Mit Klerikalismus meine ich auch die allzu schnelle Bereitschaft mancher Getauften, die eigene Verantwortung als Christ oder Christin an die ‚Profis‘ und die ‚Pastoralexperten und -expertinnen‘ abzugeben. Wir brauchen ein neues Zutrauen in die Wirkmacht unserer Taufe und als logische Konsequenz ein neues Vertrauen in die Gaben und Talente der Anderen, die ja auch von Gott Begabte und Berufene sind!“14
Da bloße Appelle nicht reichen, hat das Bistum Aachen für die Berufseinführung ihrer Seelsorgeberufe und für deren Fortbildung das sogenannte „Aachener Gründertraining für Seelsorgerinnen und Seelsorger“ entwickelt, das 2017 zum dritten Mal durchgeführt wird. In diesem Training wird ganz konkret gefragt und eingeübt, wie das in der pastoralen Praxis umgesetzt werden kann, was der Bischof anmahnt:
„Ich stehe dafür, dass wir neue Wege beschreiten, dass wir nicht nur Vertrautes verwalten, sondern Neues gründen. Ich stehe dafür, dass wir lernen, fehlerfreundlicher zu werden und die honorieren, die sich mutig auf den Weg machen, auch wenn sie manchmal in einer Sackgasse stecken bleiben. Das ist allemal besser als vor lauter Ängstlichkeit und Sorge immer nur etwas zu konservieren, dessen Zeit eigentlich abgelaufen ist. Sterben gehört zum Leben. Es ist aber auch ein Gesetz des Lebens, dass immer wieder Neues sprießt.“15
Die bischöfliche Ermutigung mag das Eine sein – das Andere ist es, die apostrophierten „neuen Wege“ vor Ort auch gegen etwaigen Widerstand beharrlich zu gehen. Das Rückgrat des Einzelnen und die persönliche Initiative der Einzelnen sind unabdingbar, für ehrenamtlich Engagierte wie für hauptberuflich Tätige. Ebenso unverzichtbar ist die Spiritualität des langen Atems. Aber im Bistum Aachen dürfen diejenigen, die mutig neue Kirchengestalten anvisieren, ihren Bischof hinter sich wissen.
2. DIE STRATEGISCHE FUNKTION DES PROJEKTS „VERANTWORTUNG TEILEN“ IM DUKTUS DER DIÖZESANEN PASTORALENTWICKLUNG
Mit dem Projekt „Verantwortung teilen“ soll ein Meilenstein gesetzt werden. Ein sowohl äußeres als auch inhaltliches Signal dafür ist die Einbindung des „Zentrums für angewandte Pastoralforschung“. Das ZAP soll nicht nur für fachliche Seriosität stehen, sondern insgesamt Glaubwürdigkeit vermitteln: Das Bistum meint es ernst! Verantwortung soll wirklich neu gedacht und dann auch in neuartiger Weise praktiziert werden. Dafür steht auch die finanzielle Investition, von der Anstellung der Mitarbeiterin bis hin zu einem hochwertigen Kursangebot für ehrenamtlich Engagierte, das für diese kostenfrei ist. Die von außen hinzukommende „Fremde“, d. h. die wissenschaftliche Mitarbeiterin des ZAP, die nun drei Jahre lang immer wieder im Bistum auftaucht – bei Akteuren vor Ort, in diözesanen Gremien, bei Kursen und Veranstaltungen – personifiziert zusätzlich diesen „spirit of change“. Fern der Illusion, ein Projekt dieser Art könne Welten bewegen, lebt die Strategie des Projekts auch von dieser seiner Signalwirkung. Inhaltlich geht es um zwei strategische Hauptstoßrichtungen des Projekts und Bildungsprogramms „Verantwortung teilen“:
(a) Das erste und zentrale strategische Ziel ist es, mit relevanten Akteuren in möglichst vielen pastoralen Räumen einen bestimmten theologischen, pastoralen und pädagogischen Lernweg zu intensivieren und zu konkretisieren. Die leitenden inhaltlichen Linien für diesen Lernweg erschließen sich aus den vorigen Kontextualisierungs-Hinweisen:
– echte Weggemeinschaft mit den Menschen im Sinne des konziliaren Communio-Gedankens intensivieren;
– zu einer wirklichen „Pastoral im Plural“ ermutigen, die sich die Themen von den Lebensfragen der Menschen im Raum geben lässt, bei gleichzeitigem Blick für die Tiefenstruktur von Katholizität;
– angesichts radikalen gesellschaftlichen und kirchlichen Wandels neu nach der eigenen „mission“, der Sendung fragen;
– gut und lange genug hinhören und sich dabei bewusst auch fremden Lebenswelten aussetzen;
– daraus, wo es angezeigt ist, mit den Menschen bedarfs- und bedürfnisorientiert vermehrt neuartige oder bisher unbekannte Gestalten und Präsenzformen von Kirche entwickeln bzw. gründen.
Das Bildungsprogramm „Verantwortung teilen“ soll dabei so etwas wie der Antriebsriemen beim Motor sein: Es soll die Kraft des „inneren Motors“ tatsächlich „auf die Straße bringen“. Seit Jahren besprechen wir ausführlich die theologischen Topoi des gemeinsamen Priestertums und der Taufwürde, der Charismen und der Berufung. Es gibt viel neues Potenzial im Motor. Aber was ist mit der Kraftübertragung? Wie kommt die Energie auf die „Straße“? Wie findet die richtige (neue) Theorie ihre Praxis? Wenn die neue theologische Kraft wirken soll, muss sich der Leitungsstil in Gremiensitzungen ebenso ändern wie die Anlage der Sakramentenkatechese, bekommen diakonische Initiativen ein anderes Gepräge und Liturgien einen neuen Stil. Der Schritt von der Theorie in die Praxis fällt oft schon allein deswegen erkennbar schwer, weil neue Methoden, die der neuen Theologie entsprächen, nicht bekannt bzw. eingeübt sind.
Der Schritt von der Theorie in die Praxis ist aber vor allem ein Schritt vom „Kopf“ in den „Bauch“. Damit wird ein höchst sensibler Aspekt thematisiert, nämlich das Terrain eines langjährig erlernten und biographisch gefestigten Habitus. Theologisches Ringen um eine Pastoral der Berufung, der Achtung der Taufwürde und der geteilten Verantwortung ist zunächst Auseinandersetzung auf der Sachebene. Sie wird mit Argumenten geführt, erzeugt mal Plausibilität, mal Dissens. Aber wie kann sie kulturprägend werden? Wie kann sie einwirken auf die Ebene, die es mit erworbenen Haltungen und Einstellungen zu tun hat? Christian Hennecke sagt mit Blick auf einen neuen Umgang mit Verantwortung in Kirche und Gemeinde: „Vielmehr zeigen sich die Konstitution von örtlichen Gemeinden […] und die Bildung örtlicher Verantwortlichkeit als Spitzen eines Eisbergs: Unter Wasser verbirgt sich ein Prozess des Paradigmenwechsels einer kirchlichen Kultur.“16 Das Paradigma wechseln zu sollen, irritiert den erworbenen Habitus. Pierre Bourdieu versteht unter „Habitus“, wie man sich allgemein gegenüber der Welt verhält.17 „Ein und derselbe Habitus drückt allen Lebensbereichen einen typischen Stempel auf, hinterlässt immer die gleiche Handschrift.“18 – und zwar langfristig:
„So ist die einmal erworbene soziale Mitgift auch dann präsent, wenn in späteren Lebensphasen die Milieuzusammenhänge ‚gewählt’, neue soziale Beziehungen aufgebaut und Lebensentwürfe entwickelt und umgesetzt werden. […] Der Habitus entsteht also in einem bestimmten Milieu, aber er tendiert auch dazu, sich wieder ein Milieu zu suchen und zu schaffen, das seinen Neigungen und Gewohnheiten am ehesten entspricht. […] Da der Habitus also nicht einfach vom Himmel fällt, sondern sich in einem längeren biographischen Prozess entwickelt, ist klar, dass er nicht ad-hoc, sondern nur über anstrengende und zeitraubende Arbeit verändert werden kann.“19
Es geht also um Prozesse des Ver-lernens und Um-lernens, und das im hier zur Debatte stehenden Fall im Kontext einer Organisation, die Meisterin im Schaffen von inneren und äußeren Traditionen ist. Da besteht durchaus die Gefahr, dass die Organisation Kirche, die theologisch strikt Mittel, nicht Zweck ist, unter der Hand sich selbst zum Zweck erhebt, indem sie ihren Selbsterhalt inszeniert. Bourdieu spitzt es organisationskritisch wie folgt zu:
„Der von der Institution organisierte Glaube (an Gott, an das Dogma usw.) kaschiert tendenziell den Glauben in die Institution, das obsequium, sowie alle an die Reproduktion der Institution gebundenen Interessen.“20
Die Botschaften der Institution wirken – sie wirken gerade auch in ihrer Widersprüchlichkeit, so z. B. Botschaften an Priester. Da wird dem ordinierten Amtsträger einerseits von ihrem Bischof gesagt, er solle mit den Leuten in den Gemeinden partnerschaftlich und respektvoll umgehen, denn sie alle seien Berufene und von Gott mit Talenten Ausgestattete. Andererseits wird von Rom 1997 die restriktive „Instruktion zu einigen Fragen über die Mitarbeit der Laien am Dienst der Priester“21 veröffentlicht. Oder den Ordinierten wird zum „Jahr des Priesters“ 2009 im Papstbrief das Bild des Pfarrers von Ars vor Augen geführt. Der Priester des 3. Jahrtausends liest Sätze wie: „Nach Gott ist der Priester alles!“22 Welcher Habitus soll da nun eigentlich gestützt werden?
Im kirchlichen Alltag wirken divergierende kirchlich-systemische Habitus-Konzepte ebenso wie biographisch erworbene je subjektive Haltungen kirchlicher MitarbeiterInnen. Zu rechnen ist in der Praxis durchaus mit Habitus-Konzepten, die wenig Ambiguitäts-Toleranz aufweisen, z. B. in den Beziehungssystemen: Kleriker – Nichtkleriker; professionelle Gemeindereferentin – nichtprofessionelle Ehrenamtliche; Erneuerer – Bewahrer. Gemein ist diesen Habitus, dass sie stark abgrenzend und absichernd sind. Sie stehen damit tendenziell einer Beziehung im Wege, die offen ist für Überraschungen, auch für Überraschungen des Evangeliums. Mit Blick auf ein Label wie „Verantwortung teilen“ sind demnach strategische Entscheidungen nötig, welche Habitus langfristig implementiert werden sollen – und wie demgemäß dann eine konsequente Kulturarbeit in Gestalt von Begleitung und Schulung für freiwillig wie beruflich in Kirche Engagierte auszusehen hat. Diese Entscheidung wurde durch das Bistum Aachen im Sinne der oben aufgeführten inhaltlichen Linien getroffen. Sie schlägt sich im Curriculum des Bildungsprogramms konkret im „Modul II – Pastorale Entwicklung (an-)leiten“ nieder.23
(b) Hieraus leitet sich die zweite strategische Funktion des Projekts für das Bistum ab. Diese betrifft ganz allgemein formuliert das Verhältnis von freiwillig in der Kirche Engagierten und beruflich Tätigen oder Beauftragten. Vor dem Hintergrund der pastoralen Räume und des Projekts „Verantwortung teilen“ wird dieses Verhältnis operativ aufgegriffen als Verhältnis von den im Synodalgremium des pastoralen Raums freiwillig engagierten Mandatsträgerinnen und -trägern einerseits und den vom Bischof eingesetzten Seelsorgerinnen und Seelsorgern (Priester, Diakone, Pastoral- und Gemeindereferenten und -referentinnen) andererseits. Sie sind im synodalen „Rat der Gemeinschaft der Gemeinden“ konstitutiv aufeinander verwiesen. Analog verhält es sich mit den Akteuren, die in den besonderen Pfarrei-Leitungsformen des Aachener Bistums tätig sind.
Für Rainer Bucher sind „Hauptamt-Ehrenamt“ und „Kleriker-Laien“ zwei der aktuell am heftigsten ins Wanken gekommenen Beziehungs-Balancen in der katholischen Kirche.24 Sowohl die Kleriker – „Niemanden trifft der reale Zusammenbruch klerikaler Machtstrukturen auf Grund der Freisetzung zu religiöser Selbstbestimmung härter als die Priester“ – als auch die Laien – „Heute herrscht nicht mehr die Religion über das Leben, sondern biografische Bedürfnisse über Nähe und Distanz zu religiösen Praktiken und Sozialräumen. Mit diesem epochalen Machtwechsel rücken die sogenannten Laien in den Fokus. Denn sie erhalten die enorme „Marktmacht der Kunden“ – finden sich in einer gewöhnungsbedürftigen Rollenkonstellation vor.25
Diese Konstellation ist darüber hinaus verwoben und in ihrer Standfestigkeit zusätzlich beeinträchtigt durch die Hauptamt-Ehrenamt-Polarität. „Die Ehrenamtlichen sind das Andere des professionellen Systems. Für Profis sind alle anderen eben zuerst einmal Nicht-Profis […]. Die Hauptamtlichen stehen ihnen zudem gegenwärtig in einer merkwürdigen Mischung aus Überlegenheit und Abhängigkeit gegenüber.“26 An dieser Stelle soll zum „neuen Ehrenamt“ nur so viel gesagt werden: Die „Marktposition“ der Ressource des freiwilligen Engagements steigt enorm in einer gesellschaftlichen Situation, in der viele Initiativen, Großorganisationen und Körperschaften um sie werben. Von Kommunen bis zu Sportvereinen, von Kirchen bis zu Verbänden der freien Wohlfahrt, von Stadtteilinitiativen bis zu Parteien und Gewerkschaften – alle sind erpicht darauf, diese Ressource „anzuzapfen“. Das vielfältige freiwillige Engagement in der Flüchtlingshilfe ist dafür das beste Beispiel. Insofern spricht Bucher zu Recht von „Abhängigkeit“. Im Kontext Kirche ist wichtig: Die Menschen, um die es hier geht, sind nicht zuerst potenzielle Ehrenamtliche, sondern erst einmal und vor allem Glieder des Volkes Gottes. Jede/r von ihnen hat eine individuelle Berufung durch Gott (GS 3). Wie ihre hauptamtlichen Partnerinnen und Partner sind sie fundamental berufen zur Pastoral in Zeit und Welt.
Die Fortbildungspraxis im Bistum Aachen ist wie vielerorts von einer weitgehenden Separierung des Lernens von Hauptberuflichen hier und Ehrenamtlichen dort geprägt. Das liegt teilweise an praktischen Gründen wie den unterschiedlichen Zeitkorridoren. Das hat auch inhaltlich berechtigte Gründe, da manche Inhalte in der Tat gewinnbringender nicht in „Koedukation“ zu lernen sind. Der Effekt verkehrt sich allerdings dort ins Gegenteil, wo Gruppen mit hoher Verantwortung wie z. B. die Vorstände des Synodalgremiums auf Ebene des pastoralen Raumes, das „Planungs- und Entscheidungsorgan in allen grundlegenden Fragen der Pastoral“ (Satzung, § 3, 1) ist, nicht systematisch gemeinschaftlich trainiert und geschult werden. Das Projekt „Verantwortung teilen“ geht dieses Desiderat offensiv an und erklärt diese gemischten Teams zur Kernzielgruppe seines Bildungsprogramms.
Da das Projekt in der Hauptabteilung Pastoral/Schule/Bildung („Seelsorgeamt“) angesiedelt ist, wird von Anfang an die Kooperation mit der Nachbarhauptabteilung „Pastoralpersonal“ gesucht. Das Bildungscurriculum wird gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der Fortbildung für die pastoralen Dienste entwickelt. Wenn auch die konkret durch die Bildungsmaßnahmen angesprochene Zielgruppe fest umrissen und damit begrenzt ist, so hat das Projekt dennoch den Anspruch, paradigmatisch zu lernen. Es soll vor dem Hintergrund der Gesamt- pastoralentwicklung des Bistums einerseits Lernimpulse in andere Bereiche der Pastoral geben, z. B. die Pastoral im Feld des Gesundheitswesens, die angesichts von Herausforderungen wie Seelsorge-Nachtrufbereitschaft in Krankenhäusern oder Hospizdienste ebenso neue Wege mit freiwillig Engagierten gehen muss und teilweise schon geht. Andererseits ist „Verantwortung teilen“ offen, von Anderen zu lernen, z. B. von den bewährten Schulungs- und Begleitkonzepten der Telefon- und Notfallseelsorge.
3. BEWERTUNG DES PROJEKTERTRAGS
Die hier vorgenommene Projektbewertung findet genau zum Ende des dreijährigen Projekts (1. Mai 2013 – 30. April 2016) statt. Nach einer Vorbereitungsphase mit intensiven Hospitationen der ZAP-Mitarbeiterin an relevanten Orten umfasst die Durchführungsphase vor allem die Erarbeitung, Durchführung und Evaluation von zwei Jahresprogrammen „Verantwortung teilen“ (2. Halbjahr 2014/1. Halbjahr 2015 und 2. Halbjahr 2015/1. Halbjahr 2016). Zunächst einige quantitative Daten: Mit den verschiedenen Kursen der beiden Programme werden in zwei Jahren 149 TeilnehmerInnen erreicht. Diese absolvieren insgesamt 394 Teilnehmertage. Von den TeilnehmerInnen sind 98 freiwillig Engagierte und 51 hauptberuflich Tätige. Es ergibt sich also ziemlich genau ein Verhältnis von 2/3 Ehrenamtlichen zu 1/3 Hauptberuflichen. Fragt man, wie weit das Programm die 71 pastoralen Räume im Bistum Aachen erreicht hat, so lässt sich feststellen, dass insgesamt 15 Gemeinschaften der Gemeinden in Kurse involviert waren, sei es mit ihrem GdG-Rats-Vorstand oder einem „Team besonderer Leitung“ oder auch einem sogenannten „Tandem“ aus je einem hauptberuflich und ehrenamtlich Engagierten. Somit werden 21% der pastoralen Räume durch das Programm erreicht.
Aus der Sicht des Bistums Aachen stellt sich diese quantitative Quote als Erfolg dar. In diese Bewertung fließt ein, dass es in jedem dieser Fälle um gemeinschaftliches Lernen von freiwillig Engagierten und hauptberuflich Tätigen geht, d. h. alle Wege, verpflichtende Teilnahmen zu inszenieren, sind verbaut. Alle Teilnahmen sind Ergebnis von Dialog- und Aushandlungsprozessen vor Ort, in denen sich die Akteure darauf einigen, das Wagnis eines solchen gemeinsamen Lernweges einzugehen. Es ist also bei dieser Art des Lernens keine „hierarchische Steuerung“ denkbar, sondern es kann immer nur um „Kontextsteuerung“ gehen. Damit wird deutlich, dass dort, wo in einem pastoralen Raum die Kommunikation schlecht und die maßgeblichen Akteure entweder miteinander zerstritten oder kaum in Kontakt sind, kein Boden dafür bereitet ist, sich auf eine solche Weiterbildungseinladung einzulassen. Es wird eine Herausforderung für das Bistum Aachen sein, genauer zu evaluieren, welche Bedingungen förderlich sind für die Entscheidung zur Teilnahme, um von da aus zu fragen, wie man an mehr Orten solche Bedingungen schaffen kann.
Mit Blick auf die strategischen Zielsetzungen lässt sich festhalten: Die gewünschte Signalwirkung hat sich eingestellt. Das Label „Verantwortung teilen“ ist im Bistum bekannt, relevante Gremien auf Diözesan- und Regionalebene wie Priesterräte, Pastoralräte, Katholikenräte sind mit dem Programm vertraut. Es ist aus den Evaluationen der TeilnehmerInnen deutlich ersichtlich, dass das Ziel, nicht nur über Partizipation zu reden, sondern im Lernprozess selber Partizipation zu leben, erreicht worden ist. Alle Teilnehmenden, insbesondere aber die aus dem Kreis der freiwillig Engagierten, äußern sich sehr positiv darüber, dass und wie alle Ressourcen und Talente in ihrer Perspektivenvielfalt geschätzt und nicht etwa als Problem betrachtet werden. Im Vollzug ereignet sich so, was von der Anlage her behauptet wird. Die Lernmethoden haben es vermocht, den Sprung von theologischer Theorie in die pastorale Praxis zu schaffen. Eine theologische Zentralchiffre wie das „gemeinsame Priestertum der Gläubigen“ wird so im Fortbildungsvollzug erlebbar, dass es die Teilnehmenden inspiriert, in ihren jeweiligen Arbeitskontexten vergleichbar zu agieren. Die Passgenauigkeit von Inhalten und Methoden der angebotenen Kurse wird wesentlich durch die Mitwirkung des „Zentrums für angewandte Pastoralforschung“ abgesichert. Dies geschieht in der Anfangsphase des Projekts u. a. durch ausführliche Hospitationen sowie Interviews der ZAP-Mitarbeiterin mit relevanten Akteuren im Feld. Es folgt eine qualifizierte quantitative empirische Erhebung bei 21 freiwillig Engagierten in Pfarreien des Bistums, die nach besonderen Leitungsformen geführt werden. Die freiwillig in den Leitungsteams von vier Pfarreien, die nach c. 517 § 2 CIC/1983 geleitet werden, sowie drei weiteren Pfarreien, die nach dem Aachener Konzept der „Gemeindeleitung in Gemeinschaft“ geleitet werden, können u. a. zu erlebten Stärken und Schwächen im ehrenamtlichen Engagement und zu Weiterbildungswünschen antworten.27 Die Ergebnisse ermöglichen es, für diese sieben Leitungsteams passgenaue Fortbildungsbausteine zu entwickeln und in Kursen zu erproben.
Es kann nach drei Jahren konstatiert werden, dass der gesamte Bildungsansatz, um ein Wort von Karl Rahner aufzugreifen, so etwas wie der „Anfang eines Anfangs“ ist. Die Frage der Vertiefung stellt sich ebenso wie die der Nachhaltigkeit. Damit wird das Augenmerk der Bewertung auf das zweite strategische Hauptziel gelenkt, nämlich das gemeinschaftliche Lernen von hauptberuflich in der Pastoral Tätigen, insbesondere aus den vier Seelsorgeberufen, und den in verschiedenen Funktionen freiwillig Engagierten. Insgesamt kann aus den Rückmeldungen geschlossen werden, dass der eingeschlagene Weg sich bewährt hat. Bei genauerer Betrachtung lassen sich Differenzierungen feststellen. Für die sogenannten „Teams besonderer Leitung“ ist die Frage gemeinschaftlichen Lernens schon vorher gelebte Praxis. Sie wird über das Programm „Verantwortung teilen“ vertieft und qualifiziert. Die Tatsache, dass eine qualitativ hochwertige Pastoral heute nur in der Verschränkung professioneller und freiwilliger Perspektive erzielbar ist, steht für diese Gruppen außer Frage. Anders stellt sich das Bild bei den im Kursgeschehen involvierten Vorständen der Synodalgremien auf Ebene der pastoralen Räume dar. Auch hier sind in der Evaluation einhellig die Stimmen sehr angetan vom gemeinsamen Lernweg. Dieser kommt jedoch nicht in allen Fällen komplett zustande, d. h. in Einzelfällen ist es nur teilweise möglich, die hauptberuflich im Vorstand vertretenen Priester, Gemeinde- sowie Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten zur Teilnahme zu bewegen. Als Grund wird meistens die Arbeitsbelastung vor allem am Wochenende genannt. Die Kurse können jedoch wegen der beteiligten Ehrenamtlichen nur am Wochenende stattfinden. Aber es liegen auch Beobachtungen vor, die darauf hindeuten, dass es für die hauptberuflich Tätigen noch nicht selbstverständlich ist, in dieser Verbindlichkeit sich einem gemischten Lernsetting auszusetzen und im konkreten Lernen den viel beschworenen Umgang „auf Augenhöhe“ zu praktizieren.
Es wird spannend zu beobachten sein, wie sich diese Lernkonstellation weiter entwickelt. Sie führt an den neuralgischen Punkt von eingeübten Mustern getrennten Lernens sowie all den Phänomenen einer auch im Seelsorgedienst hoch professionalisierten Kirche, die mit der Versuchung zu kämpfen hat, dass die Professionellen wegen ihrer fachlichen Expertise und ihres Informationsvorsprungs nicht nur zu wissen glauben, wo es lang gehen soll, sondern den Weg auch gerne mal beschreiten, ohne lange zu fragen. Stellt man auf der anderen Seite die steigenden zeitlichen Beanspruchungen vieler freiwillig Engagierter in Rechnung, so tut sich eine Spannung auf, die der je situativen Aushandlung von Partizipationsgraden und -bereichen bedarf. In Fortführung des Gedankens von Rainer Bucher kann man hier von einer wechselseitigen Abhängigkeit der Professionellen und der Freiwilligen sprechen.
In der Summe kann das Projekt sowohl aus der Perspektive des Bistums Aachen als Projektträger als auch der Teilnehmenden als ebenso notwendige wie erfreuliche Stärkung auf dem Weg hin zu einer Pastoral des Volkes Gottes bezeichnet werden. Die positive Resonanz gibt Schwung. Die konstruktiv-kritischen Hinweise auf dem dreijährigen Weg lenken die Aufmerksamkeit auf Entwicklungspotenziale. Die dezidierte Beteiligung der wissenschaftlichen Theologie in Gestalt des „Zentrums für angewandte Pastoralforschung“ hat sich für die Praxis ausgezahlt. Als Kunde des ZAP hat das Bistum Aachen von dessen Theorieinput ebenso wie von seiner Praxisreflexion profitiert. Das Team der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Zentrums war ein wichtiger externer Resonanzraum für das Aachener Projekt. Seine Fremdwahrnehmung hatte eine korrektive und inspirative Funktion. So vollzog sich im Projektverlauf das, was wissenschaftstheoretisch vom ZAP als Basisverständnis seines Vorgehens grundgelegt ist, nämlich „Pastoraltheologie explizit als angewandte Wissenschaft zu betreiben“28. Dies spezifiziert Matthias Sellmann, der Direktor des Zentrums, wie folgt:
„Die Arbeit am ZAP hat zum Ziel, (a) explizite vertraglich festgelegte und wechselseitig finanzierte Kooperationsprojekte mit kirchlichen Entscheidern zu realisieren, die (b) zu bestimmten Beratungen, Innovationen und Interventionen im kirchlichen ‚Betrieb’ führen und die (c) generell auf einer Verbesserung und Optimierung kirchlicher Organisation abzielen.“29
Das Wissenschaftskonzept des ZAP setzt sich offensiv mit den Strömungen in der praktischen Theologie auseinander, die im direkten Praxiskontakt – insbesondere mit Aggregaten des Katholischen in Gestalt von Diözesen – die Gefahr des Rückfalls in eine „Ancilla-Mentalität“ sehen und um die kritische Potenz der Volk-Gottes-Ekklesiologie gegenüber kirchlichen Institutionen fürchten. Gestützt auf den amerikanischen Pragmatismus, maßgeblich in Gestalt von Charles S. Peirce, plädiert Sellmann demgegenüber für problemlösende Interaktionen zwischen Theoretikern und Praktikern, zwischen Wissenschaft und kirchlicher (Macht-)Realität. Summarisch hält er fest:
„Der Gegenstand einer angewandten Pastoraltheologie Bochumer Prägung ist die wissenschaftlich reflektierte und initiativ getestete Frage nach den durchsetzungsstärksten Bedingungen der Möglichkeit, Christentum kulturell und strukturell antreffbar machen zu können; ihr Materialobjekt ist die ‚erfolgreiche’ Organisation des Christseins durch kirchliche Vollzüge.“30
Der Autor dieses Beitrags muss sich natürlich in seiner Rolle als Kunde des ZAP zunächst einmal für befangen erklären. Als in einer pastoralentwicklerischen Funktion einer Diözese tätiger Pastoraltheologe kann er jedoch seine Sympathien für diesen wissenschaftstheoretischen Ansatz nicht verhehlen. Auch wenn er es so wahrnimmt, dass die „wissenschaftliche Reflexion durch die vitale intensive und berührungsangstfreie Kooperation mit entscheidungsmächtigen Akteuren ihre Unabhängigkeit“31 im besprochenen Projekt nicht verloren hat, möchte er das endgültige Urteil darüber doch Außenstehenden überlassen.
4. HERAUSFORDERUNGEN
Nach drei Jahren Projektstatus geht es nun um die Überführung von „Verantwortung teilen“ in die ausschließliche diözesane Zuständigkeit. Insofern gibt es eine Fülle konkreter Herausforderungen: die Gestaltung eines attraktiven bedarfsorientierten dritten Bildungsprogramms; die Intensivierung des „Kundenkontakts“, d. h. das Werben für ein Sich-Einlassen auf die Projektangebote in den pastoralen Räumen und bei relevanten Akteuren sowohl aus dem freiwilligen Engagement als auch dem beruflichen Feld; die weitere Sicherung der finanziellen Mittel zur Durchführung der Maßnahmen und vieles mehr.
Entscheidend wird jedoch sein, ob es gelingt, der Vision einer entschieden synodalen Kirche zum Durchbruch zu verhelfen; ob es gelingt, verschiedene Habitus miteinander in einen wechselseitig kritischen Dialog zu bringen; ob es gelingt, Kirche neu auszubalancieren, ohne dass sich einige nur als Verlierer fühlen. In seiner Ansprache zum 50jährigen Jubiläum der Bischofssynode im Herbst 2015 führte Papst Franziskus programmatisch zur Synodalität aus, es gebe einen Glaubenssinn der Gläubigen, der „verhindert streng, zwischen Ekklesia docens und Ekklesia discens zu unterscheiden, zumal auch die Herde über eine eigene ‚Witterung‘ verfügt, um die neuen Wege zu unterscheiden, die der Herr der Kirche auftut“32. Der Papst bezeichnet den Weg der Synodalität als den, der von der Kirche dieses 3. Jahrtausends verlangt wird und er betont:
„Wenn wir verstehen, dass, wie der heilige Johannes Chrysostomos sagt, ‚Kirche und Synode Synonyme sind‘ (Explicatio in Ps 149, PG 55, 493) – weil die Kirche nichts anderes ist als das ‚gemeinsame Gehen‘ der Herde Gottes auf den Wegen der Geschichte Christus dem Herrn entgegen – dann verstehen wir auch, dass in ihrem Inneren niemand über die anderen ‚erhoben‘ sein kann.“33
Es ist nicht sehr gewagt, die Synodalität zum Testfall der Zukunftsfähigkeit der Katholischen Kirche in unseren Breiten zu erklären. Auch die Trierer Diözesansynode scheint das so zu sehen, wenn sie als einen von vier fundamentalen „Perspektivwechseln“ in ihrem Abschlussdokument formuliert: „Das synodale Prinzip bistumsweit leben.“34 Dazu müssen sich Viele an vielen Orten bewegen. Auf das Projekt bezogen heißt die Herausforderung, die Hermeneutiken und Praxen derer, die primär vom freiwilligen Engagement her denken und agieren und derer, die zunächst eine Verantwortung für das pastorale Personal haben, noch intensiver miteinander zu verschränken. In der Folge wären die Felder gemeinschaftlichen Lernens weiter auszuloten.
Die ganze Herausforderung wird für das Bistum Aachen nur zu bewältigen sein, wenn sie auch mit ihrer spirituellen Sprengkraft zugelassen wird. Auch für das Wegstück „Verantwortung teilen“ gilt, was zu Beginn des bis heute andauernden „Prozesses Weggemeinschaft“ der damalige Bischof Klaus Hemmerle sich und allen mit auf den Weg gegeben hat:
„Die Methode des Prozesses Weggemeinschaft ist bestimmt vom anderen Stil des Evangeliums. Nicht nur das Was, sondern auch das Wie dieses Prozesses nimmt Maß am Evangelium. Bloßes ‚Durchdrücken’ der eigenen Vorstellungen und Meinungen widerspräche diesem Ansatz. Die Torheit und Ohnmacht des Kreuzes, das ‚ Sein wie die Kinder‘ sind entscheidend für die Alternative des Evangeliums, um die es uns geht.“35
1 Vgl. HEMMERLE, Klaus: Fastenhirtenbrief 1989, in: Kirchlicher Anzeiger für die Diözese Aachen 59 (1/ 1989), S. 1-3.
2 Vgl. HILBERATH, Bernd Jochen (Hg.): Communio – Ideal oder Zerrbild von Kommunikation, Freiburg/Br. 1999. Vgl. auch FUCHS, Ottmar: Kirche, in: Herbert HASLINGER u. a. (Hg.): Handbuch Praktische Theologie, Bd. 1 Grundlegungen, Mainz 1999, S. 363-375.
3 Vgl. NITSCHE, Bernhard: Die Analogie zwischen dem trinitarischen Gottesbild und der communialen Struktur von Kirche, in: HILBERATH (Hg.), Communio, S. 81-114.
4 HEMMERLE, Klaus: Communio als Denk- und Lebensweise, in: Günther BIEMER u. a. (Hg.): Gemeinsam Kirche sein. Theorie und Praxis der Communio [FS für Erzbischof Dr. O. Saier], Freiburg/Br. 1992, S. 77-89, hier S. 88.
5 Ebd.
6 Ebd. S. 87.
7 HILBERATH, Bernd-Jochen: Kontinuität oder Bruch? Für eine angemessene Hermeneutik des Zweiten Vatikanischen Konzils, in: Herder Korrespondenz spezial (2012/ 2), S. 5-9, hier S. 7.
8 Vgl. POTT Martin: „Liquid church“ – und Partizipation in Kirche und Gemeinde, in: PThI 34 (2/ 2014), S. 57-68.
9 Vgl. BISTUM AACHEN (Hg.): Berufen zur Verantwortung. Richtlinien zu besonderen Leitungsformen in Pfarreien und Gemeinden des Bistums Aachen, Juni 2014. Abrufbar unter: www.pastoral-entwickeln.de, Stichwort „Leiten“.
10 Vgl. BISTUM AACHEN (Hg.): Leitlinien der Pastoral in den Gemeinschaften der Gemeinde des Bistums Aachen, 2011. Abrufbar unter: www.pastoralentwickeln.de [Zugriff: 26.4.2016].
11 Vgl. BISTUM AACHEN (Hg.): Satzung für den Rat der Gemeinschaft der Gemeinden (GdG-Rat), 2013. Abrufbar unter: http://gemeindearbeit.kibac.de/medien/bb1be98f-a608-45c7-8f10-861d4f65bfd4/1.broschuere-satzung.web.pdf [Zugriff: 26.4.2016].
12 Vgl. BAUER, Christian: Gott außerhalb der Pfarrgemeinde entdecken, in: Matthias SELLMANN (Hg.): Gemeinde ohne Zukunft? Theologische Debatte und praktische Modelle, Freiburg/Br. 2013, S. 349-371, hier S. 352; KATHOLISCHE ARBEITSSTELLE FÜR MISSIONARISCHE PASTORAL (Hg.): Nähe und Weite statt Enge und Ferne. Zu den Chancen großer pastoraler Räume für eine missionarische Pastoral, Erfurt 2015.
13 MUSSINGHOFF, Heinrich: Kirche in der Welt von heute werden – Kirche am Ort sein. Vortrag bei drei Treffen mit den Priestern, Diakonen, Pastoralreferenten/-innen und Gemeindereferenten/-innen, März – Mai 2011, S. 12. S. 14-15. Abrufbar unter: http://pastoralentwicklung.kibac.de/aktuelles/ [Zugriff: 26.4.2016].
14 MUSSINGHOFF, Heinrich: Kirche in der Welt von heute werden – Kirche am Ort sein. Vortrag bei drei regionalen Pfarrgemeinderatstagen, Februar-März 2012, S. 5. Abrufbar unter: http://pastoral-entwicklung.kibac.de/aktuelles/ [Zugriff: 26.4.2016]. Vgl. ausführlicher: POTT Martin: „10% für Neues“ – oder: Wie ein bischöflicher Impuls zum geflügelten Wort wird, in: Pastoralblatt für die Diözesen Aachen, Berlin, Essen, Hildesheim, Köln und Osnabrück 67 (2015), S. 264-267.
15 MUSSINGHOFF, Vortrag bei drei Treffen mit den Priestern, S. 14.
16 HENNECKE, Christian: Kirche umgekehrt denken. Zur Relevanz kirchlicher Basisgemeinschaften, in: Anzeiger für die Seelsorge (11/ 2012), S. 11-14, hier S. 14.
17 Vgl. im Folgenden BREMER, Helmut: Soziale Milieus, Habitus und Lernen, Weinheim u. a. 2007, S. 118-148.
18 Ebd. S. 128.
19 Ebd. S. 130.
20 BOURDIEU, Pierre: Rede und Antwort, Frankfurt/M. 1992, S. 225.
21 SEKRETARIAT DER DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ (Hg.): Instruktion zu einigen Fragen über die Mitarbeit der Laien am Dienst der Priester (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 129), Bonn 1997.
22 Vgl. SCHREIBEN VON PAPST BENEDIKT XVI. zum Beginn des Priesterjahres anlässlich des 150. Jahrestages des „Dies natalis“ von Johannes Maria Vianney. Abrufbar unter: http://w2.vati-can.va/content/benedict-xvi/de/letters/2009/documents/hf_ben-xvi_let_20090616_anno-sacerdo-tale.html [Zugriff: 26.4.2016].
23 Vgl. KRÖGER, Elisa: Herausforderung „Partizipation“. Projektdokumentation aus Forschungsperspektive, S. 29ff.
24 Vgl. BUCHER, Rainer: … wenn nichts bleibt, wie es war. Zur prekären Zukunft der katholischen Kirche, Würzburg 2012, S. 113-135.
25 Vgl. ebd. S. 115. S. 119.
26 Ebd. S. 128.
27 Vgl. BISTUM AACHEN (Hg.), Berufen zur Verantwortung. Vgl. KRÖGER, Elisa: (Weiter-)Bil-dungsbedarfe aus der Perspektive freiwillig Engagierter in Leitungsteams in der Diözese Aachen – eine empirische Untersuchung, in diesem Band S. 125-168.
28 SELLMANN Matthias: Pastoraltheologie als „Angewandte Pastoralforschung“. Thesen zur Wissenschaftstheorie der Praktischen Theologie, in: PThI 35 (2/ 2015), S. 105-116, hier S. 105.
29 Ebd. S. 106.
30 Ebd. S. 115.
31 Ebd. S. 116.
32 PAPST FRANZISKUS: Ansprache. 50-Jahr-Feier der Errichtung der Bischofssynode, 17. Oktober 2015. Abrufbar unter: http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html [Zugriff: 26.4.2016]. Vgl. ausführlicher zum „sensus fidelium“: BEINERT, Wolfgang: Der Glaubenssinn der Gläubigen in Theologie und Dogmengeschichte. Ein Überblick, in: Dietrich WIEDERKEHR (Hg.): Der Glaubenssinn des Gottesvolkes – Konkurrenz oder Partner des Lehramts?, Freiburg/br. 1994, S. 66-131. Aktuell vgl. Hirschberg 68 (2015/ 2) Themenheft „Für eine Synode!“.
33 PAPST FRANZISKUS, Ansprache.
34 Heraus gerufen. Schritte in die Zukunft wagen. Synode im Bistum Trier. 30. April 2016, S. 10-11. Abrufbar unter: http://www.bistum-trier.de/fileadmin/user_upload/docs/SYNODE-IM-BISTUM-TRIER.pdf [Zugriff: 2.5.2016].
35 HEMMERLE, Klaus: Zehn Punkte eines für die Zukunft des Prozesses „Weggemeinschaft“ im Bistum Aachen erforderlichen und tragenden Konsenses, in: BISCHÖFLICHES GENERALVIKARIAT AACHEN (Hg.): Der Prozess Weggemeinschaft im Bistum Aachen 1988-1994, Aachen 31995, S. 27-29, hier S. 28.