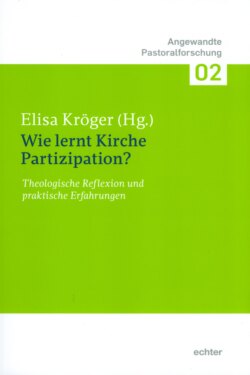Читать книгу Wie lernt Kirche Partizipation - Группа авторов - Страница 9
ОглавлениеElisa Kröger
Herausforderung „Partizipation“
Das Projekt „Verantwortung teilen“ aus Forschungsperspektive
1. EINFÜHRUNG
Pfarreien sind Orte, in denen sich derzeit die aktuellen Herausforderungen der Pastoral wie unter einem Brennglas beobachten lassen. Einer ihrer zentralen Kristallisationspunkte sind die synodalen Räte, pastoralen Gremien und Leitungsteams. Denn ihre Aufgabe ist es, mit einer Kurzformel von Bernhard Spielberg gesagt, „die Verantwortung dafür [zu tragen], dass die Kirche vor Ort am Leben bleibt“1 oder pointierter, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes „am Leben dran“2 bleibt. Diese Aufgabe, die nicht selten hinter dominanten Strukturprozessen der Bistümer zurücksteht, ist umso heraus-fordernder, als besonders die Pfarreien an der diagnostizierten „Milieuverengung“ leiden.3 Michael N. Ebertz stellt fest, dass sich immer mehr, vor allem jüngere Menschen, in zunehmender „Distanz, ja in absoluter Beziehungslosigkeit zum kirchlichen Leben […]“4 befinden. Ob Pfarreien also Orte sind – oder zu solchen werden –, die am Leben von – auch jüngeren – Menschen „dran“ bleiben, steht vielerorts gerade infrage und hängt nicht nur von Strukturprozessen ab, sondern vor allem davon, ob, mit Rainer Bucher gesprochen, die „Außenperspektive als mögliche Innovationsperspektive“5 ernst- und wahrgenommen wird. Erforderlich dazu ist eine Umkehr, auch und gerade im Hinblick auf die aktuell vielseitig gestellte Frage nach einer verstärkten „Partizipation“ durch freiwillig Engagierte6: So etwa die Umkehr von einer in der Logik der Aufgabenorientierung verhafteten Vorstellung von Partizipation, die vorwiegend auf bestehende Strukturen beschränkt bleibt und sich beinahe ausschließlich danach ausrichtet, die gewohnten Aufgaben der Pfarrei, die bisher vorwiegend die Pfarrer und die Hauptamtlichen erfüllt haben, nun als Erbe an freiwillig Engagierte abzugeben, damit es weitergehen kann wie bisher, hin zu einem Verständnis von Partizipation, in dessen Zentrum das Subjektsein und die Freiheit von Christinnen und Christen stehen, die am Leben von Menschen „dran bleiben“, also daran teilhaben. Dazu ist allerdings erforderlich, auf die Plätze hinauszugehen, an denen sich das Leben mit seinen unterschiedlichen Situationen zwischen „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst“ (GS 1) abspielt. Damit solche Umkehrprozesse gelingen, braucht es gemeinsame Erfahrungs- und Lernräume – auch und gerade an Orten, an denen die Beharrungskräfte und Überforderungsgefühle besonders groß sind, und das heißt nicht nur, aber auch in Pfarreien, ihren Gremien, Räten und Leitungsteams. Worauf es in Zukunft ankommen wird, ist die Eröffnung von solchen Laboratorien, in denen Neues ausprobiert wird, wovon auch die Forschung der Praktischen Theologie etwas lernen kann. Zu den Rahmenbedingungen solcher innovationsförderlichen Laboratorien gehören insbesondere Selbstorganisation, Freiheit, Experimentierfreudigkeit, eine zuträgliche Fehler- und Wertschätzungskultur sowie Teamarbeit.7
Erste Versuche in diese Richtung wurden im Rahmen des Projekts „Verantwortung teilen“ unternommen, das in Kooperation zwischen dem „Zentrum für angewandte Pastoralforschung“ (kurz: ZAP) der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum und dem Bistum Aachen initiiert wurde. Das Projekt widmet sich einem neuralgischen Punkt gegenwärtiger Pastoral, nämlich der Frage nach der Partizipation durch freiwillig Engagierte in Gremien, Räten und Leitungsteams (sowie darüber hinaus), und zwar inmitten der pastoralen Herausforderungen, die sich gegenwärtig stellen. Damit bewegt sich das Projekt von Anfang an in einem Spannungsfeld zwischen vorgegebenen Strukturen einerseits und den Fragen innovativer Kirchenentwicklung andererseits. Die entscheidende Stellschraube inmitten dieses Spannungsfeldes wird über die Organisation von Bildungsprozessen gedreht. Als Lernende werden in diesem Zusammenhang jedoch keineswegs nur diejenigen verstanden, die im Bistum Aachen derzeit – in Gremien, Räten, Leitungsteams und darüber hinaus – freiwillig Verantwortung tragen, sondern ebenso diejenigen, die hauptamtlich tätig sind, bis hin zu denjenigen, die das Projekt initiiert haben.
Im Folgenden wird das Projekt aus der Forschungsperspektive der das Projekt primär begleitenden wissenschaftlichen Mitarbeiterin des Zentrums für angewandte Pastoralforschung dokumentiert. Dazu werden im Anschluss an die Einführung die (2.) Kontexte sowie die (3.) Anlage des Projekts dargestellt. Von einer „partizipativen“ Kirchenentwicklung kann unterdessen nicht die Rede sein, ohne das Wort „Partizipation“ selbst näher zu beleuchten. Dies soll im nächsten (4.) Kapitel in begrifflicher, systemtheoretischer und theologischer Hinsicht erfolgen. Mit den beiden Aspekten „Team-“ und „Ermöglichungskultur“ werden dann (5.) die wesentlichen inhaltlichen Leitlinien des Projekts ausgeführt. Danach wird (6.) ein Einblick in das Bildungscurriculum gegeben und (7.) die wesentlichen Erkenntnisse aus dem Projektverlauf dargestellt. Schließlich gilt es, (8.) die relevanten Perspektiven sowie die bleibenden Herausforderungen zu beschreiben, die aus dem Projektverlauf resultieren. Worauf es in Zukunft in Sachen „Partizipation“ ankommen könnte, wird in einem Schlusswort (9.) kurz aufgegriffen.
2. KONTEXTE
2.1 ENTSTEHUNG NEUER STRUKTUREN
Im Jahr 2013 werden im Bistum Aachen die erstmalig gewählten Räte der insgesamt 71 Gemeinschaften der Gemeinden (kurz: GdG-Räte) als neues Synodalgremium auf der Ebene der pastoralen Räume eingeführt. Dieses Gremium wird mit hoher pastoraler Kompetenz ausgestattet: Gemäß § 3 der Satzung für den Rat der Gemeinschaft der Gemeinden ist der GdG-Rat das „Planungs- und Entscheidungsorgan in allen grundlegenden Fragen der Pastoral, unbeschadet der Rechte der in den Pfarreien der Gemeinschaft der Gemeinden kanonisch ernannten Pfarrer“8. Gemeinsam mit dem Pastoralteam „bündelt und fördert“ der GdG-Rat „die Verantwortung für das pastorale Handeln in der Gemeinschaft der Gemeinden“ und zwar „im Dienst am ‚Leben in Fülle‘ (Joh 10,10) aller Menschen im pastoralen Raum“9. Der GdG-Rat wird zum Leitungsorgan in der Pastoral: Er „hat teil an der Leitung der Gemeinschaft der Gemeinden“10. Jeder GdG-Rat bildet einen Vorstand, in dem freiwillig Engagierte und hauptamtlich Tätige gemeinsam die Leitung der GdG wahrnehmen.11 Neben dem GdG-Rat können auch Pfarreiräte und/oder Gemeinderäte in der GdG eingerichtet werden.
Im Zuge dieses Strukturwandels werden insbesondere drei Herausforderungen deutlich: Erstens braucht die Erprobung der neuen, verbindlichen kooperativen Leitungsstruktur auf der Ebene des pastoralen Raumes (GdG) Unterstützung in Form von Begleitung, Bildung und kritischer Evaluation. Zweitens geht es mehr als um die Frage nach einer kooperativen Leitungsstruktur um die Frage nach ihrer Kultur: Wie kommen wir von der erlernten Versorgungs-Mentalität zur Selbstorganisation von Christinnen und Christen vor Ort? Wie fördern wir einen partizipativen Leitungsstil und eine wirksame Kultur der Teamarbeit? Wie kommen wir von den heillosen Dynamiken von Misstrauen und Kontrolle zu einer Kultur der Ehrlichkeit und des Vertrauens? Wie verwalten wir nicht nur das Gewohnte, sondern gründen auch Neues? Da Strukturveränderungen häufig eine tendenzielle Selbstreferentialität und Bewahrungskraft innerhalb von Organisationen erzeugen, gilt es drittens dazu zu ermutigen, im Denken und im Handeln immer wieder „herauszugehen“ und eine neue Haltung der Aufmerksamkeit einzuüben, die sensibel ist für die Lebensthemen der Menschen von heute. Sicherlich hat die Vergewisserung über Satzungsaussagen wie über Fragen von der Festlegung der Gottesdienstordnung bis hin zur Organisation der Gebäudenutzung in der GdG ihre Berechtigung. Wahr ist aber auch: Wer bei binnenkirchlichen Fragen stehen bleibt, der setzt die oben angedeutete Milieuverengung weiter fort. Die eigentliche Herausforderung besteht – mit Ottmar Fuchs gesprochen – darin, einen „Ortswechsel“ zu vollziehen, „der von den Erfahrungen der anderen her das eigene Verhalten und Nachdenken prägt. Denn es geht um das Hinschauen, es geht um eine bestimmte Reaktion auf das Gesehene, nämlich darum, dass alles Menschliche ‚im Herzen (der Gläubigen) seinen Widerhall‘ findet (GS 1).“12 Daraus folgt für alle Christinnen und Christen, buchstäblich heraus-gefordert zu sein. Es geht darum, sich selbst auszusetzen, sich verletzbar zu machen, hinzuhören, aufmerksam, sensibel und resonanzfähig zu werden für die „Zeichen der Zeit“ (GS 4).13 Erforderlich dazu ist ein Perspektivenwechsel vom Eigenen zum Anderen einerseits und die Entschiedenheit, Veränderungen nicht nur als wünschenswert und notwendig zu befürworten, sondern auch bei sich selbst zuzulassen, andererseits. Eine solche Umkehr braucht Zeit und ist mit vielfältigen, nicht zuletzt auch schmerzvollen Prozessen des Verlernens, Umlernens und Neulernens verbunden.
2.2 ALTERNATIVE LEITUNGSFORMEN IM BISTUM AACHEN
Der Anlass des Projekts „Verantwortung teilen“ ist mit der Neustrukturierung der pastoralen Räume sowie der Einsetzung der GdG-Räte und ihren Vorständen gegeben. Die Lektüre der Satzungsaussagen lässt unschwer die Herausforderung erkennen, die dem Projekt mit diesem Entstehungskontext von Anfang an gestellt ist: Es gilt, die mit den Satzungsaussagen intendierte Kraft der Synodalität inmitten einer nun zwar größeren und durchaus Freiraum schaffenden, aber dennoch überkomplex gewordenen (Verwaltungs-)Struktur mit den sie tragenden Rollen, Sprach-, und Handlungsmustern freizulegen. Die Aufgabe besteht darin, über den Anlass („Priestermangel“) hinaus, den tieferen Grund von Partizipation zu entdecken und zur Entfaltung zu bringen.
Darüber hinaus lässt sich ein zweiter Entstehungskontext, in den sich das Projekt einbettet, beschreiben: Im Bistum Aachen nehmen freiwillig Engagierte in den seit 1993 im (Not-)Fall des Priestermangels eingerichteten Leitungsteams nach c. 517 § 2 CIC/1983 gemeinschaftlich die Leitung einer Pfarrei wahr. Diese Form wird derzeit in vier Pfarreien umgesetzt. Daneben wird im Bistum Aachen seit 1998 das Modell „Gemeindeleitung in Gemeinschaft“ praktiziert, in dem freiwillig Engagierte, anders als nach c. 517 § 2 CIC/1983, auch im Fall, dass kein Priestermangel vorherrscht, also die Pfarrei nicht vakant ist, gemeinschaftlich die Leitung einer Pfarrei wahrnehmen.14 Diese Form wird aktuell in drei Pfarreien praktiziert. Insgesamt blickt das Bistum Aachen hinsichtlich beider Formen mittlerweile auf eine ungefähr zwanzigjährige Praxis zurück. Dementsprechend besitzen die freiwillig Engagierten in diesen Leitungsteams einen hohen Erfahrungsschatz, der sich aus der Erprobung einer neuen Form von Leitungsverantwortung speist, und zwar mitsamt der Grenzen, Chancen und Herausforderungen, die sich in der praktischen Umsetzung etwa in Bezug auf unterschiedliche Rollen und Zuständigkeiten ergeben. Das Projekt kann nur dann glaubwürdig sein, wenn es nicht nur Partizipation fördert, sondern selbst partizipativ ist. Daher werden die unterschiedlichen Erfahrungen von freiwillig Engagierten und hauptamtlich Tätigen in Leitungsteam zunächst angehört. Darüber hinaus wird eine empirische Studie durchgeführt, anhand derer speziell die freiwillig Engagagierten der bestehenden Leitungsteams im Bistum Aachen befragt werden und damit erneut zur Sprache kommen. Diese Studie erhält eine eigene ausführliche Darstellung in diesem Band.15
3. ANLAGE DES PROJEKTS
Die gegenwärtige Pastoral ist in Teilen der Weltkirche wie auch in deutschsprachigen Bistümern von einer allgemeinen Bewusstwerdung rund um die Taufwürde jeder/s Einzelnen und die Bedeutung des „gemeinsamen Priestertums aller Getauften“ (LG 10) geprägt. Im Rahmen des Projekts sollen Lern- und Erfahrungsräume eröffnet werden, in denen die Partizipation durch freiwillig Engagierte gefördert wird und zwar als Wachstum der Person, als Ausdruck ihrer Freiheit und Entfaltung ihrer individuellen Fähigkeiten. Darin liegt der Fokus. Eine Zielgruppe bilden die neu gewählten GdG-Rats-Vorstände. Eine andere Zielgruppe erwächst aus den beiden im Bistum Aachen praktizierten Leitungsformen, die nach c. 517 § 2 CIC/1983 sowie nach dem Modell „Gemeindeleitung in Gemeinschaft“ an der Leitung der Pfarrei partizipieren. Neben diesen eher „klassischen“ Formen wird die Perspektive auf jene Christinnen und Christen ausgeweitet, die auf der Suche sind und möglicherweise neue Ausdrucksformen des Glaubens und neue Initiativen in der Pastoral gründen wollen. Entscheidend ist, dass es um einen ganzheitlichen Prozess gehen soll, in dem die Gesamtheit der Gemeinschaft der Getauften ihre Verantwortung für die Sendung der Kirche – wann, wo und in welcher Gestalt auch immer – entdeckt. Es geht hingegen nicht darum, überkommene Strukturen einfach zu verlängern oder wiederzubeleben; der Anspruch des Projekts besteht vielmehr darin, das Innovationspotenzial für ein relevantes Christ- und Kirchesein vor Ort zu heben, das bereits in der Grundstruktur des freiwilligen Engagements angelegt ist. Rainer Bucher erklärt:
„Die Hauptamtlichen verkörpern nie das ganze Volk Gottes, das gilt auf pragmatischer wie auf grundsätzlicher Ebene. Pragmatisch gesehen gilt: Nicht-hauptamtliches Handeln besitzt gegenüber dem hauptamtlichen Handeln spezifische Nachteile (mangelnde Erfahrung, Ausbildung, Zeit), aber auch viele Vorteile: Es ist spontaner, seine Träger und Trägerinnen sind pluraler, sie sind institutionsunabhängiger, weil nicht über Alimentation und Recht steuerbar. Nicht-hauptamtliches Handeln in der Kirche kann also schon von seiner Grundstruktur her ein wichtiges Innovationspotential darstellen, wenn nicht genau dies, Innovationspotential zu sein, von den Hauptamtlichen verhindert wird.“16
Eine solche Perspektive verlangt hinsichtlich der einst selbstverständlich erlernten Habitus ‘ tiefgehende Veränderungsprozesse – nicht zuletzt in Bezug auf das erlernte Zueinander von Hauptamtlichen und freiwillig Engagierten.
In diesem Sinne beschreibt das größere Ziel des Projekts einen Kulturwandel des Kircheseins. Dazu braucht es – über das dreijährige Projekt hinaus – vor allem Zeit. Aus diesem Grund definiert sich das zeitnahe Projektziel zunächst und zuerst nur dadurch, in Bezug auf die Frage nach Partizipation durch freiwillig Engagierte eine Plattform des Lernens für den Erfahrungs- und Wissensaustausch im Bistum Aachen zu schaffen. Um im Ansatz nicht der Versuchung einer Top- down-Logik zu erliegen, wird immer wieder der ehrliche Dialog mit möglichst vielen freiwillig Engagierten und hauptamtlich Tätigen in den Gemeinschaften der Gemeinden, Gremien, Leitungsteams und kirchlichen Einrichtungen gesucht: Welche „Zeichen der Zeit“ (GS 4) zeigen sich uns? Welche Sehnsucht tragen wir in uns? Wo erleben wir die „kreative Konfrontation von Evangelium und heutiger Existenz“17 – und wo gerade nicht (mehr)? Worin liegen die sozialen, kulturellen und politischen Herausforderungen, denen wir uns als Christinnen und Christen zu stellen haben? Welche Chancen liegen im Teamsein? Wie verstehen und ergreifen wir Partizipation – und wie nicht? Um immer wieder ins Hören zu kommen und Erfahrungen auszutauschen, wird eine Begleitgruppe aus freiwillig Engagierten und hauptamtlich Tätigen des Bistums Aachens gegründet. Daneben werden in Kooperation mit dem Diözesanrat der Katholiken zwei kirchliche „Events“ im größeren Format mit Workshops zu unterschiedlichen Themen (wie etwa Berufung und Charisma, Partizipation, Gründung von Neuem u. v. m.) organisiert, zu denen alle Frauen und Männer des Bistums Aachen, die sich in GdG- Räten und ihren Vorständen, sowie in Pfarrei- und Gemeinderäten engagieren, eingeladen waren. Durch die Art und Weise der Durchführung, das heißt zum Beispiel die Auswahl der Orte, die Einladung von externen Impulsgebern, die kreative Gestaltung von Workshops, die musikalische Begleitung der gesamten Veranstaltung usw. sollte erleichtert werden, neue Perspektiven einzunehmen. In einem weiteren Arbeitsansatz des Projekts dienten unterschiedliche Instrumente der empirischen Sozialforschung dazu, möglichst viele Stimmen zu Gehör zu bringen und eine Kultur des Feedbacks einzuüben. Darüber hinaus setzt sich die wissenschaftliche Mitarbeiterin selbst immer wieder verschiedenen Orten im Bistum Aachen aus, um hinzuhören und dadurch andere zu Wort kommen zu lassen. Denn entscheidend ist, dass so viele Menschen wie möglich von Projektbeginn an (!) am Prozess einer sogenannten „partizipativen Kirchenentwicklung“ teilhaben, damit sie nicht zu bloßen Objekten, sondern im Gegenteil von Anfang an als partizipierende Subjekte und als wichtige ImpulsgeberInnen ernstgenommen werden.
3.1 VORGEHENSWEISE
Das 2013 gegründete ZAP versteht sich als Schnittstelle zwischen Praktischer Theologie und den Entscheidungssituationen der Pastoralplanung in den Bistümern. Die Praktische Theologin verlässt gewissermaßen ihren Schreibtisch und begibt sich in die unmittelbare Praxis hinein, sodass die Forschung in einem permanenten Wechselspiel zwischen Theorie und Praxis stattfindet. In diesem Sinne strukturiert folgender methodischer Dreischritt den Projektablauf: Am Anfang steht das „Z“ wie „Zuhören“. Die Praxis wird als Lernort verstanden. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin setzt sich verschiedenen Orten im Bistum Aachen aus und hört hin: Welche Fragen stellen sich? Welche Herausforderungen zeigen sich in der Stadt oder auf dem Land? Welche Grundhaltungen und Handlungsschwerpunkte prägen die Pastoral der GdG? Was gelingt wo, wie und warum (nicht)? Die aus dem Praxisfeld gewonnenen Fragen und Erkenntnisse werden dann mit den Feldern theologischer, pädagogischer und sozialwissenschaftlicher Diskurse korreliert: Das „A“ steht für „Austauschen“. Das Thema wird aus dem Praxisfeld gewonnen und daraufhin reflektiert. Im Spannungsfeld dieser zwei Pole sollen schließlich Instrumente des Wissenstransfers „produziert“ werden, wofür das „P“ steht.18 Im Bistum Aachen lautet der Projektauftrag, ein Bildungscurriculum zur Unterstützung für freiwillig Engagierte (und hauptamtlich Tätige) zu entwerfen, die in unterschiedlicher Weise gemeinsam Verantwortung wahrnehmen.
Im Rahmen des Projekts „Verantwortung teilen“ kann nach drei Jahren unterdessen retrospektiv gesagt werden: Die Kraft eines Projekts liegt vor allem im vorbehaltlosen (Hin-)Hören, das heißt in einer empfänglichen, absichtslosen und irritationssensiblen Grundhaltung des Lernens einerseits und in der Praxis von „Exposures“, wie auch empirischer Forschungen, durch die möglichst viele Stimmen zu Wort kommen können, andererseits. Hören ist unterdessen „mehr“ als ein methodisches Instrument. So gesehen hat das Hören nicht nur am Anfang zu stehen, sondern das gesamte Projekt als ständige Herausforderung der kritischen „Relecture“ zu durchzuziehen. Nicht nur, dass sich im Hören so etwas wie ein entscheidender Einsatzpunkt für das Prinzip der Synodalität verbirgt, sondern auch, dass es das „P“ – den anfänglichen Projektauftrag – in gewisser Weise übersteigt, wird noch aufzuzeigen sein.
3.2 INSPIRATIONSQUELLE UND KORREKTIV: WELTKIRCHLICHE ERFAHRUNGEN
Die persönlichen Exposure-Erfahrungen – etwa auf den Philippinen, in der österreichischen Diözese Linz oder in Chicago – werden zu Inspirationsquellen und insbesondere zu einem kritischen Korrektiv für die Entwicklungen im Projekt „Verantwortung teilen“. In der Begegnung mit unterschiedlichen Entwicklungen, wie sie derzeit in einigen Kontexten der Weltkirche erlebt und beobachtet werden können, wird immer wieder deutlich, dass Partizipation hier nicht einfach Gegenstand des Lernens, sondern Ursprung und Vollzug eines umfassenden Prozesses gemeinsamen Lernens „auf Augenhöhe“ ist. Besonders in den Workshops mit dem Team des Pastoralinstitutes Bukal Ng Tipan in Manila wird erfahrbar, wie das, worum es geht, Partizipation, auch in den methodischen und liturgischen Vollzügen verwirklicht wird. Anders gesagt: Die Vision einer partizipativen Kirchenentwicklung lässt sich – auch in Form von Bildung – nicht einfach „top down“ durchsetzen oder „antrainieren“. Im Gegenteil würde sie durch jede ungute Subjekt-Objekt-Konstellation bereits von Beginn an konterkariert und im Keim erstickt. Der Weg zu einer partizipativen Kirchenentwicklung ist vielmehr von Beginn an synodal (von griechisch Σύνοδος, synodos: die Versammlung, gemeinsamer Weg, Σύνοδία, synodia: die Reisekarawane): Menschen können ihn nur gemeinsam als Subjekte entdecken und gehen.19
Weltkirchliche Entwicklungen können nicht einfach eins zu eins kopiert werden. Es geht darum, sich selbst auf einen Weg des Lernens einzulassen. Auf das Projekt hin formuliert: Aachen ist Aachen und man darf gespannt sein, welche Entdeckungs- und Gründungsprozesse in Sachen partizipativer Kirchenentwicklung möglich werden, wenn Menschen von Anfang an als Subjekte partizipieren, so, wie viele es ja in ihrem alltäglichen Leben als Ausdruck ihrer Freiheit zumeist schon selbstverständlich tun.
3.3 THEOLOGISCHE LEITLINIE DES PROJEKTS
Theologische Leitlinie und geistliche Orientierung des Projekts ist das Sakrament der Taufe, das jeder und jedem Einzelnen Würde und Charismen verleiht, sowie neue Formen des Christseins vor Ort begründet. Wann und wo auch immer die fehlenden Ressourcen etwa von Priestern oder hauptamtlich Tätigen in einen Zusammenhang mit der Entwicklung einer partizipativen Kirche gestellt werden, ist Vorsicht geboten. Denn es kann weder nur um die Wiederholung eines „mehr Desselben“ in neuer Besetzung noch um die Bewahrung von kirchlichen Strukturen in größeren Räumen gehen. Das Thema Partizipation ist herauszulösen aus einem verengten Verständnis gemäß einer aufgrund des sogenannten „Priestermangels“ scheinbar notwendig gewordenen Aufgabenteilhabe freiwillig Engagierter. Partizipation muss als Ausgangspunkt und nicht nur als (zu vermittelnder) Gegenstand von pastoralen Prozessen ernstgenommen werden. Die Entwicklung einer partizipativen (Leitungs-)Kultur, in der Getaufte als Subjekte Verantwortung wahrnehmen, ist somit als zentrales Element eines gesamtpastoralen Bewusstseinsprozesses zu begreifen und nicht als Konsequenz von strukturellen Umbrüchen. Andernfalls wären Getaufte nichts anderes als LückenbüßerInnen; zudem käme es zur Instrumentalisierung und binnenkirchlichen Verengung von Partizipation überhaupt, wenn diese nicht in ihrem weiteren Horizont als für die Identität von Menschen und ihr Subjektsein, das heißt als grundsätzlich für ihr Leben bedeutsam anerkannt würde, selbst dann, wenn daraus keine unmittelbare Zuständigkeit oder Teilhabe an einem bestimmten Dienst im engeren, institutionellen Raum von Kirche erwachsen würde.
4. PARTIZIPATION
4.1 ZUM BEGRIFF
Wer von „partizipativer“ Kirchenentwicklung spricht, der muss offenlegen, was unter „Partizipation“ zu verstehen ist. Der Begriff „Partizipation“ leitet sich vom Lateinischen „pars“ (Teil, Anteil) und „capere“ (nehmen) ab. „Partem capere“ bedeutet wörtlich so viel wie „einen Teil (weg-)nehmen“. Dementsprechend ist unter „participare“ vor allem „teilnehmen (lassen), teilen, teilhaben“ zu verstehen.20 Deutlich wird, dass bereits im begrifflichen Ursprung unterschiedliche Partizipationskonzepte und -verständnisse divergieren. Nicht zuletzt deshalb fungiert „Partizipation“ häufig als Container-Begriff, in den verschiedene Bedeutungsinhalte genauso wie unterschiedliche Interessen, Hoffnungen und Erwartungen eingelagert werden. Partizipation wird dann häufig auf diffuse Art und Weise synonym zu anderen Begriffen wie etwa „Mitarbeit“, „Mitwirkung“, „(Mit-)Entscheidung“, „Mitbestimmung“ „Mitsprache“, „Teilnahme“, „Teilhabe“, „Beteiligung“ aber auch zu „Ehrenamt“ und „freiwilligem Engagement“ gebraucht. Entsprechend vielseitig sind auch einzelne (soziale, ökonomische, kulturelle, politische, kirchliche usw.) Partizipationspraktiken. So ist Partizipation etwa im politischen Kontext eng mit der Idee demokratisch strukturierter Gesellschaften verbunden. In diesem Sinne beinhaltet Partizipation „alle Handlungen, die Bürger einzeln oder in Gruppen freiwillig mit dem Ziel vornehmen, Entscheidungen auf den verschiedenen Ebenen des politischen Systems (Gemeinde, Land, Bund, eventuell supranationale Einheiten) zu beeinflussen und/oder selbst zu treffen“21. Dabei sind die Beteiligungsformen im Kontext „politischer Partizipation“ vielfältig und können von der Teilnahme an Wahlen über die Mitgliedschaft in Parteien oder Gewerkschaften bis hin zu Demonstrationen und anderen Bürgerinitiativen reichen. Diese haben sowohl Auswirkungen auf die allgemeine Erwartungshaltung als auch das Bewusstsein bezüglich Partizipation und fördern gemessen daran Grenzen und Möglichkeiten ihrer Realisierung auch anderswo zutage – zum Beispiel im kirchlichen Kontext.
4.2 PARTIZIPATION AUS SYSTEMTHEORETISCHER PERSPEKTIVE
In systemtheoretischer Hinsicht wird Partizipation als Inklusion gedacht und der Ausgrenzung – der Exklusion – gegenüber gestellt. Niklas Luhmann bezeichnet Inklusion als „die Chance der sozialen Berücksichtigung von Personen“22, die sich dann vergrößert, wenn diese an den „Funktionssystemen teilnehmen können, je nachdem, in welchem Funktionsbereich und unter welchem Code ihre Kommunikation eingebracht wird“23. Partizipation stellt somit die Voraussetzung für Inklusion dar. Dabei kann Partizipation unterschiedliche Grade annehmen: Die stärkste Form von Partizipation ist die Beteiligung von Personen an Entscheidungen, sodass sie als EntscheidungsträgerInnen in die relevante Umwelt einbezogen werden. In dem Fall, dass Personen ihre Meinung äußern, werden sie in spezifische Subsysteme als TeilnehmerInnen inkludiert. Wenn Personen lediglich informiert, hingegen nicht aktiv beteiligt werden, kann aus systemtheoretischer Sicht von Partizipation kaum die Rede sein.24 Umso wichtiger erscheint, dass der tatsächliche Partizipationsgrad transparent gemacht wird, und zwar indem folgende Fragestellungen einer Klärung zugeführt werden:
„• Kann und will man den betroffenen Personen/Gruppierungen wirklich Entscheidungskompetenz gewähren – auch wenn die erreichten Entscheidungen letztlich nicht den Vorstellungen des Managements oder der Projektleitung entsprechen?
• Sind die Betroffenen zahlenmäßig so stark in der Projektgruppe […] vertreten, dass sie Entscheidungen wirklich in ihrem Sinn beeinflussen können, oder bestehen Entscheidungsfindungsstrukturen (z. B. Einstimmigkeit), welche ihren Einfluss garantieren?
• Ist garantiert, dass die inkludierten Personen wirklich die Personengruppe repräsentieren, die sie formal vertreten? […]
• Wenn keine Entscheidungspartizipation vorgesehen ist, sondern lediglich Anhörung oder Kooperation – bestehen dann systeminterne Prämissen, wie mit den eingeholten Meinungen und auffälligen Widersprüchen umgegangen wird, und sind diese Prämissen den Angehörten bekannt?“25
Zentral ist der Hinweis auf die „Differenz von Semantik und Systemstruktur“26, das heißt auf die Unterscheidung zwischen dem, was verkündet wird und dem, was tatsächlich realisiert werden kann. Anders gesagt: Es ist wichtig, offenzulegen, welcher Grad an Partizipation überhaupt möglich oder eben nicht möglich ist anstatt Partizipation dort und dann zu proklamieren, wo und wann sie systemisch und strukturell gar nicht umgesetzt werden kann bzw. soll.
4.3 PARTIZIPATION AUS THEOLOGISCHER PERSPEKTIVE
Theologisch hat insbesondere das Zweite Vatikanische Konzil eine neue Epoche der Partizipation in der Kirche eingeleitet.27 In der Dogmatischen Konstitution über die Kirche wird zum Ausdruck gebracht (LG 10-12), dass alle Gläubigen durch Taufe und Firmung in gleicher Weise am dreifachen Amt Christi teilhaben und zwar – das ist entscheidend – in direkter und keineswegs durch das ordinierte Amt abgeleiteter Weise. Papst Johannes Paul II. hat in seinem nachsynodalen apostolischen Schreiben Christifideles laici bekräftigt, dass die „Teilhabe der Laien am dreifachen Amt Christi, des Priesters, Propheten und Königs […] ihre erste Wurzel in der Taufsalbung [hat], und […] in der Firmung ihre Ausfaltung [erfährt]“28. Und er führt fort:
„Weil sie sich von der kirchlichen communio ableitet, muß die Teilhabe der Laien am dreifachen Amt Christi in der communio und um des Wachstums der communio willen gelebt und verwirklicht werden.“29
Nach Walter Kasper wird der Communio-Begriff des Zweiten Vatikanischen Konzils unterdessen in dem Fall „unzureichend, ja falsch verstanden, würde man ihn lediglich als Strukturbegriff verstehen, der organisatorisch in einem besseren geschwisterlichen Miteinander der einzelnen Christen, Charismen, Ämter und Dienste, der Geschlechter, Völker, Kulturen und nicht zuletzt der Ortskirchen innerhalb der einen Kirche umzusetzen wäre“30. Insofern versteht Kasper „Communio“ als „das Wesen, besser: das Mysterium der Kirche selbst“, womit Kirche als Communio letztlich „Ikone, vergegenwärtigendes Abbild und Teilhabe an der trinitarischen Communio zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist“31 ist.
Darüber hinaus entfaltet das Konzil in Lumen Gentium den Leitgedanken vom Priestertum aller Gläubigen (LG 10). Demnach sind alle Getauften zu „einem heiligen Priestertum geweiht“ und dazu berufen, an der Sendung der Kirche mitzuwirken. Mindestens irreführend klingt die Aussage, dass das besondere oder hierarchische Priestertum sich vom gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen „dem Wesen und nicht bloß dem Grade nach“ unterscheide (LG 10). Denn diese Aussage, so konstatiert Bernd J. Hilberath, „suggeriert die zumindest hier unangebrachte Alternative von Wesen und Funktion“ und er führt weiter aus: „Das Wesen Christi war seine Funktion, sein Dasein für andere.“32 Theologisch wird deshalb betont, dass kein gradueller, quantitativer Unterschied (im Sinne von „mehr“ oder „größerer“ Teilhabe) zwischen den geweihten Amtsträgern und den „Laien“ gemeint sein kann. Die Aussageintention von LG 10 ist auch keine „ontologische Höherqualifizierung des Amtspriestertums“ wie die Formulierung „dem Wesen nach“33 vermuten lassen könnte. Vielmehr sollte der eigene nicht vom gemeinsamen Priestertum abhängige Charakter hervorgehoben werden, woraus konsequenterweise auch folgt, dass umgekehrt, „die anderen Dienste und Charismen in der Kirche sich nicht vom Amt her ableiten und definieren (etwa als ‚nicht-amtliche‘ oder ‚Laien-Dienste‘), sondern einen eigenen, dem ‚Wesen‘ nach verschiedenen (= unableitbaren) Charakter vom Amt haben“34.
Diese Sicht wird durch mindestens zwei weitere Leitgedanken des Zweiten Vatikanischen Konzils unterstützt. Da ist zum einen die Lehre vom Glaubenssinn des ganzen Volkes Gottes, vom „sensus fidelium“ (LG 12). Demzufolge kann laut LG 12 die
„Gesamtheit der Gläubigen, welche die Salbung von dem Heiligen haben, […] im Glauben nicht fehlgehen, und diese ihre besondere Eigenschaft macht sie mittels des übernatürlichen Glaubenssinns des ganzen Volkes dann kund, wenn sie von den Bischöfen bis zu den letzten gläubigen Laien ihre allgemeine Übereinstimmung in Sachen des Glaubens und der Sitten äußert.“ (LG 12)
Darüber hinaus heißt es zu Beginn des Laiendekretes Apostolicam actuositatem: „Das Apostolat der Laien, das in deren christlicher Berufung selbst seinen Ursprung hat, kann in der Kirche niemals fehlen.“ (AA 1) Daneben formuliert das Zweite Vatikanische Konzil in der Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium den auf Papst Pius X. zurückgehenden Leitgedanken der participatio actuosa (SC 11; SC 14; SC 21), das heißt der „tätigen Teilnahme“ des gesamten Volk Gottes an der Liturgie. Josef Ratzinger weist darauf hin, dass der Begriff „participatio“ oftmals „sehr schnell in einem äußerlichen Sinn mißverstanden und die Notwendigkeit eines allgemeinen Agierens daraus abgeleitet worden [sei], als ob möglichst viele möglichst oft für alle sichtbar in Aktion treten müßten“35. Der Begriff „Participatio“ bedeutet jedoch nicht „Teilnahme“, sondern „Teilhabe“ und rekurriert damit „auf eine Haupthandlung, an der alle teil-haben sollen“36, so Ratzinger. In diesem Verständnis ist die „actio“, an der alle teilhaben, das „Handeln Gottes“37. In der „actio“ aber, im „betenden Zugehen als Teilhabe“ aller, gibt es „keinen Unterschied zwischen Priestern und Laien“38.
Das Zweite Vatikanische Konzil benennt theologisch den Anspruch, hinter den eine sich „partizipativ“ nennende Kirchenentwicklung nicht mehr zurückgehen kann. Die „geistwirkte Gleichrangigkeit aller im Glauben bildet das Fundament jeder kirchlichen Lebensordnung und Struktur“39, bleibt hingegen „harmlos […], wenn sie sich nicht auch strukturell auswirkt“40. Partizipation greift zu kurz, wenn sie abgeleitet wird von der Erlaubnis oder der Abhängigkeit der einen von den anderen. Bucher bringt dies folgendermaßen auf den Punkt:
„Es ist zu wenig, das Engagement der Ehrenamtlichen noch einmal nach dem Motto ‚Ihr dürft auch‘ theologisch zu legitimieren. Solch ein Ansatz fällt nicht nur hinter das II. Vatikanum, sondern auch hinter das Selbstbewusstsein und den Autonomiestatus heutiger Existenz zurück, die nicht paternalistisch ‚zugelassen‘ werden will, um deren Partizipation die Kirche der Hauptamtlichen vielmehr bitten muss.“41
Vielmehr würde dadurch eine – systemtheoretisch gesprochen – „Differenz zwischen Semantik und Systemstruktur“ erneut aufklaffen, etwa dort, wo theologische Semantiken konträr zueinander stehen42, oder dort, wo Partizipation ein Lippenbekenntnis bleibt, weil diese in der Praxis schließlich doch (strukturell) zunehmend erschwert, verhindert oder nur in Ausnahmefällen aufgrund von „Priestermangel“ genehmigt wird. Die Differenzen wirken sich nicht zuletzt in Form von gegenläufigen Habitus-Konzepten aus und führen nicht selten zu enormen Frustrationen sowie schwer lösbaren Konflikten.
Umso wichtiger ist es, das Thema „Partizipation“ weder strukturell zu „verharmlosen“ noch länger binnenkirchlich zu verengen und in dem Sinne zu funktionalisieren, dass freiwillig Engagierte „nur als Lückenbüßer für das krisenhafte professionelle System der Kirche“43 an bestimmten Aufgaben partizipieren dürfen, wenn andere es gerade für notwendig erachten. Darüber hinaus ist wahr- und ernstzunehmen, dass einst selbstverständlich praktizierte Teilhabeformen im Raum von Kirche gesellschaftlich längst unter einen enormen Verflüssigungsdruck geraten sind.44 Demgegenüber wäre Partizipation viel stärker von der Sendung der Kirche her zu begreifen, die „Instrument und Werkzeug des Heils für die Welt“ (LG 1) ist; in diesem Sinne stünde die Teilhabe an „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst“ der Menschen von heute im Zentrum von Partizipation. Neu zu verstehen und zu entdecken wäre die Gegenseitigkeit der Unterstützung im Mensch- und im Christsein. Mit Martin Pott gesagt: „Der Begriff der Partizipation steht im christlichen Glauben im Tiefsten für die Teilhabe an Gottes Verheißung eines ‚Lebens in Fülle‘ (Joh 10,10). Er steht sodann für die Teilhabe am Aufbau des Reiches Gottes in dieser Zeit.“45
4.4 KONSEQUENZEN FÜR DEN PROJEKTTITEL „VERANTWORTUNG TEILEN“
Die Ausführungen zum Begriff „Partizipation“ lassen den Projekttitel „Verantwortung teilen“ auf den ersten Blick missverständlich erscheinen. Denn Verantwortung kann letztlich doch jede/r als Subjekt nur selbst wahrnehmen. Streng genommen lässt sich Verantwortung also gar nicht teilen.46 Insofern kann auch die Aufgabe von (Weiter-)Bildung in nichts anderem bestehen als in der Aktivierung und Förderung von Selbstleitung im Sinne der Selbstbestimmung und Eigenverantwortung jedes einzelnen Subjekts. Denn ohne Selbstleitung gibt es kein verantwortliches (Leitungs-)Handeln. Der Titel suggeriert demgegenüber eine latente Verhaftung an der klassischen „Aufgabenpastoral“, wonach sich freiwillig Engagierte die „Verantwortung“ für bestimmte Aufgaben, die zuvor hauptsächlich die Hauptamtlichen und die Pfarrer erfüllt haben, nun teilen. Dies entspricht jedoch gerade nicht dem Anspruch der partizipativen Prozesse, die im Rahmen des Projekts angestoßen werden sollen. Umso deutlicher ist herauszustellen, dass der Titel „Verantwortung teilen“ in dem Sinne zu verstehen ist, dass Christinnen und Christen für sich, für ihr Denken und Handeln Verantwortung wahrnehmen und (gemeinsam) als Subjekte Kirche vor Ort sind und leben, wodurch über die bloße Addition individueller Einzelverantwortungen hinaus, eine ganz neue Verantwortungs-Qualität freigesetzt wird (Stichwort Emergenz).
4.5 SERVANT LEADERSHIP
„Die meisten Führungskräfte (Manager) werden sich in
ihrem Leben nicht […] bewusst, dass sie nur eine Person
zu führen haben, nämlich sich selbst.“ 47
(Peter F. Drucker)
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach dem Verständnis von Leitung. Der Begriff „Servant Leadership“ steht für ein auf den ehemaligen amerikanischen Manager der Telefongesellschaft AT&T Robert K. Greenleaf (1904 bis 1990) zurückgehenden Führungsansatz, wonach Leitung im Unterschied zum beherrschenden Leiten vor allem als dienende Leitung verstanden wird. Dieser Ansatz ist weder Konzept noch Technik, sondern beschreibt eine „Lebenshaltung, die sich auf alle Lebensbereiche erstreckt“ und mit der „die Vertrauensbasis gelegt [wird] für persönliches und professionelles Wachstum, effiziente Zusammenarbeit, (Eigen-)Verantwortlichkeit und Tatkraft“48. Servant-Leadership ist damit alles andere als eine „Schnellreparatur-Methode“49 für Organisationen. Im Zentrum steht vielmehr ein „persönlicher geistiger Reifeprozess“50. Servant Leadership vertritt eine ganzheitliche Sicht „der Qualitäten von Mensch, Arbeit und Gemeinschaftssinn“51. Im Gegensatz zur herrschenden Haltung kennzeichnet die dienende Haltung unter anderem folgende Grundmerkmale:
– Leitung hört zu, anstatt zu bevormunden und zu belehren
– Leitung fragt nach Einsicht, anstatt zu (ver-)urteilen
– Leitung tritt in einen Dialog anstatt zu reglementieren
– Leitung respektiert, anstatt gering zu achten
– Leitung dient, anstatt zu (be-)herrschen52
„Servant Leadership“ ist in diesem Sinne auch für das Projekt „Verantwortung teilen“ entscheidend, und zwar mit dem Fokus auf einen zentralen Aspekt: Wie das Eingangszitat von Peter F. Drucker deutlich werden lässt, beginnt „Servant Leadership“ nämlich nicht – wie häufig mit Rekurs auf das Merkmal „dienend“ in der pastoralen Landschaft einseitig hervorgehoben wird – bei der Leitung von anderen, sondern bei der Leitung von sich selbst. Leonhard Schnorrenberg führt aus: „In dem Maße, worin wir unsere eigene Individualität entwickeln, entwickeln wir gleichzeitig eine größere Dienstbarkeit nach anderen, weil wir wissen, dass der andere nicht so ist wie wir.“53 Dienende Leitung wäre also ganz und gar missverstanden, wenn diese in der Sorge für andere in dem Sinne als „dienend“ begriffen würde, dass die Geführten schließlich doch wieder in gewisse Machtabhängigkeiten gerieten. Dienende Leitung heißt vielmehr „Empowerment“, Ermutigung zur Selbstleitung durch Selbstleitung.54 In diesem Verständnis entfaltet der Ansatz „Servant Leadership“ auch für das Projekt „Verantwortung teilen“ seine Relevanz hinsichtlich der Frage nach dem Leitungsstil. Der Leitungsdienst, den wir einander zu „leisten“ haben, hat „dafür zu sorgen, dass wir frei von Abhängigkeiten werden“, denn so „sind wir auch in ‚Kon-takt‘ mit anderen“55.
5. TEAMUND ERMÖGLICHUNGSKULTUR ALS ZWEI WESENTLICHE LEITLINIEN DES PROJEKTS
Die theoretische Bewusstwerdung und theologische Vergewisserung ist das Eine; das Andere ist die praktische Konkretion. Wie wird praktisch und zugleich praxistauglich, was unter Schlagworten wie Partizipation, Selbstorganisation, gemeinsames Priestertum aller Getauften, „Servant Leadership“, partizipative Kirchenentwicklung usw. firmiert? Dieser Schritt stellt eine der größten Herausforderungen dar, weil dazu vieles, was und wie es zuvor gelernt und liebgewonnen wurde, wieder zu verlernen und Neues zu erlernen ist. Der Schritt von der Theorie in die Praxis erfolgt im Rahmen des Projekts „Verantwortung teilen“ im Wesentlichen über zwei inhaltliche Leitlinien, die sich in den beiden Modulen „Teamkultur“ und „Ermöglichungskultur“ (unter dem Stichwort: „pastorale Entwicklung (an-)leiten“) des Bildungscurriculums konkretisieren. Die methodische Umsetzung verpflichtet sich dem zu vermittelnden Inhalt: der Ermöglichung von Partizipation.
5.1 TEAMKULTUR
Rainer Bucher erklärt die Dichotomien zwischen „Laien und Klerikern“ sowie „Hauptamtlichen und sogenannten Ehrenamtlichen“ zu den gegenwärtig „unfruchtbaren wechselseitigen Ressentiments innerhalb des Volkes Gottes“56, und zwar insofern sie in der praktischen Realität für beide Parteien nicht als Gewinn erlebt werden (können). Solcherart unfruchtbare Dichotomisierungen zeigten sich im Bistum Aachen etwa dort, wo die Fortbildungen für Hauptamtliche und freiwillig Engagagierte nicht nur in dem Fall, wo die unterschiedliche Profession es erforderlich macht, sondern auch in dem Fall, dass in der Praxis beide zusammen im Team arbeiten, getrennt organisiert wurde.
Darüber hinaus ergibt sich auch mit dem Auftrag, über das Projekt „Verantwortung teilen“ Unterstützung für freiwillig Engagierte in Form von Fortbildung zu organisieren, die Gefahr weiterer Dichotomisierungen im Denken und Handeln, nämlich zwischen denen, die scheinbar befähigt werden müssen, um zu partizipieren, und jenen, die fähig sind zu partizipieren bzw. zwischen denen, die Unterstützung brauchen und jenen, die unterstützen. Wo sich diese Subjekt-Objekt-Bezüge im Gegensatz zu einem wechselseitigen Lernen auf Augenhöhe weiter verfestigen und für die Organisation von Bildungsprozessen dominant werden, ist ein Kulturwandel im Sinne partizipativer Kirchenentwicklung nicht möglich. Vielmehr wird es nur dort, wo es zum Auf-Bruch solcher Dichotomisierungen kommt, echten Aufbruch geben können. Freiwillig Engagierte sind nicht die MitarbeiterInnen oder HelferInnen des Pfarrers bzw. der Hauptamtlichen und auch „nicht zuerst ‚Ehrenamtliche‘, sie sind vielmehr von Gott berufene Mitglieder des Volkes Gottes“57 und, so Bucher weiter, als „gemeinsame Mitglieder der Kirche sind wir mehr füreinander als ‚Hauptamtliche‘ oder ‚Ehrenamtliche‘“58.
Als zentrale Herausforderung stellt sich in diesem Zusammenhang auch heraus, dass freiwillig Engagierte nicht einfach für eine Praxis ausgebildet werden dürfen, die schließlich im Zusammenspiel mit hauptamtlich Tätigen und besonders den Pfarrern gar nicht zum Einsatz kommt bzw. kommen kann – und umgekehrt. Notwendig ist, bewusst zu machen, dass es nicht nur freiwillig Engagagierte sind, sondern auch Hauptamtliche einschließlich der Pfarrer, die gefordert sind zu lernen. Denn das „zentrale Zuordnungsprinzip in der Kirche“ ist „nicht die Über- oder Unterordnung, sondern der Beitrag zur pastoralen Gesamtaufgabe der Kirche“59. Wie dieser Beitrag hingegen erfolgreich umgesetzt werden kann, steht derzeit gerade infrage. Das Projekt fördert daher eine Teamkultur, die bereits im Prozess des Lernens und des Suchens nach Antworten ansetzt. Dazu bedarf es der Einsicht, dass die Heterogenität der Zusammensetzung im Team gerade das Kreativitäts- und Innovationspotenzial eines Teams erhöht. Zusammenfassend gesagt: Differenzierungen sind fruchtbar zu machen sowie kreativ ins Spiel zu bringen und zwar in der Zuordnung auf das, was wieder neu zu lernen ist: die Frohe Botschaft, die wir den Menschen von heute zu verkünden haben.60
5.2 ERMÖGLICHUNGSKULTUR
Freiwillig Engagierte und hauptamtlich Tätige, die (gemeinsam) leitende Verantwortung in der Kirche vor Ort wahrnehmen, sei es in Räten, Gremien, Leitungsteams oder darüber hinaus, haben mehr denn je kreative Prozesse pastoraler Entwicklungen zu ermöglichen und „Neues“ zu gestalten als lediglich das Gewohnte zu verwalten.61 Wie aber lernt man, kreative Prozesse (an-)zuleiten? Durch die reine Verordnung von neuen Konzepten werden keine wirksamen Prozesse in der Pastoral initiiert. Insofern kommt es in der Tat auf das Präfix des Verbs „(an-)leiten“ an – verstanden in dem Sinne, dass es darum geht, möglichst vielen Personen zu ermöglichen, an Prozessen von Anfang an zu partizipieren, selbst Entwicklungen anzustoßen und sich auf einen eigenen Lernweg zu begeben. Anders gesagt: Jede bzw. jeder ist im Hinblick auf neue Entwicklungsprozesse in der Pastoral ihre bzw. seine wichtigste Ressource.
Neben strukturellen Voraussetzungen sind zur Anleitung pastoraler Entwicklungsprozesse im Sinne der Ermöglichungskultur folgende Faktoren notwendig, die das lernende Subjekt in den Fokus stellen. Zum Teil orientieren sie sich an den fünf Disziplinen, die Peter M. Senge als „Kunst und Praxis der lernenden Organisation“ erarbeitet hat.62
Erstens: Innovation gründet im Ideenreichtum einzelner Subjekte. Voraussetzung für kreative Entwicklungsprozesse ist die Selbstorganisation einer jeden Christin bzw. eines jeden Christen. Am Anfang von Change-Prozessen steht, mit Peter Senge gesprochen, die persönliche „Meisterschaft“ („Personal Mastery“).63 Konkret bedeutet „Personal Mastery“, dass „man an das Leben herangeht wie an ein schöpferisches Werk und daß man eine kreative im Gegensatz zu einer reaktiven Lebensauffassung vertritt“64. Dies manifestiert sich in zwei wesentlichen Verhaltensweisen:
„Erstens klärt man immer wieder aufs neue, was einem wirklich wichtig ist. Häufig verwenden wir so viel Zeit auf die Bewältigung von Problemen, die entlang des Weges auftauchen, daß wir ganz vergessen, warum wir überhaupt auf diesem Weg sind. Das Ergebnis ist, daß wir nur eine sehr vage oder sogar falsche Vorstellung davon haben, was uns wirklich wichtig ist. Zweitens lernt man kontinuierlich, die gegenwärtige Realität deutlicher wahrzunehmen. Wir alle kennen Menschen, die sich in kontraproduktive Beziehungen verstricken und darin gefangen bleiben, weil sie weiterhin so tun, als wäre alles in Ordnung.“65
„Personal Mastery“ heißt zu lernen, diese beiden Pole – „Vision“ und „gegenwärtige Realität“ – in einer kreativen Spannung zu halten, wobei gilt: „[…] Personal Mastery ist nichts, das man besitzt. Es ist ein Prozeß. Es ist eine lebenslange Disziplin.“66 Im Vordergrund der „persönlichen Meisterschaft“ stehen Selbstführung und Persönlichkeitsentwicklung. Veränderungsprozesse in Organisationen beginnen in nichts anderem als in und mit uns selbst. Denn, so schreibt Senge, „Organisationen lernen nur, wenn die einzelnen Menschen etwas lernen“67. Dementsprechend geht es darum, das Selbstvertrauen jedes Einzelnen in sich selbst zu stärken, Selbstorganisation zu fördern, sowie die Pluralität von Ideen und das Risiko unerwarteter Überraschungen zu begrüßen.
Kreative Wandlungsprozesse setzen zweitens die Infragestellung von gewohnten Wahrnehmungs- und Verhaltensweisen voraus. Freiwillig Engagierte müssen genauso wie hauptamtlich Tätige lernen, sich ihrer „mentalen Modelle“ zu vergewissern, genauer ihrer Denkschemata, „Bilder, Annahmen und Geschichten“, die darauf Einfluss nehmen, wie die Menschen sich selbst, ihre Mitmenschen, die Institutionen, die Welt wahrnehmen.68 Oftmals werden neue Ideen deshalb „nicht in die Praxis umgesetzt, weil sie tiefverwurzelten inneren Vorstellungen vom Wesen der Dinge widersprechen – Vorstellungen, die uns an vertraute Denk- und Handlungsweisen binden“69. Diese „inneren Landkarten“ gilt es – in der Konfrontation mit anderen Denk- und Sichtweisen – kritisch zu reflektieren, zu hinterfragen, freizulegen und möglicherweise zu verändern. Denn so, wie mentale Modelle das Lernen in Organisationen lähmen können, indem sie diese „in überholten Praktiken erstarren lassen“70, so können mentale Umkehrprozesse andersherum bewirken, dass der Lernprozess vorangebracht und der Handlungsspielraum über neue Praktiken erweitert wird.
Drittens bedarf es einer Vision, die von allen geteilt wird („shared vision“). Visionen setzen Kräfte für Veränderungsprozesse frei, anstatt die Anstrengungen allein in das gewohnte „Tagesgeschäft“ zu (re-)investieren. Visionen lassen sich nicht „top down“ verordnen. Es gilt immer wieder den Austausch so (an-)zuleiten, dass die persönlichen Sehnsüchte und Zukunftsbilder aller ProzessteilnehmerInnen zur Sprache kommen. Ohne Partizipation gibt es keine echte Visionen: „Wenn eine echte Vision vorhanden ist (im Gegensatz zu den allseits bekannten ‚Visions-Erklärungen‘), wachsen die Menschen über sich selbst hinaus: Sie lernen aus eigenem Antrieb und nicht, weil man es ihnen aufträgt.“71 Was es neu einzuüben gilt, ist eine narrative Kultur, in der die großen und die kleinen Erfahrungen des Lebens und des Glaubens geteilt werden.
Mit dem Dialog beginnt auch die vierte Disziplin, das Teamlernen, das von besonderer Bedeutung ist, „weil Teams, nicht einzelne Menschen, die elementare Lerneinheit in heutigen Organisationen bilden“72. Senge erklärt sie zu „‚Nagelprobe[n]‘ für die Praxis“73, denn: „Nur wenn Teams lernfähig sind, kann die Organisation lernen.“74 Team-Lernen kann beschrieben werden als der „Prozeß, durch den ein Team seine Fähigkeit, die angestrebten Ziele zu erreichen, kontinuierlich ausrichtet und erweitert“75. Ziel ist die Förderung der Fähigkeit als Team, auf synergetische Art und Weise zu denken, zu lernen und zu handeln. Es kommt darauf an, Pluralität genauso wie Meinungsverschiedenheiten als Potenzial zu entdecken. Dazu bedarf es des offenen und ehrlichen Dialogs („Konfliktfähigkeit“) genauso wie der Fähigkeit, eingeschliffene Handlungsmuster im Hinblick auf gemeinsame Ziele als produktiv oder unproduktiv zu entlarven.
Die Förderung kreativer Wandlungsprozesse setzt fünftens ein systemisches Denken („systems thinking“) voraus. Gemeint ist die Fähigkeit, organisationale Vorgänge nicht einzeln und getrennt voneinander, sondern in ihrer Ganzheitlichkeit erfassen zu können.76 Dazu sind mehrere Prozesse notwendig: „Erkennen von Strukturen und Zusammenhängen, Denken in Möglichkeiten, Prozessdenken (‚was passiert, wenn‘), Denken in Szenarien (‚was wird aus uns in zehn Jahren‘) sowie vernetztes Denken (Zusammenhänge von alternativen Entscheidungen und ihren Konsequenzen).“77
Mit den fünf Disziplinen bezeichnet Senge keineswegs „eine ‚erzwungene Ordnung‘“, sondern eine „grundlegende Theorie und Methodik“, die einen Prozess lebenslangen Lernens impliziert.78 Die Disziplinen unterscheiden sich von üblichen Managementdisziplinen darin, dass sie „‚persönliche‘ Disziplinen“ sind. „Eine Disziplin auszuüben ist etwas anderes, als ein ‚Modell‘ nachzuahmen“79, so Senge. Im Vordergrund steht der persönliche Lernprozess jeder und jedes Einzelnen, ein schöpferischer Prozess des Umkehrens („Metanoia“), der „den Kern unserer menschlichen Existenz“80 berührt.
Vor diesem Hintergrund ist auf mindestens drei weitere Aspekte hinzuweisen, die in Bezug auf die Herausforderung des Lernens in der Organisation Kirche an Bedeutung gewinnen:
Wer erstens ausgehend von der Selbstorganisation jeder/s Einzelnen Lernprozesse in der Pastoral ermöglicht, der geht das Wagnis ein, zuzulassen, dass unter Umständen Fehler gemacht werden. Umso wichtiger ist die Förderung einer wertschätzenden Fehlerkultur in der Kirche, in der begrüßt wird, dass Neues ausprobiert wird, selbst wenn es scheitern sollte. Anstatt den Freiraum von vornherein zu beschränken, bedarf es eines Klimas, in dem experimentiert werden darf, eine angstfreie Haltung der Neugier vorherrscht und aus Fehlern gelernt wird. Grundlage dafür ist vor allem eine Kultur des Vertrauens. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist die Aussage des jüngst emeritierten Aachener Bischofs Dr. Heinrich Mussinghoff (1995 bis 2015), der die pastoralen MitarbeiterInnen seines Bistums dazu ermutigte, etwas Neues zu gestalten, um dann hinzuzufügen: „Und ihr dürft Fehler machen. Der größte Fehler – und die eigentliche Todsünde – ist nichts zu tun. Wir brauchen kreative Menschen, die in die Zukunft sehen.“81
Zudem sind innovative Prozesse zweitens stets von denen her zu gründen, denen sie zu dienen haben. Kirche ist nicht für sich selber da, sondern ist „Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit“ (LG 1). Als Prüfstein für die Notwendigkeit innovativer Entwicklungsprozesse kann die Frage gelten: Was würde den Menschen in der Stadt oder im Dorf fehlen, wenn es uns als Kirche hier nicht mehr geben würde? Oder positiv formuliert: Was haben die Menschen in der Stadt oder im Dorf davon, dass es uns hier als Kirche gibt? Worauf diese Fragen hinauslaufen, ist keine konsumorientierte Produktlogik im Sinne eines pastoralen Nutzenkalküls, sondern eine „Exposure“-Struktur, die erfordert, aus dem Eigenen herauszugehen und sich Fragen, Perspektiven, Lebensstilen, Gefühlen und Situationen von Menschen auszusetzen.82 Anders gesagt: Die Initiierung innovativer Prozesse in der Pastoral hat der Rekrutierung neuer Mitglieder genauso zu widerstehen wie der Dynamik angepasster Selbsterhaltung. Von Anfang an ist der Fokus der Wahrnehmung in der Perspektive des Evangeliums auf die Lebensfragen und -themen der Menschen zu richten, die mit uns leben, wohnen und arbeiten.
Drittens wohnt schließlich jedem „schöpferischen Handeln […] ein Moment der Nicht-Handlung inne“83. Kreative Wandlungsprozesse bewegen sich in der Dialektik zwischen Altem und Neuem, zwischen Handlung und Nicht-Handlung, zwischen Macht und Ohnmacht.84 Dabei bedeutet auch „innovatives“, erneuerndes Handeln „zu antworten“. Während wir zwar erfinden können, was wir antworten, können wir hingegen nicht erfinden, worauf wir antworten.85 „Das, worauf wir antworten, ist ein Fremdes und Außer-ordentliches, das sich der jeweiligen Ordnung entzieht“86, so der Phänomenologe Bernhard Waldenfels. Geraten wir demgegenüber – so wäre kritisch zu hinterfragen – nicht auch in pastoralen Zusammenhängen oftmals allzuschnell in den Sog einer Normalisierung, die darin besteht, „die Differenz zwischen dem Was und dem Worauf des Antwortens zum Verschwinden zu bringen und sie durch eine fungierende Ordnung zu ersetzen, in der Andersheit nur als andere Möglichkeit, nicht als fremder Anspruch vorkommt“87? Auch im Hinblick auf innovative Prozesse in der Pastoral kann es unterdessen nur um ein demütiges Planen gehen, „das einplant, was es nicht planen kann, um ein Handeln, das teilhat an dem, was es letztlich nicht haben kann, und das als solches Planen und Handeln offen bleibt auf die Dynamik des Heiligen Geistes und ihre ungeahnten Wirkungen hin“88.
6. DAS BILDUNGSCURRICULUM
Die Leitlinien konkretisieren sich in der Konzeption des Bildungscurriculums „Verantwortung teilen“. Die Zielgruppen bestehen aus freiwillig Engagierten und hauptamtlich Tätigen, die in mehr oder weniger klassischen Leitungs- und Gremienstrukturen partizipieren sowie aus jenen Christinnen und Christen, die ohne konkretes „Amt“ auf der Suche nach neuen Ausdrucksformen glaubwürdigen Christseins sind. Das Curriculum umfasst mehrtägige Kurse für GdG-Rats-Vorstände, für Teams besonderer Leitung, für Tandems aus je einer bzw. einem freiwillig Engagierte/n und hauptberuflich Tätige/n sowie für alle Suchenden. Darüber hinaus werden flexibel kombinierbare Bausteine angeboten, die je nach Bedarf und gewünschten Schwerpunkten frei wählbar und kombinierbar sind. Mit dieser Möglichkeit wird dem großen Bedürfnis von freiwillig und hauptamtlich Tätigen Rechnung getragen, angesichts sehr begrenzter Zeitfenster, sowohl den Zeitraum als auch den Lernort individuell bestimmen zu können. Über das Bildungscurriculum wird im Sinne der Teamförderung eine Art „Kontraktsituation“ geschaffen, wonach freiwillig Engagierte und hauptamtlich Tätige, die in der Praxis gemeinsam im Team Verantwortung für (Leitungs-)Aufgaben wahrnehmen (wie etwa im GdG-Rats-Vorstand) auch (!) als Team am Bildungsprogramm teilnehmen. Im Folgenden werden die Themen des Kursprogramms kurz skizziert. Eine ausführliche Darstellung der Lernziele und der methodischen Umsetzung erfolgt in Kapitel IV in diesem Band.
6.1 BAUSTEINE
Wie das Schaubild unten zeigt, setzen sich die Kurse aus den Bausteinen zusammen, die die beiden Module (1) „Team-Identität“ und (2) „Ermöglichungskultur“ (unter dem Stichwort „pastorale Entwicklung (an-)leiten“) umfassen. Das Curriculum eröffnet einen orientierenden Rahmen, in dem einzelne Bausteine in Form eines „Wahlkurses“ je nach Bedarf frei kombinierbar sind. Die Querschnittsperspektive des gesamten Curriculums ist die Spiritualität des Wortes Gottes. Nicht nur in dem, was gelernt wird, sondern auch darin, wie gelernt wird, soll etwas von der Kraft und Freiheit der Frohen Botschaft erfahrbar werden.
KURS 1: „EINE KIRCHE, DIE AUS SICH HERAUSGEHT“. NEUE FORMEN DES KIRCHESEINS. KURS FÜR SUCHENDE CHRISTINNEN UND CHRISTEN
(ReferentIn: Martin Pott / Elisa Kröger / Reinhard Feiter)
Exposure (sich Aussetzen) – teilnehmende Beobachtung – Kultur des Hörens – an den Lebensfragen und -situationen von Menschen partizipieren – innovative Prozesse initiieren – Experimentieren – der Realität etwas zutrauen – Relecture
KURS 2: WERTSCHÄTZEN – INTEGRIEREN – LEITEN. FORTBILDUNG FÜR VORSTÄNDE VON GDG-RÄTEN
(ReferentIn: Theo Hipp / Co-LeiterInnen)
Identität und Rolle im GdG-Rats-Vorstand – Rolle als GdG-Rats-Vorstand im Zusammenspiel unterschiedlicher Akteure der GdG – Kommunikationstechniken – pastorale Entwicklungen (an-)leiten – aktiv zuhören – Erfahrungsaustausch (an-)leiten – Talente und Erfahrungen zu Gehör bringen – Zielvereinbarungen treffen
KURS 3: „ABENTEUER VORSTANDSARBEIT“ – FORTBILDUNG ZUR ZUKUNFTSORIENTIERTEN LEITUNG DER GEMEINSCHAFT DER GEMEINDEN
(ReferentIn: Walter Lennartz / Rita Pongratz)
Identität und Rolle als Leitungsperson, Leitungsteam und pastorales Gesamtsystem – Teamkultur – Selbstorganisation – wertschätzende Kommunikation „auf Augenhöhe“ – Feedback-Kultur – Kulturwandel von der „Pastoral der Aufgabenerfüllung“ hin zu einer „gabenorientierte Pastoral“ – Kommunikations- und Leitungsstile im Kontext einer Ermöglichungspastoral – Konfliktmanagement
KURS 4: FACILITATOR-BASISAUSBILDUNG. DIE KUNST, ENTWICKLUNGSPROZESSE ZU ERLEICHTERN. KURS FÜR „TANDEMS“ AUS JE EINER/M FREIWILLIG ENGAGIERTEN UND HAUPTBERUFLICH TÄTIGEN
(Referentinnen: Roswitha Vesper /Amelie Vesper)
Facilitating (Prozesse erleichtern) – meine Rolle als Facilitator – Appreciative Inquiry (Wertschätzende Erkundung) – Story Telling – Check In – World Café – innovative Prozesse initiieren und begleiten – Leitung und Rolle im Sinne von Facilitating
KURS 5: WAHRNEHMEN – INSPIRIEREN – LEITEN. FORTBILDUNG FÜR TEAMS „BESONDERER LEITUNG“
(ReferentIn: Theo Hipp / Co-LeiterInnen)
Selbstorganisation – „Nein-Sagen“ lernen – Teambuilding – Kommunikation – Erfahrungsaustausch anleiten – Leitungsstil – Kommunikation der LeitungsteamFunktion gegenüber anderen verantwortlichen Akteuren und Gremien – pastorale Prozesse (an-)leiten
7. ERKENNTNISSE AUS DEM PROJEKTVERLAUF
Das Bildungscurriculum fungiert als offene Lernplattform in der Perspektive einer partizipativen Kirchenentwicklung. Die Lernprozesse aller Kurse werden jedes Jahr evaluiert. Nach zwei Perioden (2014/2015 und 2015/2016) lassen sich folgende Erkenntnisse festhalten:
(1) (Weiter-)Bildung fungiert als Baustein einer Kultur der Wertschätzung. Freiwillig Engagierte besitzen ein großes Bedürfnis, sich theologisch weiterzubilden. Die Eröffnung von Lernräumen in Form von kostenlosen Kursen, die Kultur des Feedbacks, sowie auch die Ausstellung eines Zertifikats werden als besondere Anerkennung des freiwilligen Engagements erfahren.
(2) Durch das gemeinsame Lernen von hauptberuflich Tätigen und freiwillig Engagierten formiert sich eine neue Art von Teamkultur, in der bisher selbstverständlich eingenommene Haltungen bewusst gemacht und partizipationsförderliche Haltungen auf Augenhöhe erlernt werden.
(3) Zum Teil erweist sich die erfolgreiche Gewinnung von Pfarrern und hauptamtlich Tätigen für das Teamlernen im Rahmen eines mehrtägigen Kurses als sehr schwierig. Als Ursache dafür wird vor allem angegeben, dass die zeitlichen Ressourcen knapp seien. Zudem pflegen einige Hauptamtliche auch Vorbehalte gegenüber gemeinsamen Lernformen, nicht zuletzt aufgrund ihrer anderen Profession. Gerade sie, die Hauptamtlichen, sind es allerdings, die im Kontext innovativer und partizipativer Kirchenentwicklung eine entscheidende Rolle spielen.
(4) Der Prozess des Lernens ist nach dem Kurs nicht einfach beendet. Im Gegenteil. Viele TeilnehmerInnen äußern nach ersten Kurserfahrungen den Wunsch, dass die initiierten Entwicklungsprozesse weiter begleitet werden. Entscheidend wird daher die Vernetzung mit anderen Unterstützungssystemen im Bistum sein, die eine kontinuierliche Begleitung und bedarfsorientiertes Coaching ermöglichen.
(5) Exposures ermöglichen das Lernen an eigenen Erfahrungen. Jede/r kann nur aus sich selbst herausgehen und sich Orten aussetzen, die ihr bzw. ihm zunächst fremd erscheinen. Exposure setzt beim einzelnen Subjekt an. Die Exposure-Erfahrungen provozieren einen Blickwechsel vom Eigenen zum Anderen und wecken die Leidenschaft, an den Lebenssituationen von Menschen die Frohe Botschaft neu zu lernen. Ganz gleich, ob aus den Exposure-Erfahrungen ein Malprojekt mit trauernden Kindern oder Projekte mit Schülerinnen und Schülern von alleinerziehenden Frauen und Männern erwachsen sind oder – jenseits von konkreten Projekten – Exposure-Momente in der eigenen (Glaubens-)Biografie entdeckt wurden, – es ging in erster Linie darum, seine eigenen eingespielten Denk- und Handlungsweisen zu verändern und – anstatt für andere – mit und von anderen, Neues zu gestalten bzw. gestalten zu lassen.
(6) Das Facilitating-Training lässt erfahrbar werden, dass nicht nur die Inhalte, das „Was“, sondern vor allem auch die Art und Weise, das „Wie“, kulturprägend ist: Die Art und Weise, in der kommuniziert wird und Prozesse begleitet werden, ist bereits sprechend und entspricht dem, was vermittelt werden soll: Partizipation. In der Weise, wie der Lernprozess von den ReferentInnen freigegeben wird, entsteht ein gemeinsamer Prozess, durch den das kreative Potenzial der TeilnehmerInnen ans Licht kommt. Dies hat nicht nur eine enorme motivationale Wirkung auf die TeilnehmerInnen, sondern auch wirksame Effekte auf bestimmte Grundhaltungen und Leitungsstile im Sinne der beschriebenen Ermöglichungskultur.
8. PERSPEKTIVEN
Wandlungsprozesse erfolgen nicht jenseits gewachsener Strukturen. Auch Innovation beinhaltet stets ein Moment der Anknüpfung an Bisheriges, sei es in Form von Abweichung, Umstrukturierung oder Umgestaltung.89 Neues ist dementsprechend niemals vollkommen neu. Auch das Projekt „Verantwortung teilen“ hat an vorhandene Strukturen angeknüpft und damit die Menschen ernst genommen, die sich innerhalb dieser engagieren, und daran anknüpfend zugleich Denk- und Handlungsspielräume zu eröffnen versucht, die etwas Neues entdecken lassen, das vom Alten abweicht. Was aus diesem Versuch zu lernen ist, lässt sich in Form von vier Aspekten skizzieren:
(1) Hinsichtlich einer sich partizipativ nennenden Kirchenentwicklung sind letztlich nicht bestimmte Bildungsinhalte entscheidend, sondern vielmehr der dahinterliegende Prozess. Anders gesagt: Ohne, dass Partizipation von Anfang an als Fundament von Kirchenentwicklung ernstgenommen wird, werden Bildungsinitiativen ihre Wirksamkeit kaum entfalten können. Wer unterdessen mehr anstrebt als einen dekorativen Neuanstrich von Kirche, der muss (auch strukturell) die Konsequenzen ziehen, die eine ernstgemeinte Rede von Partizipation verlangt. Entscheidungen dürfen nicht länger singulär „top down“ getroffen werden. Daraus folgen auch Veränderungen in der Leitungsrolle. Anstatt zu kontrollieren, geht es darum, zur Selbstorganisation jeder und jedes Einzelnen anzuregen. Anstatt davon auszugehen, dass nur die anderen etwas lernen müssen, geht es darum, auch sich selbst als Lernende/n zu begreifen. Freiwillig Engagierte sind dann nicht mehr nur jene, die für bestimmte Aufgaben qualifiziert werden müssen, sondern vor allem auch jene, die bereits entscheidende Kompetenzen besitzen und von Anfang an als Subjekte an Planungs-, Entscheidungs-, Durchführungsund Entwicklungsprozessen partizipieren. Die zukünftige Herausforderung von „Verantwortung teilen“ wird dementsprechend darin liegen, die Grenzen des Projektcharakters zu überwinden und eine Kultur der Partizipation zu fördern, die über einzelne Fortbildungsprogramme hinausgeht; es wird darum gehen, kontextbezogene, gesamtpastorale Prozesse zu fördern, an denen so viele Menschen wie möglich vor Ort von Anfang an teilhaben.
(2) Aus Forschungsperspektive muss klar gesagt werden: Das Projekt „Verantwortung teilen“ steht von Beginn an in der Gefahr, eine bestimmte Sozialform von Kirche in die Zukunft hinein zu verlängern, die in soziokultureller und theologischer Hinsicht mittlerweile unter einen massiven Verflüssigungsdruck geraten ist. Anders gesagt: Mit der Erfüllung des Auftrags, freiwillig Engagierte, die nun stärker in GdG-Räten, in Gremien und Leitungsteams in der Kirche partizipieren, in Form von Fortbildung zu unterstützen, ist eine sich partizipativ verstehende Kirchenentwicklung längst nicht „getan“. Im Gegenteil tun sich unterschiedliche „Fallen“ auf, in die man leicht geraten kann: So wird etwa die „Klerikalisierung“ immer dann zu einer „Gefahr im gesamten Volk Gottes, wenn Amtlichkeit ins Spiel kommt“90. Damit geht zugleich die Versuchung der Repetition dessen einher, was Michel de Foucault mit dem Begriff der „Pastoralmacht“ als eine „Macht der Sorge“ beschrieben hat, die sich, so Hermann Steinkamp, eben „nicht auf die Befähigung (‚empowerment‘) der Gemeinde zu Selbstorganisation und solidarischem Handeln, sondern auf die langfristige Sicherung von pastoraler Versorgung“91 bezieht. Wie in anderen Bistümern auch besteht ebenso im Bistum Aachen die Herausforderung, in Form von verschiedenen Projekten und Konzepten nicht doch wieder in die Dynamik eines „mehr Desselben“ einzusteigen und dadurch Strukturen und Praktiken in den „alten Konzepte[n] Mitgliedschaft, Gefolgschaft und Macht ‚freiwillig‘ zu verlängern“92. Denn was damit nicht hinreichend gelöst würde, sind die pastoralen Herausforderungen der Gegenwart, wie sie unter anderem in der bereits angesprochenen „Milieuverengung“ deutlich zutage treten. Einen Fokus auf den angezeigten Habitus-Wechsel zu legen, wird auch in Zukunft verstärkt notwendig sein. Partizipation von freiwillig Engagierten ist nicht auf die Beteiligung an kirchlichen Aufgaben anlässlich einer in die Krise geratenen Sozialform von Kirche zu verengen. Vielmehr ist das in der Grundstruktur des freiwilligen Engagements liegende Innovationspotenzial auf ein relevantes Christsein vor Ort hin freizulegen.
(3) Die Soziologin Maren Lehmann stellt fest, dass „der Fehler […] so vieler Reformversuche der Kirche als Organisation [darin besteht, E. K.], dass sie nach zuviel Ordnung und zuviel Regelung suchen, wo es doch darauf ankäme, nach brauchbarer Unordnung […] zu suchen“93. Die Suche nach Ordnung, Regelung und Stabilisierung ist in Zeiten, in denen Vieles im Umbruch begriffen ist, besonders stark ausgeprägt. Sie kann auch hinter dem Projektauftrag vermutet werden, „Unterstützungs-Tools“ für freiwillig Engagierte zu entwerfen, die in Gremien, Räten und Leitungsteams innerhalb der Organisation Kirche verstärkt partizipieren (sollen). Demgegenüber wäre die brauchbare Unordnung zu suchen, die – so Lehmann – „nur auf der Ebene kommunikativer Begegnungen“ zu finden sei, also in den – wenn auch flüchtig bleibenden – Begegnungen „unter Leuten“94. Nicht zuletzt deshalb war und wird es auch in Zukunft entscheidend sein, einen Fokus auf das Lernen aus eigenen Erfahrungen in Form von Exposures „unter Leuten“ zu legen. Es kommt darauf an, immer wieder aus dem Eigenen herauszugehen und sich Orten auszusetzen, die ungeordnet und chaotisch sind, und zwar ohne diese gleich ordnen, homogenisieren oder normalisieren zu wollen, sondern darin gerade zu bezeugen „dass das Heil nicht aus einer Zugehörigkeit hervorgeht und dass man sogar zum Reich Gottes gehören kann, ohne davon zu wissen“95. Mit Lehmann gesagt: Die Identifikation von Zugehörigkeit bzw. „Mitgliedschaft und Anwesenheit wäre eine fatale Verwechslung“96.
(4) Wer etwas vermitteln will, der stößt – insbesondere im Hinblick auf das Phänomen Partizipation – auf das unhintergehbare Paradigma der Glaubwürdigkeit. In seinen Propädeutischen Überlegungen zur Glaubensvermittlung fragt Mussinghofs Vorgänger im Bischofsamt, Bischof Klaus Hemmerle: „Was heißt Vermittlung?“97 Seine Antwort lautet: „Die Sache ist die Methode; das meint: Die einzig gültige Methode ist die Sache selbst. Methode heißt ja Weg, Zugang.“98 Diese phänomenologische Einsicht formuliert Hemmerle in Bezug auf die „Sache des Glaubens“99 und seine Vermittlung, kann in gewisser Weise aber auch für diözesane Prozesse von Bedeutung sein: Inhalt und Methode gehören zusammen.100 Der Inhalt von Partizipation ist die Methode und die Methode ist der Inhalt von Partizipation. Anders gesagt: Die Vermittlung von Partizipation widerspricht sich überall dort, wo Partizipation nur proklamiert und nicht von Anfang an auch praktiziert wird. Insofern kann es gar nicht ausschließlich um ein Lernen von Partizipation, sondern immer nur auch um ein Lernen durch Partizipation gehen. Entscheidend ist der Weg, die Art und Weise, das „Wie“. Papst Franziskus nennt dies den „Weg der Synodalität, welcher der Weg ist, den Gott von der Kirche im dritten Jahrtausend erwartet“101. Dieser beginnt mit einem „Hören“, das „mehr ist als bloßes Hören“. Das synodale Hören ist vielmehr
„ein wechselseitiges Hören bei dem jeder (!) etwas zu lernen hat. Das gläubige Gottesvolk, das Kollegium der Bischöfe, der Bischof von Rom: der eine hört auf den anderen, und gemeinsam hören sie auf den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit (Joh 14,17), um das zu erkennen, was Er seinen Kirchen sagt (Apg 2,7).“102
In Zukunft gilt es vom Hören ausgehend die Vielfalt synodaler Formen (wieder) zu entdecken und zu praktizieren, auch und gerade dort, wo es um gesamtpastorale Prozesse im Sinne einer „partizipativen“ Kirchenentwicklung geht.
9. SCHLUSSWORT
„Verantwortung teilen“ ist der Titel für eine Entwicklung, die noch längst nicht an ein Ende gekommen ist. Mit dem Projekt wurde eine Lernplattform geschaffen, die es weiter zu vernetzen und zu bespielen gilt. Notwendig wäre die Selbstrelativierung durch die stärkere Einbindung in ein „Netz pastoraler Orte“, zu deren Knotenpunkten all jene Orte gehören, „an denen Prozesse der kreativen Konfrontation von Evangelium und Existenz stattfinden“103, von denen gelernt werden kann. Das Thema „Partizipation“ ist auch in Zukunft vor einer Verengung auf eine aufgrund des „Priestermangels“ notwendig gewordene Aufgabenteilhabe durch freiwillig Engagierte zu schützen.
Es geht bei der Frage nach Partizipation durch freiwillig Engagierte nicht darum, neue Experten auszubilden, die das überkommene und in die Krise geratene System einfach weiterführen. Das Thema Partizipation ist von bestimmten Logiken freizuhalten, wie etwa der Logik der Versorgung der einen durch die anderen, der Logik der Aufgabenverpflichtung, der Rekrutierung und der Mitgliedschaft im Sinne der institutionellen Eingliederung von „brauchbaren“ Fähigkeiten. Gleichsam hat auch die Organisation von Bildungsprozessen der Versuchung erneuter Dichotomisierungen zwischen „Hauptamtlichen“ und „Ehrenamtlichen“, zwischen „Lehrenden“ und „Lernenden“, zwischen „Experten“ und „Nicht-Experten“ zu widerstehen. Partizipation ist als Ausgangspunkt und nicht nur als (zu vermittelnder) Gegenstand ernst zu nehmen. Anstatt Partizipation strukturell zu verharmlosen, ist ehrlich auf bestehende „Differenzen zwischen Semantik und Systemstruktur“ hinzuweisen. Außerdem gilt: Je höher die Tendenz ist, im „Eigenen“ zu verharren, umso dringlicher sind Lernprozesse zu organisieren, die vom „Anderen“ ausgehen.
Neu zu entdecken ist auch das Prinzip der Gegenseitigkeit und eine Teamkultur, die aus mehr besteht als die Summe von Einzelverantwortungen. Partizipative Prozesse in der Kirche springen unterdessen zu kurz, wenn das Interesse nicht dem Leben von Menschen in der Perspektive der Frohen Botschaft gilt. Um was es geht, ist die Identität von Christinnen und Christen und darum, dass sie am Leben der Menschen von heute „dran“ bleiben und gemeinsam die erneuernde Kraft des Evangeliums – „Leben in Fülle“ (Joh 10,10) – erfahren.
Mehr denn je braucht es dazu Orte des Hörens und des offenen und ehrlichen Dialogs. Bucher erklärt die „Ehrlichkeit in einer strukturell nicht sehr ehrlichen, weil immer noch recht vermachteten kommunikativen kirchlichen Kultur […] [, zu] eine[r] Überlebensfrage der Kirche“104 schlechthin.
Darin könnte auch die Chance des Projekts „Verantwortung teilen“ liegen: Räume offen zu halten, in denen auf dialogische und ehrliche Weise gelernt und entdeckt wird, was es heißt, auf partizipative und relevante Weise Christin und Christ in der Welt von heute zu sein.
1 SPIELBERG, Bernhard: Lokal, lustvoll, lebensnah. Pfarrgemeinderäte zwischen Herein- und Herausforderungen, in: LANDESKOMITTEE DER KATHOLIKEN IN BAYERN: Handbuch Pfarrgemeinderat, Freiburg/Br. u. a. 2012, S. 74-80, hier S. 74.
2 Ebd. [Hervorhebung E. K.]
3 Vgl. SELLMANN, Matthias: Zuhören, Austauschen, Vorschlagen. Entdeckungen pastoraltheologischer Milieuforschung, Würzburg 2012, bes. S. 147-254. Vgl. EBERTZ, Michael N.: Anschlüsse gesucht. Ergebnisse einer neuen Milieu-Studie zu den Katholiken in Deutschland, in: Herder Korrespondenz 60 (4/ 2006), S. 173-177. Spielberg spricht in diesem Zusammenhang von der sogenannten „Exkulturation“, das heißt der „wachsende[n] Distanz zwischen der kirchlichen Praxis einerseits und dem Leben eines großen Teils der Menschen andererseits“. SPIELBERG, Lokal, lustvoll, lebensnah, S. 74.
4 EBERTZ, Michael N.: Kirche im Gegenwind. Zum Umbruch der religiösen Landschaft, Freiburg/Br. u. a. 1997, S. 135.
5 BUCHER, Rainer: Die Provokation annehmen. Welche Konsequenzen sind aus der Sinusstudie zu ziehen?, in: Herder Korrespondenz 62 (6/ 2008), S. 450-454, hier S. 454.
6 Aus guten Gründen wird hier auf den Begriff des „Ehrenamtes“ verzichtet. Pointiert schreibt Bucher: „Zukunftsweisender Umgang mit ‚Ehrenamtlichen‘ setzt voraus, sie gerade nicht primär als ‚Ehrenamtliche‘ zu adressieren, wahrzunehmen und zu behandeln, vielmehr als erfahrungsreiche Mitchristinnen und Mitchristen, die unter Umständen bereit sind, unentlohnt und im öffentlichen Rahmen zu tun, wofür es Kirche gibt: das Evangelium und unsere heutige Existenz kreativ in Spiel zu bringen, in Wort und Tat, hier und heute, im Kleinen und im Großen, zum Segen für andere und für sich selbst. Mit anderen Worten, die bereit sind, öffentlich pastoral tätig zu sein.“ BUCHER, Rainer: … wenn nichts bleibt, wie es war. Zur prekären Zukunft der katholischen Kirche, Würzburg 22012, S. 130.
7 Vgl. ELLEBRACHT, Heiner/LENZ, Gerhard/OSTERHOLD, Gisela: Systemische Organisations- und Unternehmensberatung. Praxishandbuch für Berater und Führungskräfte, Wiesbaden 42001, S. 149f.
8 BISTUM AACHEN (Hg.): Satzung für den Rat der Gemeinschaft der Gemeinden (GdG-Rat), 2013, § 3,1. Abrufbar unter: http://gemeindearbeit.kibac.de/medien/bb1be98f-a608-45c7-8f10-861d4f65bfd4/1.broschuere-satzung.web.pdf [Zugriff: 24.04.2016].
9 Ebd.
10 Ebd. § 3,3.
11 Vgl. ebd.
12 FUCHS, Ottmar: Die Kirchen vor der missionarischen Herausforderung durch HIV/AIDS – theologische Reflexionen, in: Francis X. D‘ SA/Jürgen LOHMAYER: Heil und Befreiung in Afrika, Würzburg 2007, S. 184-202, hier S. 193.
13 Vgl. ebd.
14 Vgl. BÖHNKE, Michael: ‚Gemeindeleitung‘ durch Laien. Genese und Ergebnisse eines Forschungsprojektes, in: DERS./Thomas SCHÜLLER (Hg.): Gemeindeleitung durch Laien? Internationale Erfahrungen und Erkenntnisse, Regensburg 2011, S. 9-33, hier S. 12-14.
15 Vgl. KRÖGER, Elisa: (Weiter-)Bildungsbedarfe aus der Perspektive freiwillig Engagierter in Leitungsteams in der Diözese Aachen – eine empirische Untersuchung“, in diesem Band, S. 125-168.
16 BUCHER, … wenn nichts bleibt, S. 134.
17 BUCHER, Rainer: Aufmerksamkeit, Demut und Ermutigung durch Vertrauen. Charisma und Leitung – ein Spannungsfeld, in: Unsere Seelsorge (September 2011), S. 8-11, hier S. 9, verfügbar unter: http://www.bistum-muenster.de/downloads/Seelsorge/2015/US_sep2015.pdf [Zugriff: 20.04.2016].
18 Vgl. http://www.zap-bochum.de/ZAP/die-methode.php [Zugriff: 19.04.2016]. Vgl. zur wissenschaftstheoretischen Diskussion die Beiträge in PthI 35 (2015/2). Vgl. auch SELLMANN, Matthias: Zuhören, Austauschen, Vorschlagen. Entdeckungen pastoraltheologischer Milieuforschung, Würzburg 2012.
19 Vgl. die Ansprache von Papst Franziskus „Synodalität für das 3. Jahrtausend“ vom 17.10.2015, verfügbar unter: http://de.radiovaticana.va/news/2015/10/17/papstansprache_synodalit%C3%A4t_f%C3%BCr_das_3_jahrtausend/1180030 [Zugriff: 20.04.2016]. Dort heißt es: „Die Synodalität als konstitutives Element der Kirche bietet uns einen angemesseneren Interpretationsrahmen für das Verständnis des hierarchischen Dienstes. Wenn wir verstehen, dass wie der heilige Johannes Chrysostomos sagt ‚Kirche und Synode Synonyme sind‘ (Explicatio in Ps 149) – weil die Kirche nichts anderes ist als das gemeinsame Gehen der Herde Gottes auf den Wegen der Geschichte zur Begegnung mit Christus dem Herrn – dann verstehen wir auch, dass in ihrem Inneren niemand über die anderen ‚erhoben’ ist. Im Gegenteil, in der Kirche ist es notwendig, dass sich jemand ‚erniedrigt‘, um sich in den Dienst an den Geschwistern auf dem Weg zu stellen.“
20 Vgl. KROBATH, Thomas: Partizipation als organisationsethisches Prinzip und Verfahren, in: Susanne Maria WEBER/Michael GÖHLICH/Andreas SCHRÖER/Claudia FAHRENWALD/Hildegard MACHA (Hg.): Organisation und Partizipation. Beiträge der Kommission Organisationspädagogik, Wiesbaden 2013, S. 61-70, hier S. 61.
21 KAASE, Max: Partizipation, in: Everhard HOLTMANN (Hg.): Politik-Lexikon, München 2000, S. 466-470, hier S. 466. Freilich sind auch in Bezug auf politische Partizipation die Verständnisse und Konzepte unterschiedlicher und komplexer als sie hier dargestellt werden können.
22 LUHMANN, Niklas: Die Gesellschaft der Gesellschaft, Bd. 2, Frankfurt/M. 1997, S. 634-662, hier S. 620.
23 Ebd. S. 625.
24 Vgl. HAFEN, Martin: Stichwort Partizipation, in: Jan V. WIRTH/Heiko KLEVE (Hg.): Lexikon des systemischen Arbeitens. Grundbegriffe der systemischen Praxis, Methodik und Theorie, Heidelberg 2012, S. 303-306, hier S. 304.
25 Ebd. 304f.
26 Ebd. S. 305.
27 „Neu“ jedenfalls in Bezug auf das Erste Vatikanische Konzil. Vgl. DEMEL, Sabine: Kirche als Volk Gottes und die Berufung der Laien zur eigenen Verantwortung. Die theologischen Grundlagen für die Berufe der Gemeinde- und PastoralreferentInnen, in: DIES. (Hg.): Vergessene Amtsträger/innen? Die Zukunft der Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten, Freiburg/Br. 2013, S. 12-29.
28 JOHANNES PAUL II: Nachsynodales Apostolisches Schreiben Christifideles Laici. Über die Berufung und Sendung der Laien in Kirche und Welt, Nr. 14, abrufbar unter: http://w2.vatican.va/con-tent/john-paul-ii/de/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html [Zugriff: 26.04.2016].
29 Ebd.
30 KASPER, Walter: Der Leitungsdienst in der Gemeinde, Bonn 1994, S. 6.
31 Ebd.
32 HILBERATH, Bernd Jochen/JEPSEN, Maria/BERLIS, Angela/FREITAG, Josef/HOLL, Adolf: Hat Priesterliches im Christentum Platz? Fünf theologische Stellungnahmen, in: Diakonia 34 (3/ 2003), S. 159-170, hier S. 162.
33 KEHL, Medard: Die Kirche. Eine katholische Ekklesiologie, Würzburg 42001, S. 114.
34 Ebd. Fußnote 61.
35 RATZINGER, Joseph/Benedikt XVI: Der Geist der Liturgie. Eine Einführung, Freiburg/Br. 2000, S. 147.
36 Ebd.
37 Ebd. S. 148.
38 Ebd. S. 149.
39 KEHL, Kirche, S. 106.
40 Ebd. S. 110.
41 BUCHER, … wenn nichts bleibt, S. 133.
42 Vgl. etwa „Christifideles laici“ Nr. 23: „Die Erfüllung einer solchen Aufgabe macht den Laien nicht zum Hirten. Nicht eine Aufgabe konstituiert das Amt, sondern das Sakrament des Ordo. Nur das Sakrament des Ordo gewährt dem geweihten Amtsträger eine besondere Teilhabe am Amt Christi, des Hauptes und Hirten und an seinem ewigen Priestertum. Die in Vertretung erfüllte Aufgabe leitet ihre Legitimität formal und unmittelbar von der offiziellen Beauftragung durch die Hirten ab. Ihre konkrete Erfüllung untersteht der Leitung der kirchlichen Autorität.“ Oder vgl. Papst Benedikt XVI., der Pfarrer von Ars zitiert: „Ohne das Sakrament der Weihe hätten wir den Herrn nicht.“ SCHREIBEN VON PAPST BENEDIKT XVI. zum Beginn des Priesterjahres anlässlich des 150. Jahrestages des „Dies natalis“ von Johannes Maria Vianney, in: http://w2.vatican.va/content/bene-dictxvi/de/letters/2009/documents/hf_benxvi_let_20090616_anno-sacerdotale.html [Zugriff: 02.05.2016].
43 BUCHER, … wenn nichts bleibt, S. 133.
44 Vgl. ebd. S. 15-55; vgl. POTT, Martin: „Liquid church” – und Partizipation in Kirche und Gemeinde, in: PthI 34 (2/ 2014), S. 57-86; vgl. WARD, Pete: Liquid church, Peabody (Mass.) 2002; vgl. BAUMAN, Zygmunt: Liquid modernity, Cambridge 2000.
45 POTT, „Liquid church“, S. 61.
46 Diesen Hinweis verdanke ich den wertvollen Gesprächen mit Dr. Hadwig Müller.
47 Zitiert nach SCHNORRENBERG, Leonhard J.: Servant Leadership – die Führungskultur für das 21. Jahrhundert, in: Hans H. HINTERHUBER/Anna M. PIRCHER-FRIEDRICH/Rüdiger REINHARDT/Leonhard J. SCHNORRENBERG (Hg.): Servant Leadership – Prinzipien dienender Unternehmensführung, Berlin 2006, S. 17-40, hier S. 28. Vgl. auch BÖHLEMANN, Peter/HERBST, Michael: Geistlich leiten. Ein Handbuch, Göttingen 2011, S. 80ff.
48 SCHNORRENBERG, Servant Leadership, S. 27.
49 Ebd.
50 Ebd.
51 Ebd. S. 28.
52 Vgl. ebd. S. 36.
53 Ebd. S. 30. Interessant wäre in diesem Zusammenhang dem vom Soziologen Dirk Baecker erläuterten Unterschied zwischen einem „heroischen Management“ und einem „postheroischen Management“ näher nachzugehen. Baecker schreibt: „Vom postheroischen Management sprechen wir, weil das Heroische darin bestand, zugunsten des Gewinns von Tragik und von Komik an den einmal gesetzten Unterschieden festzuhalten. Held ist, wer entweder beeindruckend triumphiert oder großartig scheitert. Alle anderen sind bloß Beobachter, die dem Weltenlauf nichts hinzuzufügen haben, sondern allenfalls die anfallenden Arbeiten erledigen. Im postheroischen Management werden die Beobachter aus ihrer passiven Rolle befreit. Sie werden zu Akteuren. Jeder ihrer Arbeitsschritte ist eine Entscheidung. Helden stören dabei nur. Helden sind Leute, die den Blick für die Gegenwart scheuen und sich stattdessen auf ihre Zukunft, ihre glorreiche Zukunft konzentrieren.“ BAECKER, Dirk: Editorial, in: Revue für postheroisches Management, 1 (1/ 2007), S. 3-4. Vgl. ausführlicher etwa BAECKER, Dirk: Postheroisches Management. Ein Vademecum, Berlin 1994.
54 Vgl. RIECK, Ute: Empowerment. Kirchliche Erwachsenbildung als Ermächtigung und Provokation, Tübingen 2007.
55 SCHNORRENBERG, Servant Leadership, S. 30.
56 BUCHER, Rainer: Der mühsame Weg der Kirche und die Chancen der Pfarrgemeinderäte, in: LANDESKOMITTEE DER KATHOLIKEN IN BAYERN: Handbuch Pfarrgemeinderat, Freiburg/Br. u. a. 2012, S. 67-71, hier S. 72.
57 BUCHER, … wenn nichts bleibt, S. 129f.
58 Ebd. S. 130. [Hervorhebung E. K.]
59 Ebd. S. 122.
60 In Anlehnung an eine Formulierung von HEMMERLE, Klaus: Spielräume Gottes und der Menschen. Beiträge zu Ansatz und Feldern kirchlichen Handelns. Ausgew. und eingel. von R. Göllner und B. Trocholepczy, Freiburg/Br. u. a. 1996, S. 329. Der O-Ton lautet: „Lass mich dich lernen, dein Denken und Sprechen, dein Fragen und Dasein, damit ich daran die Botschaft neu lernen kann, die ich dir zu überliefern habe.“
61 Vgl. BUCHER, Der mühsame Weg, S. 71.
62 Vgl. SENGE, Peter M.: Die fünfte Disziplin. Kunst und Praxis der lernenden Organisation. Aus dem Amerikanischen von Maren Klostermann, Stuttgart 82001.
63 Ebd. S. 16.
64 Ebd. S. 173.
65 Ebd. S. 174. [Hervorhebung E. K.]
66 Ebd. S. 175.
67 Ebd. S. 171.
68 Ebd. S. 213.
69 Ebd.
70 Ebd. S. 217.
71 Ebd. S. 18.
72 Ebd. S. 20.
73 Ebd.
74 Ebd.
75 Ebd. S. 287.
76 Vgl. ebd. S. 15.
77 FRANKEN, Swetlana: Verhaltensorientierte Führung. Handeln, Lernen und Diversity in Unternehmen, Wiesbaden 32010, S. 294.
78 SENGE, fünfte Disziplin, S. 20.
79 Ebd. S. 23f.
80 Ebd.
81 http://www.aachener-zeitung.de/lokales/region/bischof-heinrich-mussinghoff-das-ist-gross-und-befreiend-1.721973 [Zugriff: 05.05.2016].
82 Vgl. zu „Exposure“ besonders POCK, Johann/HOYER, Birgit/SCHÜßLER, Michael: Ausgesetzt. Exklusionsdynamiken und Exposureprozesse in der Praktischen Theologie, Münster 2012. Vgl. HOYER, Birgit: Seelsorge auf dem Land. Orte verletzbarer Theologie, Stuttgart 2011. Vgl. zum Begriff „Exposure“ und seiner Geschichte auch OSNER, Karl: Begegnung mit den Armen. Was Exposure Programme bewirken können, in: Herder Korrespondenz 61 (6/ 2007), S. 317-322.
83 WALDENFELS, Bernhard: Grenzen der Normalisierung. Studien zur Phänomenologie des Fremden 2, Frankfurt/M. 1998, S. 93.
84 Diesen Gedanken verdanke ich P. Manfred Kollig SSCC, der sowohl in einem Beitrag zu den Exerzitien für den Weihejahrgang 1991 des Bistums Münster in St. Thomas (Eifel) (29.02. bis 03.03.2016) mit Bezug auf die Gottesbeziehung als auch im Rahmen des Zukunftsbildprozesses im Bistum Essen hinsichtlich pastoraler Strategien und Planungen die sogenannte Dialektik von Macht und Ohnmacht hervorhob.
85 Vgl. WALDENFELS, Grenzen, S. 141. Vgl. FEITER, Reinhard: Antwortendes Handeln. Praktische Theologie als kontextuelle Theologie – ein Vorschlag zu ihrer Bestimmung in Anknüpfung an Bernhard Waldenfels‘ Theorie der Responsivität, Münstersches Informations- und Archivsystem für multimediale Inhalte 2010 [Neuausgabe von: Antwortendes Handeln 2002] = http://repositorium.ni-muenster.de/document/miami/1972af71-19d5-4fae-be08-cf51fb7ffd6c/habil_feiter.pdf [Zugriff: 05.05.2016].
86 WALDENFELS, Grenzen, S. 141; vgl. auch Waldenfels‘ Ausführungen zum Unterschied zwischen einem produktiven und reproduktiven Handeln ebd. S. 90-93.
87 Ebd.
88 KRÖGER, Elisa: Das Unplanbare einplanen. Charismenorientierung als Fundament einer pastoralen Strategie, in: Anzeiger für die Seelsorge 123 (6/ 2014), S. 14-17, hier S. 17.
89 Vgl. WALDENFELS, Bernhard: Findigkeit des Körpers. Mit einem Beitrag von Bettina van Haaren, Matthias Kleiner und Peter Schubert und Zeichnungen von Antje Brusberg, Attila Gartzke, Michaela Jacobs, Stefanie Kath und Sebastian Smolka, Norderstedt 2004, abrufbar unter: http://www.fk16.tu-dortmund.de/kunst/cms/assets/files/publikationen/Findigkeit%20d%20K.pdf, S. 371 [Zugriff: 10.05.2016]. Siehe auch FEITER, Antwortendes Handeln, S. 65f.
90 FUCHS, Ottmar: Im Innersten Gefährdet. Für ein neues Verhältnis von Kirchenamt und Gottesvolk, Innsbruck 2009, S. 136. [Hervorhebung E. K.]
91 STEINKAMP, Hermann: Die sanfte Macht der Hirten. Die Bedeutung Michel Foucaults für die Praktische Theologie, Mainz 1999, S. 91.
92 BUCHER, … wenn nichts bleibt, S. 129.
93 LEHMANN, Maren: Leutemangel. Mitgliedschaft und Begegnung als Formen der Kirche, in: Jan HERMELINK/Gerhard WEGNER (Hg.): Paradoxien kirchlicher Organisation. Niklas Luhmanns frühe Kirchensoziologie und die aktuelle Reform der evangelischen Kirche, Würzburg 2008, S. 123-144, hier S. 129. Dort heißt es auch: „Denn nur fort, in den flüchtigen Begegnungen (encounters), kann die Anerkennung gefunden werden, nach der die Kirche so dringend sucht […].“ Ich danke Michael Schüßler für den Hinweis auf den genannten Beitrag von Maren Lehmann.
94 Ebd.
95 DONEGANI, Jean Marie: Säkularisierung und Pastoral, in: Reinhard FEITER/Hadwig MÜLLER (Hg.)/Wilhelm RAUSCHER (Übers.): Frei geben – pastoraltheologische Impulse aus Frankreich, Ostfildern 2012, S. 56-80, hier S. 69.
96 LEHMANN, Leutemangel, S. 140. „Es muss möglich sein, in der Kirche anderen zu begegnen, ohne die Mitgliedschaftsfrage [die Zugehörigkeitsfrage oder die berühmte Mit-Mach-Frage; E: K.] zu stellen oder gestellt zu bekommen, und es muss ebenso möglich sein, als Mitglied von Begegnungen abzusehen, also abwesend zu sein.“
97 HEMMERLE, Klaus: Propädeutische Überlegungen zur Glaubensvermittlung, verfügbar unter: http://www.klaus-hemmerle.de/index.php?option=com_content&view=article&id=442&Itemid=33 [Zugriff: 10.05.2016].
98 Ebd.
99 Ebd.
100 Dies drückt Hemmerle in Bezug auf den von ihm angestoßenen Prozess Weggemeinschaft im Bistum Aachen aus: „Die Methode des Prozesses ‚Weggemeinschaft‘ ist bestimmt vom anderen Stil des Evangeliums.“ HEMMERLE, Klaus: Zehn Punkte eines für die Zukunft des Prozesses „Weggemeinschaft“ im Bistum Aachen erforderlichen und tragenden Konsenses, in: BISCHÖFLICHES GENERALVIKARIAT AACHEN (Hg.): Der Prozess Weggemeinschaft im Bistum Aachen 1988-1994, Aachen 31995, S. 27-29, hier S. 28.
101 Ansprache von Papst Franziskus „Synodalität für das 3. Jahrtausend“.
102 Ebd.
103 BUCHER, … wenn nichts bleibt, S. 194.
104 Ebd. S. 131.