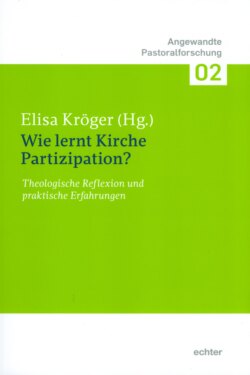Читать книгу Wie lernt Kirche Partizipation - Группа авторов - Страница 12
ОглавлениеRainer Bucher
Partizipative Kirche – Stationen eines weiten Weges
I. PARTIZIPATION – HISTORISCH
Die Einflussrechte der sogenannten Laien waren in der katholischen Kirche über lange Jahrhunderte viel größer als heute.1 Überhaupt war das Verhältnis zwischen Laien und Klerikern im Laufe der Kirchengeschichte höchst wandelbar. Die Einflussmöglichkeiten von Laien bezogen sich dabei keineswegs nur auf die bekannte Macht adeliger Herrschaft über die und in der Kirche. Es gab Dinge, die es heute (offiziell) nicht mehr gibt: die Laienpredigt, die Laienbeichte2 oder die veritable Jurisdiktion von Frauen über Kleriker.3
Für die neutestamentliche Zeit kann gar gesagt werden, dass die „auf den galiläischen ‚Laien‘ Jesus von Nazareth zurückgehende Erneuerungsbewegung […] in den ersten Generationen keine innergemeindliche Gegenüberstellung von ‚Klerikern‘ und ‚Laien‘ [kannte]“. Erst „im zweiten Jahrhundert“, so die Zusammenfassung des Forschungsstandes durch den Neutestamentler Christoph Heil, „entwickelte sich aus sozio-kulturellen, politischen und ökonomischen Gründen die Unterscheidung eines ‚Kleriker-‘ und ‚Laienstandes.‘“4 Die Neutestamentlerin Marlis Gielen stellte gar fest, dass „Frauen […] in der ersten urchristlichen Generation funktionsidentisch mit Männern Aufgaben in der Gemeindeleitung wahr[nahmen], und zwar gleichermaßen im Bereich der Gemeindeorganisation wie im Bereich der vertiefenden Evangeliumsverkündigung“5, und man im Neuen Testament vergeblich „nach einer Verbindung zwischen gemeindebezogenen Funktionsbegriffen und der Funktion des Vorsitzes bei der gemeindlichen Herrenmahlfeier“6 suche.
Was in der Spätantike begann und in der mittelalterlichen Feudalgesellschaft weiter an Prägnanz gewann, wurde mit dem Konzil von Trient Programm und nach und nach auch Wirklichkeit: die absolutistische Klerikalisierung der katholischen Kirche. Hatte die kultische Sazerdotalisierung des Frühmittelalters – schon sie eine veritable „Rearchisierung des Christentums“7 – Predigt und Unterricht noch nicht an den Priester gebunden, so räumt „das Konzil von Trient einem Laienkatholizismus“ bereits „keinen Platz“ mehr ein, „drängte auch die ‚Aufklärung‘ die Laien zurück, indem es den Pfarrer, die Pfarrei, das Pfarr-Prinzip stärkte. Neben dem ‚Episkopalismus‘ wurde mannigfach (theoretisch und praktisch) versucht, einen ‚Presbyterialismus‘ durchzusetzen.“8 Aber immer noch wurde im „System des Staatskirchentums“ die „Kirche im (frühen) 19. Jahrhundert“ dann doch „wesentlich durch Laien geprägt“9.
Letztlich setzte sich erst mit der ultramontanen Gegenreaktion auf dieses Staatskirchentum in der päpstlichen Konkordatspolitik der Pianischen Epoche von der Mitte des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts jene reale Zweiständeherrschaft in der katholischen Kirche durch, die vielen heute noch als charakteristisch katholisch gilt. Träger der Seelsorge war nun letztlich allein der Priester. Noch in Michael Pflieglers 1962 bei Herder erschienener, durchaus „fortschrittlichen“ „Pastoraltheologie“ tauchen die Laien prominent nur als das „Zweite Buch“ füllende „Objekt der Seelsorge“ auf, im „Ersten Buch“, das von „Subjekt, Zeit und Ort der Seelsorge“ handelt, kommen sie nur in dessen III. Teil, 4. Abschnitt als „Laienhelfer in der Seelsorge“ vor.10 Der Priester war der einzige Handlungsträger der Pastoral und darüber hinaus brauchte er nur ein paar „Helfer“, die seine religiösen Anweisungen multiplizierten und ihm eine Plattform boten. Den Laien kam eines zu: Gehorsam.
Der streng konservative emeritierte Mainzer Kirchenrechtler Georg May veröffentlichte vor einiger Zeit einen Text11, der in der nüchternen Sprache des Rechts festhält, wie man sich in der „Pianischen Epoche“ das Verhältnis von Priestern und Laien vorstellte. Es heißt dort lapidar: „Christus hat die grundsätzliche Vorschrift gegeben, der sichtbaren Kirche und ihren Gesetzen Gehorsam zu leisten.“ Es gelte: „Die Kirche als Organisation ist aufgebaut auf dem Gehorsam gegen die kirchlichen Hirten.“12 Gehorsam sei aus Achtung „vor der höheren Autorität“ der kirchlichen Obrigkeiten, hinter der zuletzt die höchste Autorität überhaupt, Gott, stünde, zu leisten, „auch wenn die Begründung der Gehorsamforderung nicht einleuchtet“13.
Gehorsam gegenüber jeglicher kirchlichen Obrigkeit wurde spätestens im 19. Jahrhundert geradezu zum Ausweis des Katholischen. Das geschah kompensatorisch zur realen Entmachtung der katholischen Kirche im modernen bürgerlichen Staat und zur beginnenden Freisetzung zu religiöser Selbstbestimmung in der liberalen bürgerlichen Gesellschaft. Das I. Vatikanum fordert 1871 in „Dei filius“, dass der Mensch sich „dem offenbarenden Gott mit Verstand und Willen voll unterwirft“. Der Wille Gottes aber ist in diesem Konzept grundsätzlich und in allen Details (nur) der kirchlichen Obrigkeit bekannt. Ihr gebührt daher der Gehorsam des „Willens und des Verstandes“. Das Lehramt legt vor, was zu glauben, und legt fest, wie zu leben ist. Es entwickelte sich schließlich, im gewissen Sinn als letzter Rest von Freiheitsspielräumen, ein ganzes System der unterschiedlichen Verpflichtungsgrade kirchlicher Lehren und Gebote. Der dominante Modus der Partizipation war Gehorsam, zumindest offiziell. Dass die Volksfrömmigkeit spezifische Spielräume einbaute, war dabei eher integrationsfördernd.
Zentrales Merkmal des Klerikalismus der Pianischen Epoche war die mehr oder weniger selbstverständliche Unterordnung der privaten Lebensführung seitens der katholischen Laien unter die klerikal-kirchliche Richtlinienkompetenz bis hinein in die privatesten Praktiken14, inklusive der (nur mehr: innerkirchlichen) Deutungskompetenz über Wissenschaft und Gesellschaft. Das Verhältnis von Klerikern und Laien war das Verhältnis von Führung und Gehorsam. So zumindest forderte man es und konnte man es auch in spezifischen gesellschaftlichen und lokalen Regionen noch durchsetzen. Das sollte einerseits gegen die moderne liberale Gesellschaft immunisieren, war aber andererseits auch anschlussfähig an die anti-liberalen, autoritären Strömungen vor und vor allem nach dem Ersten Weltkrieg.
Natürlich gab es seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts eine zunehmende Aufmerksamkeit auf das „Laienapostolat“, in Österreich in Form der „Katholischen Aktion“, in Deutschland als „Katholische Verbände“. Begründet wurde dieses Laienapostolat übrigens schon damals damit, dass die eigentlichen „Seelsorger, schon zahlenmäßig, aber auch was die Problematik und die Fülle der Arbeit betrifft, vor Aufgaben“ stünden, „deren sie allein nicht Herr werden können“15.
II. DEKONSTRUKTIONEN
Nun war die katholische Kirche schon immer eine äußerst komplexe Wirklichkeit und sie ist es heute natürlich noch viel mehr. Es spricht viel dafür, dass die katholische Kirche in einer ausgesprochen dekonstruktiven Situation ist. Dekonstruktion meint literaturwissenschaftlich, einen Weg zwischen hermeneutischer, tendenziell konservativer Verstehensgewissheit und progressiver Kritiksicherheit zu suchen. Übertragen auf Phänomene jenseits von Texten geht es um die nicht mehr länger abweisbare Erfahrung eines erlittenen, außen-, nicht selbstgesteuerten Umbaus, der Altes zerstört, aber auch Neues schafft, freilich ohne dass dieses Neue das unmittelbar intendierte Ergebnis der Planungen und auch nur schon wirklich hinreichend bekannt ist. Eine Mischung aus Erleiden, Erfahren und tastendem Gestalten charakterisiert dekonstruktive Situationen, inklusive der Erfahrung der Stabilität genau dieser fragilen und fluiden Situation. Es geht dann um die Suche „nach Wegen, in den Ruinen zerbrochener Machtsysteme zu wohnen“16. Ruinen aber fehlt der (ursprüngliche) Zusammenhang, der noch ahnbar, ja „sichtbar“ ist, aber nicht mehr funktioniert. Zudem fehlt Ruinen das Dach: Sie konstituieren zwar noch einen eigenen Raum, sind aber zugleich Elemente „unter freiem Himmel“.
Das ehemals ausgesperrte oder nur kontrolliert zugelassene Außen ist nun permanent sichtbar, es dringt ein und überhaupt vieles dringt ein. Das eröffnet Weite, was jene begrüßen, die sich immer schon eingesperrt fühlten, vermittelt aber auch Schutzlosigkeit, was jene fürchten, die Schutz und Sicherheit suchten. Ruinen künden von vergangener Größe, schaffen aber auch eine Landschaft von unbestreitbarem Reiz, sie sind an ihrem alten Ort, kontextualisieren aber alles völlig neu. Es gibt manches vom Alten noch, aber es ist nicht mehr dasselbe, manches funktioniert noch in ihnen, aber nichts mehr wie früher. Wer es sich in ihnen bequem macht, so malerisch sie sind, wird vor allem eines spüren: Sie bieten keinen Schutz mehr, zumindest keinen selbstverständlichen. „Partizipation“ wird unter den dekonstruktiven Bedingungen der kirchlichen Gegenwart radikal transformiert. Sie wird von einer Zulassungsgnade der Obrigkeit zu einer Aktivierungsnotwendigkeit des Systems. Denn in Ruinen hält nichts Äußeres mehr zusammen, muss eine interne Kohäsion gefunden werden, will man sich nicht verlieren.
Nachdem sich die Machtverhältnisse zwischen Individuum und religiösen Institutionen auch im katholischen Feld fundamental gedreht haben und sich auch die katholische Kirche situativ und nicht mehr normativ vergemeinschaftet17, gerät die klassische katholische Pastoralmacht in ihre finale Krise. Es findet aktuell nichts weniger als die Verflüssigung der Kirchen als religiöse Herrschaftssysteme, als mächtige Heilsbürokratien, als die sich vor allem die katholische Kirche in der Pianischen Epoche verstand und formatierte, statt.18 Ohne die eigene Basis und deren pluralen Umweltkontakt verirrt sich solch ein System im Nirwana seiner defizitorientierten Selbstbespiegelung und in der mehr oder weniger gelungenen Aufarbeitung seiner Demütigungserfahrungen in einer Zeit, die Religion zwar nicht verabschiedet, aber dramatisch in ihrer Relevanz mindert.19 Es fällt immer noch vielen in der katholischen Kirche schwer, das zu akzeptieren. Auch Teile des Partizipationsdiskurses scheinen noch von einem gewissen hoheitlichen Zulassungsgestus geprägt. Das verwundert nicht: Das kollektive Gedächtnis der katholischen Kirche erinnert vor allem Machtkompetenzen, das Christentum ist es schließlich seit der „Konstantinischen Wende“ des 4. Jahrhunderts gewohnt, sich über gesellschaftliche Herrschaftsprozesse zu realisieren und hat auch sein eigenes Theoriegebäude in hohem Maße „konstantinisch“ formatiert.20 Zwar hat in Deutschland der organisierte Laienkatholizismus als Verbands- und Politischer Katholizismus eine lange und durchaus eindrucksvolle Geschichte, so wurde nach der Würzburger Synode eine Rätestruktur auf allen kirchlichen Ebenen installiert, das pastorale Laienamt des Pastoralreferenten/der Pastoralreferentin eingeführt und überhaupt das nicht-klerikale professionelle Personal massiv ausgeweitet. Und doch: All dies führte vielleicht zu einer gewissen Änderung der Kommunikationskultur zwischen Laien und Priestern, nicht aber zu einem wirklichen neuen pastoralen Paradigma. Die kirchliche Rätestruktur etwa wird nicht zuletzt durch mangelnde Relevanzvermutung und Relevanzerfahrung seitens des Volkes Gottes21 ausgehöhlt, dies signalisieren zumindest die Partizipationszahlen an den entsprechenden Wahlen. Signifikante Orte öffentlicher kirchlicher Laienaktivität wie etwa die Laienpredigt22 wurden zudem wieder eliminiert, selbst die aktuellen kirchenrechtlichen Spielräume zur Gemeindeleitung durch Laien werden nicht oder nur zögerlich ausgenutzt.23 Selbstverständlich gibt es bei einzelnen dieser Punkte auch gegenläufige Entwicklungen in einzelnen deutschsprachigen Diözesen, sie differenzieren den Gesamtbefund, ändern ihn aber nicht grundlegend.
III. ASYMMETRIEN
Jene Sozialform der katholischen Kirche, wie sie sich nach dem Konzil von Trient (1545 bis 1563) in Reaktion auf den beginnenden Reichweitenverlust kirchlicher Pastoralmacht gebildet hatte, zerfließt in den Kontexten einer spätmodernen Gesellschaft. Man kann davon ausgehen, dass die Zukunft der katholischen Kirche in unseren Breiten nicht primär von der Verfügbarkeit diverser Ressourcen, auch nicht von ihrer konkreten Organisationsform vor Ort, sondern von der Transformation zentraler, für die katholische Kirche typischer asymmetrischer Kontraste abhängt.
Vier solcher Kontraste sind innerkatholisch erkennbar: a) jener von Priestern und Laien, der katholisch herkömmlich in Über- und Unterordnungskategorien formatiert ist, b) jener von gelegentlichen Kirchennutzern (früher: „Fernstehende“, heute: „Kasualienfromme“) oder gar Ausgetretenen zu regelmäßigen Kirchgängern, der klassisch als Kontrast zwischen „wir“ und „jenen“, wenn nicht sogar zwischen „drinnen“ und „draußen“ gefasst wird, c) jener von Männern und Frauen, der in der katholischen Kirche nach wie mit der Konzeption „gleiche Würde“, „ungleiche Rechte“ definiert wird, d) jener von Hauptamtlichen und „Ehrenamtlichen“, der gewöhnlich auf der Achse Kompetenz – Unterstützung praxiswirksam wird. Die Hauptverantwortung für die Gestaltung dieser Kontraste liegt bei den jeweils Gestaltungsmächtigeren, also den jeweils Erstgenannten: den Priestern, den Hauptamtlichen, bei jenen, die sich im institutionellen „Innen“ der Kirche engagieren, und bei den Männern.
Diese Asymmetrien rufen nach partizipativer Auflösung seitens der diese Relationen bisher innerkirchlich Dominierenden und Definierenden. Das ergibt sich aus der bereits geschilderten dekonstruktiven Lage der katholischen Kirche. Denn die bisher unterlegene Seite kann sich unter den gegebenen Umständen der Definitionshoheit der stärkeren Seite entziehen – und tut es auch. Partizipation bedeutet damit für die bisher dominierende Seite die (letzte) Chance, den Kontakt mit den bislang von ihnen Dominierten, also den Laien, den Ehrenamtlichen, dem „Außen“ und den Frauen, aufrecht zu erhalten. Partizipation wird eine Überlebensfrage für das System überhaupt.
Systemisch und pastoral wird alles darauf ankommen, ob die genannten Differenzen kreativ werden im Sinne des pastoralen kirchlichen Auftrags oder nicht. Dabei wird es nicht so relevant sein, was sich die Beteiligten selber dabei denken, als vielmehr, welche Erfahrungen sie machen und welche Erfahrungen andere mit ihnen machen. Denn von der Wahrheit dieser Erfahrungen kann sich niemand mehr in der Kirche auf Dauer durch irgendwelche Schutzmechanismen abkoppeln. Sollten diese Kontraste weiterhin und gar zunehmend als destruktiv und dysfunktional wahrgenommen werden, sehe ich keine Zukunft für die katholische Kirche, weder institutionell noch pastoral. Die Entscheidung ist offen.
IV. SEHNSÜCHTE
Der Sozialpsychologe Harald Welzer hat in seinem Buch „Selbst denken“ eine kleine Analyse der Psychologie absteigender Institutionen entwickelt. „Immer, wenn sich Gesellschaften im Abstieg von ihrer ehemaligen Bedeutung befinden, kommt das Bewusstsein nicht hinterher. Man kann nur schwer verkraften, nicht mehr so bestimmend und mächtig zu sein wie einst, und zieht es daher vor, sich wenigstens noch bestimmend und mächtig zu fühlen. […] Die Menschen verharren, trotz mit Händen zu greifender Veränderungsprozesse in Rolle, sozialer Lage und politischer Macht, in ihrer Persönlichkeitsstruktur, in ihrem sozialen Habitus auf einer früheren Stufe – nämlich auf dem Höhepunkt ihrer gefühlten historischen Bedeutsamkeit.“24 Man kann die Reformvorschläge für die katholische Kirche und die sich daraus ergebenden Partizipationsmuster danach einteilen, auf welchen konkreten „Höhepunkt der gefühlten Bedeutsamkeit“ sie sich beziehen.
Bei den Traditionalisten, wie etwa den „Piusbrüdern“, ist es die Kirche des Tridentinums in ihrer Realisierung durch die Pianische Epoche von der Mitte des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, ist es die Priesterkirche der Spitzengewänder und der barocken Gesamtentfaltung kirchlicher Schönheit, Gottesgewissheit und innerkirchlicher Macht, ist es die im letzten ästhetische Vision einer kosmischen Bedeutsamkeit der katholischen Kirche über und jenseits aller konkreten Zeiten und Orte. Partizipation bedeutet hier Gehorsam, aber eben auch Partizipation an dieser Vision kosmischer Bedeutsamkeit und Schönheit.
Beim alltäglichen Gemeindechristentum ist es die Pfarrfamilie, bei der die Kinder ebenso froh in die Kirche gehen wie die Eltern, ist es die mittelständische Volkskirche der Anständigen und Fleißigen, die sich um einen freundlichen Priester schart und die das Leben alltäglich wie in den Krisensituationen stützt und begleitet. Partizipation bedeutet hier teilzunehmen am gemeindlichen „Familienleben“ in dem von ihm vorgegebenen Rahmen und Milieu.
Bei den Engagierten im Bewegungsspektrum ist es die Aufbruchskirche der Nachkonzilszeit, sind es die religiös motivierten sozialen Bewegungen für die Umwelt und die Armen, für Gerechtigkeit und Frieden, heute oft formatiert in der Nachfolge der lateinamerikanischen Basisgemeinden als „small christian communities“. Partizipation bedeutet hier Aktion, Engagement und auch politischgesellschaftliche Mitwirkung.Nichts davon ist per se illegitim. Nur: Die eigenen Sehnsüchte als Zukunftsmodelle von Kirche zu nehmen, funktioniert in dekonstruktiven Zeiten nicht mehr, zumindest nicht unbesehen. Zu leicht droht die projektive Falle, die eigenen guten Erfahrungen mit Kirche, das was man ihr verdankt und anderen wünscht, eben den „Höhepunkt der gefühlten Bedeutsamkeit“, als quasi natürliche Basis für eine mögliche Zukunft der Kirche zu nehmen. Das eigene Erleben, das eigene Fühlen, die eigenen Wünsche, so berechtigt und biographisch authentisch sie auch sein mögen, werden zur Basis für eine gewünschte Zukunft von Kirche.
Das ist die zentrale Dekonstruktion, welche die aktuelle dekonstruktive kirchliche Lage dem Volk Gottes zumutet: Die eigene, als wertvoll und wichtig erfahrene Kirche ist für die meisten Menschen dieser Gesellschaft offenkundig keine mögliche Kirche und es ist aussichtslos, dies ändern zu wollen. Man wird dann immer nur jene erreichen, die ungefähr so sind oder werden wollen wie jene, die noch in kirchlichen Zusammenhängen anzutreffen sind, und deshalb diese, in sich zudem differenten, Sehnsüchte teilen. Es ist aber nicht erlaubt, die Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat an jene Realisationen zu binden, die bereits existieren, in dekonstruktiven Situationen ist es sogar existenzgefährdend. Denn alle drei projektiven Sehnsüchte unterbieten die Pluralitäts-, Kontrast- und Entwicklungsproblematik von Kirche in der späten Moderne. Sie imaginieren – unterschiedlich zentrierte und unterschiedlich strukturierte – Einmütigkeitsträume und Einmütigkeitsräume, die es innerhalb der Kirche(n) praktisch nie gegeben hat und in postmodernen Zeiten erst recht nicht oder nur unter massiven Kosten geben kann.
Was bedeutet dies für die Partizipationsproblematik? Nichts weniger denn die Dekonstruktion eines rein institutionellen Partizipationsbegriffs. Was notwendig wäre, wird so noch nicht garantiert: vertrauen, experimentieren, an vielen Stellen Evangelium und heutige Existenz miteinander ins Spiel bringen, an die Peripherien gehen, in Bewegung bleiben, mit Gott einen Tanz wagen (M. Delbrêl), nie mehr daran glauben, dass es wieder feste Formen geben werde. Notwendig wäre zu realisieren, dass tatsächlich gilt, was Papst Franziskus in „Evangelii gaudium“ schreibt: „Die Zeit ist mehr wert als der Raum“25 und „Die Wirklichkeit ist wichtiger als die Idee“26. Es geht bei „Partizipation“ nicht um die gnädig gewährte Teilhabe an etwas Solidem, Festen, sondern um die gemeinsame Entdeckung von Neuem, zuletzt um die Entdeckung der Möglichkeit des Gottesglaubens in der Nachfolge Christi heute, in wirklich ganz neuen Zeiten.
V. MÖGLICHKEITEN
Wie alle soziologischen Begriffe, die pastoraltheologisch konzeptionell eingesetzt und implizit theologisch aufgeladen werden („communio“, „Volk“, „Gemeinde“, „Ehrenamtliche“), ist auch der Partizipationsbegriff ohne explizites theologisches Korrelat eine projektionsoffene Hülle,27 die unkontrolliert mit den eigenen Sehnsüchten gefüllt als Zukunftsvision der Kirche nicht wirklich genügt. Das befriedigt mehr Eigenes, als dass es Pastoral in postmodernen, also unvorhersehbar überraschungsoffenen Zeiten weiter hilft.
Was aber wäre ein weiterführender theologischer Korrelatbegriff zum Partizipationsbegriff, wie es etwa der Gottesbegriff im „Volk Gottes-Begriff“28 ist? Gianni Vattimo kann hier einen Hinweis geben:
„Wenn die Essenz der Heilsgeschichte die Säkularisierung ist, und d. h. die ‚reduktive‘ Transformation des natürlichen, metaphysischen Sakralen dank der Freundschaftsbeziehung, die Gott mit dem Menschen herzustellen beschließt und die der Sinn der Menschwerdung ist, dann ist das, was man der unangemessenen Rückbindung der christlichen Lehre an diese oder jene bestimmte geschichtliche Wirklichkeit entgegensetzen muß, die absolut totale Bereitschaft, ‚die Zeichen der Zeit‘ zu lesen, sich also in offenem Eingeständnis der eigenen Geschichtlichkeit immer von neuem mit der Geschichte zu identifizieren.“29
Partizipation an der Geschichte, an den „Zeichen der Zeit“ sollte hinter allen Partizipationsforderungen stehen, sollen sie nicht in konservative („Wie bleiben wir, wie wir sind mit Hilfe der Laien“) oder progressiv-romantische (Kirche als harmonische Gemeinschaft, in der alle gleichberechtigt mitreden dürfen) Utopien, also ins Nirgendwo laufen. Jenseits der an sich selbstverständlichen Etablierung innerinstitutioneller Partizipationsverfahren, wie sie in ausdifferenzierten spätmodernen Gesellschaften schlicht den Steuerungserfordernissen komplexer Institutionen entsprechen30, wäre kirchlich Partizipation als „Exposure“ zu denken, als „Sich-Aussetzen“ der Gegenwart und ihren „Zeichen der Zeit“, als „Partizipation“ an den Freuden und Hoffnungen, an der Trauer und den Ängsten einer unüberschaubaren Gegenwart. Alle natürlich notwendigen institutionellen Partizipationsregeln hätten dazu zu dienen, diese „Exposure-Partizipation“ zu ermöglichen.
Heutige Existenz ist notwendig prekär, denn in ihr treffen permanent, so Heinz Bude, standardisierte Erwartungen auf nichtstandardisierte Wirklichkeiten.31 Partizipation an dieser heutigen Existenz ist deshalb selbst eine prekäre und riskante Angelegenheit. Themen, die dies markieren, drängen sich auf: die Neuordnung der Geschlechterverhältnisse, die Globalisierung und ihre Konsequenzen für Migration, individuelle (auch religiöse) Sinnkonstruktionen, oder die Finanzwirtschaft, die Entbettung religiöser Traditionen aus ihren lokalen Herkunftskulturen und ihre Integration in die kapitalistische Verwertungsmaschinerie und überhaupt die Herrschaft eines zunehmend kulturell hegemonialen Kapitalismus.32 Der Habituswechsel für kirchliches Handeln, der dabei ansteht, ist fundamental. „Statt nur eine Kirche zu sein, die mit offenen Türen aufnimmt und empfängt, versuchen wir, eine Kirche zu sein, die neue Wege findet, die fähig ist, aus sich heraus und zu denen zu gehen, die nicht zu ihr kommen.“33 So hat das Papst Franziskus formuliert. Zu jenen zu gehen, die nicht kommen, und sie zu fragen, was sie brauchen, das ist die Partizipation, die ansteht.
Es ist eine existenzielle Partizipation, um die es geht. Genau genommen muss sie das Volk Gottes auch gar nicht lange suchen, denn es nimmt am Leben dieser Welt und dieser Zeit sowieso teil. Aber es muss diese Partizipation wollen, denn man kann sie verdrängen, als ob man auf einem anderen Stern leben würde. Wenn aber schon jene, die noch da sind, nicht interessieren, stirbt alle Hoffnung.
1 Vgl. etwa: HENZE, Barbara: „Die Laien als Feinde der Kleriker von alters her“? Zur Geschichte der Beziehung zwischen Laien und Klerikern, in: Georg KRAUS (Hg.): Wozu noch Laien? Für das Miteinander in der Kirche, Frankfurt/M. 2001, S. 69-102; BURKARD, Dominik: Laien im Kirchenregiment, in: Michaela SOHN-KRONTHALER/Rudolf HÖFER (Hg.): Laien gestalten Kirche. Diskurse, Entwicklungen, Profile, Innsbruck u. a. 2009, S. 221-239. Zur aktuellen kirchenrechtlichen Situation der „Laien“ in der römisch-katholischen Kirche siehe einerseits die recht pessimistische Darstellung von BIER, Georg: Strukturen der Mitwirkung in der römisch-katholischen Kirche, München 2016 (hg. von DER KIRCHEN VOLKSBEWEGUNG), andererseits die deutlich optimistischere Sicht von DEMEL, Sabine: Zur Verantwortung berufen. Nagelproben des Laienapostolats, Freiburg/Br. 2009.
2 Vgl. BURKARD, Laien im Kirchenregiment, S. 221.
3 Vgl. WOLF, Hubert: Krypta. Unterdrückte Traditionen der Kirchengeschichte, München 2015, S. 45-59.
4 HEIL, Christoph: Da ist weder Laie noch Kleriker, in: Michaela SOHN-KRONTHALER/Rudolf HÖFER (Hg.): Laien gestalten Kirche. Diskurse, Entwicklungen, Profile, Innsbruck u. a. 2009, S. 11-21, hier S. 21. Heil gibt den Konsens auch der katholischen neutestamentlichen Wissenschaft und Kirchengeschichtsschreibung wieder. Siehe etwa: SCHMELLER, Thomas/EBNER, Martin/HOPPE, Rudolf (Hg.): Neutestamentliche Ämtermodelle im Kontext, Freiburg/Br. u. a. 2010; HOFFMANN, Paul: Jesus von Nazareth und die Kirche, Stuttgart 2010; KÜGLER, Joachim: Jesus, der Kult und die Priester der Kirche, in: Wort und Antwort 46 (2005), S. 5-10.
5 GIELEN, Marlies: Die Wahrnehmung gemeindlicher Leitungsfunktionen durch Frauen im Spiegel der Paulusbriefe, in: SCHMELLER/EBNER/HOPPE, Neutestamentliche Ämtermodelle, S. 129-165, hier S. 163.
6 Ebd.
7 UNTERBURGER, Klaus: „Woher kommen die Streitigkeiten unter euch?“ (Jak 4,1). Entstehung und Geschichte der heutigen innerkatholischen Polarisierungen, in: Theologisch-praktische Quartalschrift 164 (2016), S. 4-12.
8 BURKARD, Laien im Kirchenregiment, S. 238.
9 Ebd. S. 239.
10 Vgl. PFLIEGLER, Michael: Pastoraltheologie, Freiburg/Br. u. a. 1962.
11 MAY, Georg: Der Gehorsam der katholischen Christen im Laien- und Priesterstand, in: http://www.priesternetzwerk.net/gfx/pdf/GEHORSAM%20_Prof.May.pdf [Zugriff: 22.08.2014].
12 Ebd. S. 7.
13 Ebd. S. 2.
14 Vgl. UNTERBURGER, „Woher kommen die Streitigkeiten unter euch?“, S. 6.
15 PFLIEGLER, Pastoraltheologie, S. 96.
16 HOFF, Johannes: Spiritualität und Sprachverlust. Theologie nach Foucault und Derrida, Paderborn u. a. 1999, S. 18.
17 Siehe dazu: BUCHER, Rainer: … wenn nichts bleibt, wie es war. Zur prekären Zukunft der katholischen Kirche, Würzburg 22012, S. 15-41.
18 Vgl. WARD, Pete: Liquid Church, Peabody (Mass.) 2002; WARD, Pete: Participation and Mediation. A Practical Theology for the Liquid Church, London 2008.
19 Siehe dazu jetzt die ungemein instruktive Meta-Studie POLLACK, Detlef/ROSTA, Gergely: Religion in der Moderne. Ein internationaler Vergleich, Frankfurt/M. 2015.
20 Vgl. SIEBENROCK, Roman: Vom langen Schatten Konstantins. Zur Archäologie theologischer Imaginationen am Beispiel absolutistisch-monarchischer Vorstellungen, in: Rainer BUCHER (Hg.): Nach der Macht. Zur Lage der katholischen Kirche in Österreich, Innsbruck 2014, S. 75-97.
21 Vgl. LOFFELD, Jan: Das andere Volk Gottes. Eine Pluralitätsherausforderung für die Pastoral, Würzburg 2011.
22 Siehe dazu den instruktiven Überblick von SPIELBERG, Bernhard: Ein Beschluss unter Beschuss. Die Beteiligung der Laien an der Verkündigung – und was daraus geworden ist, in: Reinhard FEITER/Richard HARTMANN/Joachim SCHMIEDL (Hg.): Die Würzburger Synode. Die Texte neu gelesen, Freiburg/Br. u. a. 2013, S. 56-78.
23 Vgl. BÖHNKE, Michael/SCHÜLLER, Thomas (Hg.): Gemeindeleitung durch Laien? Internationale Erfahrungen und Erkenntnisse, Regensburg 2011.
24 WELZER, Harald: Selbst denken. Eine Anleitung zum Widerstand, Frankfurt/M. 2013, S. 12f. Ich danke Hildegard Wustmans für den Hinweis auf dieses Buch und das Zitat.
25 Evangelii Gaudium, Nr. 222-224.
26 Ebd. Nr. 231-233.
27 Vgl. BUCHER, Rainer: Communio. Zur Kritik einer pastoralen Projektionsformel, in: Ulrich FEESER-LICHTERFELD/Reinhard FEITER (Hg.): Dem Glauben Gestalt geben [FS für Walter Fürst], Münster 2006, S. 121-134.
28 Siehe etwa FUCHS, Ottmar: Suche nach authentischen Erfahrungen. Volksbegehren zwischen völkischer Ideologie und volksbezogener Authentizität, in: „Wir sind Kirche“. Das Kirchenvolksbegehren in der Diskussion, Freiburg/Br. u. a. 1995, S. 101-110; BUCHER, Rainer: Hitlers Theologie, Würzburg 2008.
29 VATTIMO, Gianni: Glauben – Philosophieren, Stuttgart 2007, S. 54.
30 Vgl. die vielfältigen Analysen in: Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften 55 (2014), Themenheft „Menschenrechte in der katholischen Kirche“.
31 Vgl. BUDE, Heinz: Die Gesellschaft der Angst, Hamburg 2014.
32 Vgl. BUCHER, Rainer: Wenn man nicht mehr wirklich gebraucht wird. Die Kirche(n) in Zeiten des hegemonialen Kapitalismus, in: Ulrike BECHMANN/Rainer BUCHER/Rainer KROCKAUER/Johann POCK (Hg.): Abfall, Münster 2015, S. 31-47.
33 SPADARO, Antonio: Das Interview mit Papst Franziskus, Freiburg/Br. u. a. 2013, S. 49.