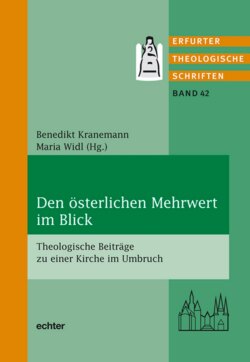Читать книгу Den österlichen Mehrwert im Blick - Группа авторов - Страница 10
VERTRAUEN: FUNDAMENT DER BEZIEHUNGEN
ZWISCHEN BISCHÖFEN UND THEOLOGEN
ОглавлениеKonrad Feiereis
Bei Jes 40,31 lesen wir: „Die aber auf den Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft, sie bekommen Flügel wie Adler. Sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und werden nicht matt.“
Paulus formuliert in Gal 6,8 einen seiner Grundgedanken wie folgt: „Wer […] im Vertrauen auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten.“
Marie von Ebner-Eschenbach schreibt in einem ihrer Aphorismen: „Vertrauen ist Mut und Treue ist Kraft.“ (Marie von Ebner-Eschenbach, 3)
Vertrauen gehört zu den höchsten Gütern unseres menschlichen Lebens. Vertrauen ist zuerst das Fundament unserer Beziehung zu Gott. In diesem Vertrauen aus unserem Glauben heraus besitzen wir zugleich Urbild und Vorbild für das Vertrauen zwischen uns Menschen. In herausragender Weise gilt das auch für das Verhältnis zwischen Bischöfen und Theologen in unserer Kirche in der heutigen Zeit.
Wir erleben gegenwärtig erhebliche Spannungen im Verhältnis zwischen Bischöfen und Theologen im deutschsprachigen Raum. Sie wurden besonders sichtbar anlässlich der Veröffentlichung des Memorandums von 144 Theologieprofessoren unter dem Titel „Kirche 2011: Ein notwendiger Aufbruch“. Die Diskussion darüber ist bis heute heftig und kontrovers, auf Seiten der Bischöfe wie der Theologen. Der erste eindrucksvolle Beitrag stammt von Hermann Josef Pottmeyer mit einer zum Nachdenken anregenden Analyse. Eine soeben erschienene Veröffentlichung setzt diese Diskussion in differenzierter Weise fort. Sie trägt den Titel des Memorandums und enthält zahlreiche „Argumente zum Memorandum“, so der Untertitel (hg. von Marianne Heimbach-Steins u.a.). Der erste Beitrag ist verfasst von dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch. Neben zahlreichen namhaften Theologen aus unserem Sprachraum ist auch unser Erfurter Kollege Benedikt Kranemann, Professor für Liturgiewissenschaft, mit einer Abhandlung vertreten.
Bereits am 30.11.2010 plädierte Bischof Joachim Wanke in einem Vortrag in der Katholischen Akademie in Berlin für eine neue „Glaubwürdigkeit“ unserer Kirche, welche „Bereitschaft zu Gespräch, Entschiedenheit“ und „Menschenfreundlichkeit“ aufweisen müsse. Er betont, dass ein „Drang zum Rechthaben“ zu „Parteiungen“ führe, an dessen Ende der Zerfall stehen könnte. Am Ende appelliert Bischof Wanke an seine Mitbrüder im Bischofsamt in eindrücklicher Weise u.a. dazu, „demütiger“ zu werden.
Aus langjähriger persönlicher Erfahrung heraus möchte ich einige konkrete Beispiele dafür nennen, wie die Beziehung zwischen den Bischöfen und den Theologieprofessoren in der Zeit der Ostzone bzw. der DDR charakterisiert werden kann: durch ein beide Seiten umfassendes Grundvertrauen.
Völlige Veränderung des eigenen Lebens
Am 1. September 1953 überschritt ich zum ersten Mal die Grenze, die beide deutsche Staaten voneinander trennte. Ich hatte meine theologischen Studien gerade abgeschlossen und mich – mit sechs anderen Klassenkameraden – zum Pastoralkurs im Bamberger Priesterseminar angemeldet. Da erhielt ich von meinem zuständigen Ordinarius aus Görlitz, Kapitelsvikar Piontek, die Aufforderung, den Pastoralkurs im Priesterseminar Neuzelle an der Oder zu absolvieren. Anfangs wehrte ich mich dagegen. Daraufhin erhielt ich aus Görlitz die Antwort: „Kommen Sie mit Vertrauen in unser heimatliches Priesterseminar Neuzelle.“ Ich fand mich am Ende meiner Bahnfahrt unter dem Ortsschild „Stalinstadt“, früher Fürstenberg, wieder, plötzlich hineingeworfen in eine völlig andere Welt, der größte Umbruch in meinem Leben nach der Flucht aus Schlesien. Bis zum heutigen Tage habe ich jedoch mein Leben im Osten Deutschlands nicht bereut. Ein Grundvertrauen hat mich stets getragen: Vertrauen auf die Vorsehung Gottes, aber auch Vertrauen in die Lenkung dieses Lebens durch die Kirche.
Vertrauen bestimmte die Tätigkeit in der Seelsorge
Von 1954 bis 1959 habe ich als Kaplan, von 1965 bis 1967 als Pfarrer im Jurisdiktionsbezirk Görlitz wirken dürfen. Im Rückblick auf diese Zeit bin ich noch immer darüber erstaunt, welche Verantwortung uns Seelsorgern übertragen wurde und welches Vertrauen uns entgegengebracht worden ist. Misstrauen oder Kontrolle erlebten wir nicht.
Die hl. Messe feierten wir in der brandenburgischen Diaspora auf Außenstationen, z.T. in den Klassenzimmern der kommunistischen Schulen, mit dem Anblick großer Fotos von Stalin und Ulbricht. Selbst ein Versehgang in das streng abgeschirmte NVA-Lazarett in Bad Saarow war möglich und für mich bis heute unvergessen, weil im Allgemeinen in diesem Umfeld die Spendung der hl. Sakramente undenkbar war.
Noch im Jahre 1957 hielt ich in Görlitz am Nachmittag Religionsunterricht in einem Klassenzimmer einer staatlichen Schule. Keiner unserer Vorgesetzten hätte uns Priester einer Kumpanei mit Vertretern des Staates verdächtigt: Diese unsere Oberen waren der bald zum Bischof ernannte Kapitelsvikar Piontek, sowie die Ordinariatsräte Theissing und Schaffran. Beide wurden ebenfalls später zu Bischöfen geweiht.
In der Stadt Görlitz gab es damals drei Kapläne. Wie veranstalteten im Katechetenseminar fröhliche Abende mit Tanz für die Jugend unserer drei Pfarreien, ohne jemals die dazu erforderliche staatliche Genehmigung einzuholen. Natürlich wussten wir, dass die gesamte Seelsorge, insbesondere die Jugendarbeit, von der Staatssicherheit scharf observiert wurde. Kein Bischof hat gegen unsere Arbeit jemals Bedenken geäußert. Ähnliches galt u.a. auch für große Treffen der Kolpingsvereine.
Zu den unvergessenen Erinnerungen gehören auch Abende oder Nächte, in denen bei uns zwei Kaplänen von Heilig Kreuz polnische Flüchtlinge vor der Tür standen. Sie waren durch die nahe gelegene Neiße geschwommen und baten um Hilfe, um Westberlin erreichen zu können. War der betreffende Flüchtling glaubwürdig, handelte es sich vielleicht um eine Falle? Wir Kapläne haben in etwa fünf Fällen geholfen und waren glücklich, wenn eine Karte mit unverfänglichem Text aus Westberlin das Gelingen der Flucht bestätigte.
In meiner Zeit als Pfarrer zwischen 1965 und 1967 beauftragte mich mein Bischof mit der Bildungsarbeit und der Akademikerseelsorge im Diözesanbezirk. Die Bildungsarbeit befasste sich hauptsächlich mit der Glaubenslehre unserer Kirche. Sie fand statt für die Pfarreien in Görlitz und Cottbus und für die Pfarrei Senftenberg und die Pfarrei Hoyerswerda. Sie wurde angeboten jeweils monatlich im Winterhalbjahr, unter in Kaufnahme von z.T. schwierigen Straßenverhältnissen. Die Aufgeschlossenheit unserer Gläubigen war in Senftenberg und Hoyerswerda, also in der tiefsten Diaspora, am größten. Dort hatte ich jeweils etwa 50 Zuhörer.
Über Vertrauen zwischen Bischöfen und Seelsorgern wurde nie gesprochen, es war selbstverständliche Grundlage unserer Beziehungen. Das gegenseitige Vertrauen wurde gelebt.
Das Vertrauen der Bischöfe in unsere wissenschaftliche Arbeit
Im Jahr 1967 durfte ich meine Lehrtätigkeit am Philosophisch-Theologischen-Studium Erfurt beginnen. Ich habe niemals erlebt, dass einer unserer Bischöfe unsere Arbeit als Lehrer für Philosophie und Theologie mit Misstrauen betrachtet hätte. Das Gleiche gilt für die Herausgabe unserer Theologischen Studien, unserer Theologischen Schriften, unseres Theologischen Jahrbuches und für die Herausgabe der exegetischen und pastoralen Schriftenreihen. Oft ergaben sich unermessliche Schwierigkeiten für die Drucklegung zwischen Verlag und staatlicher Zensur (Hübner 2010, 294–304). Das Vertrauen der Bischofskonferenz war so groß, dass sie die Erteilung des „Nihil obstat“ in die Verantwortung der Mitglieder unseres Professorenkollegiums legte.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass auch nur einer der von uns Professoren für einen Lehrstuhl vorgeschlagenen Kandidaten von der Bischofskonferenz abgelehnt worden ist. Sie entsandte Mitglieder unserer Konferenz zum Zweiten Vatikanischen Konzil und in die bis heute bedeutsame „Internationale Theologenkommission“, ebenso in zahlreiche wichtige philosophische und theologische Gremien, Konferenzen und Arbeitskreise. Besonders – für unseren damaligen gesellschaftlichen Kontext – der Erinnerung wert erscheint mir im Rückblick die Arbeit, die meine Kollegen vor allem in der Ökumene und in der Pastoral geleistet haben. Wir durften ferner viele der anerkanntesten deutschsprachigen Theologen – auf dem Weg einer privaten Einladung! – zu Gastvorlesungen bei uns begrüßen, von Professor Joseph Ratzinger bis hin zu Professor Johann Baptist Metz. Nach meiner Erinnerung gab es in unserem Kollegium nur ein einziges Mal keine Zustimmung für eine Einladung eines bekannten Tübinger Professors, weil wir fürchteten, dass durch diesen Besuch ein Zwiespalt mit unseren Bischöfen entstehen und Vertrauen zerstört werden könnte.
Gesellschaftliche Relevanz theologischen Wirkens
Der katholischen Kirche in der DDR wurde häufig zum Vorwurf gemacht, sie habe sich von der Gesellschaft abgeschottet und ein Binnendasein geführt. Im Vergleich zur evangelischen Kirche, die nach dem Krieg eine Volkskirche war, waren wir gewiss nur eine „kleine Herde“. Doch ist dieser Vorwurf gegenüber uns Katholiken nur zum Teil berechtigt. So lebten unsere Gläubigen mitten in einer sozialistischen Gesellschaft, wenn auch nicht gleichberechtigt, oft diskriminiert, aber sie waren präsent und bezeugten ihren Glauben. Ich möchte daran erinnern, dass alle Mitglieder unseres Professorenkollegiums in die Gesellschaft durch vielfältige theologische Arbeit hinein gewirkt haben: bei kirchlichen Veranstaltungen, in unseren Bildungshäusern, mit Vorträgen, durch Literatur und durch vieles andere mehr.
Für mich hatte zunächst die Pastoralsynode von 1973 bis 1975 in Dresden eine besondere Bedeutung. Die Diözesen wählten selbstständig ihre Kandidaten als Mitglieder diese Synode. Daneben wurden aber auch Teilnehmer aus überpfarrlichen und überdiözesanen Gremien delegiert; aus dem Philosophisch-Theologischen Studium und dem Priesterseminar waren es vier. Ich selbst wirkte in zwei Arbeitsgruppen als Berater mit. Die eine konzipierte einen Beschluss zu dem Thema „Der Christ in der Arbeitswelt“, die andere über den „Dienst der Kirche für Versöhnung und Frieden“. Leiter der Synode war Alfred Kardinal Bengsch. Ihm war es ein primäres Anliegen, jede Nähe zum Staat oder sozialistischen Gruppierungen zu vermeiden. Ein erster Entwurf des Beschlusses über die Arbeitswelt suchte – ohne mein Zutun – Gemeinsamkeiten zwischen Christen und Marxisten herauszuarbeiten. Kardinal Bengsch befürchtete Missverständnisse und Vereinnahmungen seitens des Staates. Er vertraute darauf, dass die zwei in dieser Arbeitsgruppe mitwirkenden Erfurter Professoren, Professor Wilhelm Ernst und meine Person, diesen Gefahren entgegenwirken würden. Unvergesslich bleiben mir die Diskussionen mit dem Kardinal bis in die Nachtstunden hinein. Wir mussten bei beiden genannten, sehr brisanten Themen eine Reaktion der staatlichen Stellen befürchten. Schließlich gelang es in der Arbeitsgruppe über den Christ in der Arbeitswelt, zwei sehr unterschiedlich argumentierende Richtungen der Synode zu einem veränderten Beschlusspapier zu bewegen, welches auf die Betonung einer Gemeinsamkeit zwischen Christen und Kommunisten verzichtete. In der damaligen Situation war es nicht möglich, Missstände in der DDR offen beim Namen zu nennen. Das hätte sofort zu Schikanen gegen unsere pastorale Arbeit geführt. Schwerpunkt war für uns die Darstellung eines christlichen Verständnisses von Arbeit. Es enthielt aber eine bis an die Grenze gehende indirekte Kritik an der herrschenden Ideologie mit ihrer Deutung von Leistung und Arbeit. Später wurde zwar öfter auf Defizite dieses Beschlusses hingewiesen, zugleich aber meistens zugestanden, die Synode habe versucht, das in dieser politischen Situation Mögliche zu sagen, ohne weitere Benachteiligungen für die Christen zu provozieren (Schumacher 1998, 181–193).
Der Beschluss „Dienst der Kirche für Versöhnung und Frieden“ kam ebenfalls erst nach heftigen, vielleicht noch schärferen Auseinandersetzungen zustande. Entwürfe von Gemeinden und Gruppen wollten dieses Thema mit anderen Fragen in Zusammenhang bringen, wie z.B. mit dem Thema „Jugendweihe“ oder mit dem Problem über das „Verhältnis zwischen Kirche und sozialistischem Staat“. Ein erster Entwurf wurde folglich vom Präsidium der Synode abgelehnt. Daraufhin bat mich Relator Pfarrer Bruno Diefenbach um eine Textvorlage aus eigener Feder. Zunächst lehnte ich diesen Wunsch ab, ich glaubte nicht, dieses Minenfeld heil durchschreiten zu können: Die DDR behauptete, sie sei ein Friedensstaat wie kein anderer. Sie missbrauchte ständig die Enzyklika „Pacem in terris“ von Papst Johannes XXIII. zur eigenen Rechtfertigung. Außerdem ging es in der DDR–Gesellschaft oft sehr unfriedlich zu: es gab keine Gleichberechtigung der Christen, keine Reise- und Pressefreiheit, die Militarisierung der Jugend wurde vorangetrieben u.a. Diefenbach überzeugte mich dann doch mit dem Argument, nur unsere Kirche könne im Ostblock – im Vergleich zu allen anderen sozialistischen Ländern – zu diesem Thema unseren christlichen Standpunkt öffentlich darlegen, für alle Kirchen in den anderen Ländern sei dies unmöglich; wir sollten also nicht schweigen. So habe ich einen Entwurf für eine Beschlussvorlage konzipiert, die zwar Korrekturen erfuhr, wesentliche gesellschaftliche Themen aussparen musste, doch im Wesentlichen konsensfähig war und schließlich von der Synode verabschiedet wurde. Bischof Hugo Aufderbeck hat sich in hervorragender Weise als Vermittler zwischen den gegensätzlichen Strömungen bewährt. (Schumacher 1998, 194–208)
Schon damals erlebte ich Kardinal Bengsch als eine herausragende Persönlichkeit. Im Rückblick aus unserer Gegenwart heraus wird immer deutlicher, wie sehr ihn Klarsicht und Willensstärke auszeichneten. Sein übergeordnetes Ziel war die Einheit unserer Kirche. Tendenzen von einzelnen Persönlichkeiten oder Gruppen, mit dem Sozialismus damaliger Prägung zu paktieren, widersprach er mit Entschiedenheit. Sein Vertrauen in die theologische Arbeit unseres Professorenkollegiums bildete die wesentliche Grundlage unserer Lehrtätigkeit. Er holte auch während der Synode häufig den Rat der Vertreter aus der Erfurter Priesterausbildung ein und führte – bei all seinem Berliner Temperament – stets eine sachliche Diskussion. Nicht selten kam es zu Gesprächen zwischen einzelnen Kollegen von uns in seiner Berliner Wohnung. Er suchte oft unseren Rat. Unvergessen bleibt mir, wie der Kardinal vor einem Gespräch, zu dem er mich gebeten hatte, das Radio einstellte. Dieses Vorgehen hatte einen makabren Hintergrund: man hatte zuvor seine Räume mit Abhörwanzen bestückt. Alle Welt erfuhr von diesem Schurkenstück sofort nach dessen Entdeckung. Kardinal Bengsch habe ich als einen klugen Seelsorger, Hirten und Kirchenpolitiker in Erinnerung, aber auch als mitunter eigenwilligen Theologen. Das wurde besonders deutlich in seiner Ablehnung der Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“. Wir Theologen fühlten uns, so glaube ich sagen zu dürfen, unter seiner Führung geborgen und in Sicherheit, besonders vor staatlichen Einmischungsversuchen und Repressionen, seien sie gegen einzelne Persönlichkeiten oder gegen unser Philosophisch-Theologisches Studium beabsichtigt gewesen.
Die Ökumenische Versammlung für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung fand in der DDR 1988/89 statt. Heute wird weithin anerkannt, dass sie wesentlich dazu beigetragen hat, Fehlentwicklungen in unserer Gesellschaft aufzudecken und bewusst zu machen. Die Perestroika-Politik Gorbatschows hatte bereits damit begonnen, die Versteinerungen des kommunistischen Sozialismus zu sprengen. Es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass dieses große, einmalige ökumenische Ereignis wesentlich zum Verschwinden der DDR beigetragen hat. Die katholische Kirche erklärte sich erst nach langem Zögern am 1. / 2. Dezember 1987 zur vollen Teilnahme bereit. Die Eröffnung fand bereits am 12. Februar 1988 statt. Das lange Zögern der Bischöfe erklärt sich aus ekklesiologischen und politischen Bedenken. (Seifert 2000, 112) Träger der Vollmitgliedschaft unserer Kirche waren 26 Delegierte, fast ausschließlich aus der Gruppe „Justitia et Pax“, die durch Joachim Kardinal Meisner eine offizielle Beauftragung erhielten. Wiederum wurde seitens unserer Bischöfe an Professoren aus dem Erfurter Studium ein wichtiger Auftrag erteilt: Sie sollten die katholische Theologie in der Ökumenischen Versammlung vertreten, ein Beweis großen Vertrauens. Lothar Ullrich urteilt wie folgt: „Es war ganz wichtig, weil die Mitglieder unserer katholischen Arbeitsgruppe ´Justitia et Pax` weithin als ein ausgleichendes Element in den Versammlungen und Kommissionen empfunden wurden. Wir haben die Mitte stark gemacht.“ (Seifert 2000, 105) Unsere Mitarbeit vollzog sich vor allem in der Arbeitsgruppe „Theologische Grundlegung“. Innerhalb der evangelischen Kirche gab es Tendenzen, den christlichen Glauben mit einem „ursprünglich idealen Verständnis von Sozialismus“ zu verknüpfen, gleichsam einen dritten Weg unter Distanz zum real existierenden Sozialismus zu beschreiten. Dieses Anliegen vertrat besonders Propst Heino Falcke, der sehr nachdrücklich das Ziel verfolgte, die DDR-Gesellschaft umzugestalten. Dadurch zog er sich den Hass der Kommunisten zu. (Seifert 2000, 107f) Ich selbst vertrat die Ansicht, unterstützt von Lothar Ullrich, dass der real existierende Sozialismus in der DDR nicht reform- und verbesserungsfähig sei, denn sein dem Christentum im innersten Kern widersprechendes Menschenbild sollte nach Ansicht der Kommunisten keinesfalls preisgegeben werden.
Unsere Bischöfe nahmen alle zwölf Beschlüsse der Ökumenischen Versammlung einhellig und ohne Widerspruch an. Eine ausführliche Beurteilung dieses Ereignisses habe ich in einem anderen Zusammenhang zu geben versucht. (Seifert 1999, 103–111) Widerstand gegen die Ökumenische Versammlung war nur bei wenigen Christen in der DDR festzustellen, hingegen aber bei engen Mitarbeitern der Berliner Bischofskonferenz. Sie lehnten die Ökumenische Versammlung bis über das Ende der DDR hinaus entschieden ab. Man scheute in diesem Kreise auch nicht vor einer Herabsetzung meiner Person vor dem Staatssekretär für Kirchenfragen zurück. Es fiel die vom Staatssekretariat dokumentierte Formulierung, die Ökumenische Versammlung wie auch meine Person hätten „Phantastereien“ verbreitet und die Bischöfe stünden nicht hinter mir. Man grenzte mich damit aus unserer Kirche aus. Solches Verhalten eines Mitbruders hat bei mir bis heute Wunden hinterlassen.
Ein anderes Erlebnis am Rande: In der Nacht zum 1. Mai 1989, nach dem feierlichen Abschluss der Ökumenischen Versammlung in der Dresdener Kreuzkirche, stellte bei der Heimfahrt ein Tankwart fest, dass die Benzinleitung an meinem Wartburg angesägt war. Zufall?
Besondere persönliche Erfahrungen
Veranstaltungen: Mitglieder unseres Kollegiums wurden häufig als Einzeldelegierte aus unserer Kirche zu internationalen Veranstaltungen entsandt. Ich selbst denke hier zunächst an das „Internationale Wissenschaftliche Kolloquium“ vom 8. bis 10. Oktober 1986 in Budapest zurück. Es wurde veranstaltet vom Päpstlichen Sekretariat für die Nichtglaubenden und der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Von katholischer Seite nahmen teil die Kardinäle König und Poupard (als neuer Präsident) und Theologen aus acht europäischen Ländern. Die marxistische Seite hatte Vertreter aus neun europäischen Ländern und aus Kuba delegiert. Es ist als das „größte und bedeutendste Dialogtreffen zwischen Vertretern der katholischen Kirche und des Kommunismus in die Geschichte eingegangen“. (Christen und Marxisten 1991, 317) Dort bin ich, der zum Konsultor des Päpstlichen Sekretariates berufen worden war, zum ersten Mal zwei marxistischen Philosophieprofessoren aus der DDR begegnet. Zwischen unserer Theologischen Fakultät und den philosophischen Lehrstühlen der Universitäten, die ja nur von Kommunisten besetzt waren, gab es zu keiner Zeit irgendeinen Kontakt. Alle Vorträge dieses Dialogtreffens sind u.a. vom Bennoverlag dokumentiert worden (Christen und Marxisten 1991, 317–374). Ich durfte einen Vortrag halten über das Thema „Zusammenleben und Kooperation von Christen und Marxisten in der Gesellschaft“. (Feiereis 1991, 357–371)
In der DDR erregte dieses Treffen große Aufmerksamkeit. In katholischen und evangelischen Kirchen, z.B. in Dresden, Karl-Marx-Stadt, Leipzig, Erfurt und anderswo fand ich bei Vorträgen volle Kirchen vor. Die Christen spürten, dass die alten Verhältnisse in der Gesellschaft keine Zukunft mehr besaßen. Sie schöpften z.T. Hoffnung, dass ihre Situation sich im Alltag verbessern könnte und auch müsste.
Ein zweites Kolloquium verdient ebenfalls Erwähnung: Es fand vom 18. bis 21. Oktober 1989 zwischen dem Vatikan, unter der Leitung von Kardinal Poupard, und dem „Sowjetischen Komitee für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“ in einem kleinen Kreis in der Nähe von Straßburg, statt. Zu diesem „Komitee“ gehörten u.a. der Chefredakteur der Zeitschrift „Kommunist“ und der Direktor des „Atheismus-Instituts beim Zentralkomitee der KPdSU“. Ziel dieses Treffens war die Vorbereitung des ersten Besuches von Gorbatschow bei Papst Johannes Paul II., der dann auch am 1.12.1989 stattgefunden hat. Ich erinnere mich, dass unsere sowjetischen Partner in der Nacht vom 18.10. zum 19.10. äußerst aufgeregt waren und ständig mit Moskau telefonierten. Der Grund: Honecker war an diesem Tag gestürzt worden. Auch vor diesem Gremium durfte ich, als einziger deutscher Theologe, ein Referat halten, das den Titel trug: „Das gemeinsame europäische Haus.“ (Feiereis 1990, 41–47)
Das Vertrauen unserer Bischöfe hat mich, der nicht gern im Rampenlicht stand, zu diesen wichtigen Veranstaltungen entsandt. Ich erlebte unmittelbar den Beginn des bald einsetzenden großen politischen Erdbebens, das kurz danach unsere Welt veränderte.
Große Verantwortung wurde mir auch in anderen Bereichen übertragen. Ich wurde für fünf Jahre zum kirchlichen Hilfswerk Renovabis delegiert, wo ich bei der ersten Tagung das Einleitungsreferat halten durfte. Ich habe ferner manche Einweihungsrede gehalten, so bei der Eröffnung der Edith-Stein-Schule Erfurt 1992 oder anlässlich der Gründung der Katholischen Fachhochschule Berlin 1991. Das in dieser Weise bezeugte Vertrauen wurde auch in gleicher Weise allen meinen damaligen Kollegen entgegengebracht.
Spannungen: Auch in unserer kleinen Kirche blieb es nicht aus, dass es Unterschiede der Ansichten und auch Auseinandersetzungen gab. Das äußerte sich besonders im Jahr 1989 als es um die Frage ging, ob sich auch unsere Kirche den Problemen der Gesellschaft mehr öffnen sollte. Sie hat es schließlich auch getan, wie die Hirtenbriefe und Predigten jenes Herbstes dokumentieren, darunter besonders auch die unvergessliche Predigt von Bischof Wanke anlässlich der Herbstwallfahrt in Erfurt am 17. September 1989. Meinungsverschiedenheiten zwischen Bischöfen und Theologen wurden nicht verleugnet, aber fair ausgetragen und nie nachgetragen.
Mir persönlich bleibt schmerzlich in Erinnerung, dass einige meiner Publikationen, die bereits im Westen Deutschlands (Herderkorrespondenz), aber auch in Italien und in der Slowakei erschienen waren (darunter u.a. mein Budapester Vortrag), nicht nur vom Staat, sondern auch von kirchlichen Dienststellen von vornherein für den Druck abgelehnt worden sind. Man unternahm nicht einmal den Versuch, die staatliche Genehmigung für eine Veröffentlichung einzuholen. Die Begründung lautete, die Zeit sei dafür noch nicht reif. (Jahrbuch 1991, 15, vgl. 307–371)
Begegnungen: Unsere Bischöfe pflegten ein ständiges, oft freundschaftliches Verhältnis zu den Mitgliedern unserer Professorenkonferenz. Sie zogen uns heran bei der Abfassung von gesellschaftlich relevanten Hirtenbriefen (besonders über Erziehung, über Frieden u.a.) Unvergesslich in Erinnerung bleibt mir Bischof Hugo Aufderbeck, dem die Situation der Christen bei uns ein Herzensanliegen war. Er suchte stets unsere Mitarbeit in der Seelsorge. Auf seinem Sterbebett rief er uns Priester zu sich und bat um die Zelebration der hl. Messe und um das gemeinsame Gebet.
Kardinal Meisner, mit welchem ich einmal einen größeren Disput hatte, der aber fair beigelegt wurde, zog mich heran zu einem wichtigen Dienst anlässlich des Katholikentreffens in Dresden am 12. Juli 1987. Dort sprach er auch das Wort, das in die Geschichte eingegangen ist: „Die Kirche, die Christen in unserem Land möchten ihre Begabungen und Fähigkeiten in unsere Gesellschaft einbringen, ohne dabei einem anderen Stern folgen zu sollen als dem von Bethlehem.“
Natürlich stand und steht unsere Erfurter Fakultät in einer besonderen und engen Beziehung zu unserem Jubilar Bischof Wanke. Er ist nicht nur unser Ortsbischof und Kanzler der Fakultät, er war ja ehemals auch Professor in unserem Kollegium. Seine freundliche, gewinnende Art, seine für die gesamte deutsche Kirche richtungweisenden pastoralen Anstöße sind hochgeschätzt und geachtet. Er verfolgt wachen Geistes die Entwicklungen in Kirche und Gesellschaft. Er ist stets Theologe und Seelsorger zugleich geblieben. Das Vertrauen, das er den Menschen allgemein und unserem Kollegium besonders entgegengebracht hat, trug von Anfang an reiche Frucht und wird seiner Person gegenüber in Dankbarkeit erwidert.
Zurück zum Ausgangspunkt: Im Blick auf die heutige Situation der Kirche in der Bundesrepublik lassen sich einige Analogien zu unserer damaligen Situation herstellen, auch wenn die äußeren Bedingungen völlig verschiedenartig waren und sind. Angesichts einer sich ausbreitenden Kirchenferne und atheistischer Strömungen sollten partikuläre Interessen einzelner Gruppen zweitrangig sein. Bischöfe und Theologen sind auf einander angewiesen. Will sich ein einzelner oder eine Gruppe abseits der Gemeinschaft der Kirche profilieren, so gereicht es dieser unausweichlich zum Schaden. Bischöfe und Theologen haben ein gemeinsames und höheres Ziel, das sie verbindet. Das Fundament dafür ist ein Grundvertrauen zueinander.
Literatur
Ebner-Eschenbach, M. v., Aphorismen, Schriften Bd. 1, Berlin 1893, 3.
Feiereis, K., Das gemeinsame europäische Haus. Bereiche der Zusammenarbeit zwischen Ost- und Westeuropa, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 5. 1990, 411–421 (vgl. mein Literaturverzeichnis: http://www2.unierfurt.de/tiefensee/feiereis.htm).
Feiereis, K., Zusammenleben und Kooperation von Christen und Marxisten in der Gesellschaft, in: Theologisches Jahrbuch 33, 1991, 357–371.
Hübner, S., Das Theologische Jahrbuch des St. Benno-Verlags. Vergessene Seiten im Überleben der katholischen Kirche in der ehemaligen DDR, in: Theologie der Gegenwart 53, 2010, 294–304.
Theologisches Jahrbuch 1991. Unter kommunistischer Zensur. Hg. v. Wilhelm Ernst u. a. Leipzig 1992.
„Kirche 2011: Ein notwendiger Aufbruch“. Argumente zum Memorandum. Hg. v. Marianne Heimbach-Steins [u. a.], Freiburg i. Br. 2011.
Schumacher, R., Kirche und sozialistische Welt. Eine Untersuchung zur Frage der Rezeption von „Gaudium et spes“ durch die Pastoralsynode der katholischen Kirche in der DDR, Leipzig 1998 (Erfurter Theologische Studien 76).
Seifert, K., Glaube und Politik. Die Ökumenische Versammlung in der DDR 1988/89, Leipzig 2000 (Erfurter Theologische Studien 78).
Seifert, K., Durch Umkehr zur Wende. Zehn Jahre „Ökumenische Versammlung in der DDR“ – Eine Bilanz, Leipzig 1999.