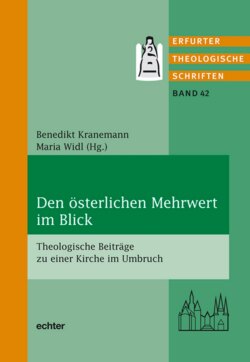Читать книгу Den österlichen Mehrwert im Blick - Группа авторов - Страница 9
ISRAEL UND DIE VÖLKER IN JES 2,1–5.
EIN MODELL FÜR DIE SELBSTBESINNUNG DER KIRCHE?
ОглавлениеNorbert Clemens Baumgart
Hinführung
Wenn demnächst eine repräsentative Umfrage in Deutschland dazu auffordern würde, innerhalb des folgenden Textes die gegenwärtig bekannteste Formulierung zu benennen, welches Ergebnis wird man erwarten dürfen?
1 Das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amoz, über Juda und Jerusalem schaute.
2 Es wird geschehen in zukünftigen Tagen:
Fest wird stehen der Berg des Hauses JHWHs
an der Spitze der Berge, er überragt die Hügel.
Alle Nationen werden zu ihm strömen,
3 viele Völker werden hingehen und sagen:
„Kommt doch, lasst uns hinaufziehen zum Berg JHWHs,
zum Haus des Gottes Jakobs.
Er lehre uns von seinen Wegen,
dass wir gehen in seinen Pfaden.“
Ja, von Zion wird Weisung ausgehen
und das Wort JHWHs von Jerusalem.
4 Er wird richten zwischen den Nationen
und zwischen vielen Völkern schlichten.
Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden,
ihre Lanzen zu Winzermessern.
Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben,
noch werden sie ferner das Kriegshandwerk lernen.
5 Haus Jakob, kommt doch, lasst uns gehen im Licht JHWHs! (Jes 2,1–5)
Man darf wohl auf die Formulierung „Schwerter zu Pflugscharen“ tippen. Die Formulierung dürfte selbst Zeitgenossen bekannt klingen, denen die Bibel eher unbekannt ist. Denn die Formulierung ist vor nicht allzu langer Zeit zu einem Slogan aufgestiegen und hat eine beeindruckende Wirkungsgeschichte entfaltet. Wie war es dazu gekommen?
Eine Skulptur trug dazu bei. Der sowjetische Bildhauer Ewgenij Viktorowitsch Wutschetitsch (1908–1974) hatte die Skulptur angefertigt: Ein Mann schmiedet ein Schwert in eine Pflugschare um. 1957 kam diese Skulptur als Geschenk der UdSSR an die UNO nach New York. Dort aufgestellt, führte das Werk zu Reaktionen, die von den Schenkenden vermutlich gar nicht beabsichtigt worden waren. Angesichts militärischer Hochrüstung sowie düsterer großpolitischer und gesellschaftlicher Erfahrungen wurde die Skulptur als eine Verdichtung von Hoffnungen gedeutet und angenommen. Das geschah von Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre an vor allem in der Friedensbewegung der DDR, die in Teilen auch christlich geprägt war. Die Skulptur wurde auf einem Kreisrund als Bild wiedergegeben. Das Bild wurde zudem im Kleinformat auf Stoff geprägt, um es auf Bekleidungsstücke aufnähen zu können. Das Bild unterlegte man mit der Formulierung „Schwerter zu Pflugscharen“. Das Wort war für viele zum Motto ihrer Einstellung und Erwartung geworden. Das Bild und das Motto wurden auch schnell im Westen Deutschlands bekannt.
Das Bild enthielt von Anfang an einen Hinweis auf die Bibel: „Micha 4“. Der Hinweis hätte ebenso „Jesaja 2“ lauten können. Die beiden Abschnitte Jes 2,1–5 und Mi 4,1–5 sind im Wortlaut sehr ähnlich.
Die hier skizzierte Wirkungsgeschichte kennt also ein inspirierendes und beflügelndes Potential, das man dem alttestamentlichen Text zu entnehmen vermochte. Aber nicht nur die Wirkungsgeschichte ist interessant.
Beachtenswert sind auch die Funktionen, die der Abschnitt 2,1–5 innerhalb des Buches Jesaja übernimmt. Dem wird dieser Beitrag nachgehen. Der Abschnitt Jes 2,1–5 übt eine Art Signalfunktion für den Lesegang durch das Prophetenbuch aus. Diese Signalfunktion entsteht aber erst dadurch, dass der Abschnitt zusammen mit den Texten, die ihm vorausgehen, eine Spannung aufbaut.
Ein erster Pol, durch den die Spannung entsteht, ist leicht einsichtig und ergibt sich aus dem Gedanken in Jes 2,1–5, dass eine künftige Wallfahrt der Völker zum Zion, nach Jerusalem, die Lage auf der Welt deutlich verbessern könnte. Dabei würden global die Grundlagen für Krieg und Zwist abgeschafft werden und verschwinden – ein kühner Gedanke im antiken Buch Jesaja, dessen Entstehung sich vom 8. Jh. bis zum 4. Jh. v. Chr. erstreckte. Allseits würde Frieden einkehren.
Der andere Pol, der zur Spannung beiträgt, wird erst deutlich, wenn man das erste Kapitel des Jesajabuches als Hintergrund hinzunimmt. Am Anfang des Buches steht es innerhalb der Gemeinschaft am Zion und in Jerusalem offenkundig nicht zum Besten. Der Anfang des Buches muss bei der Gemeinschaft Desiderate feststellen. Die Gemeinschaft folgt nicht ihren religiösen und gesellschaftlich-politischen Idealen und Satzungen, sondern verkehrt diese Ideale und Satzungen eher in ihr Gegenteil. Die Desiderate haben bereits zu fatalen Schlägen und zu Verlusten für die Gemeinschaft geführt und könnten noch weitere, ähnliche Folgen für sie heraufbeschwören.
Die Spannung, die sich aus diesen beiden Polen ergibt, ruft im Jesajabuch eine eindringliche Fragestellung hervor: Wird die in Aussicht gestellte, erstrebenswerte Zukunft der Völker von der Gemeinschaft am Zion und in Jerusalem als etwas für sie Relevantes angenommen werden? Wird sie ihr Verhalten lenken können?
Diese Spannung im Jesajabuch lädt letztendlich die Größe „Jerusalem und Juda“ ein, sich ihrer Rolle und Verantwortung in der Welt der Völker bewusst zu werden. Verkehrungen im Innenbereich sind eine schmerzliche und beklagenswerte Sache. Aber das Jesajabuch bleibt dem kleinen Innenbereich und dessen Mängeln nicht verhaftet, sondern bietet eine Art Selbstbesinnung anhand einer geweiteten Perspektive an. In der Besinnung reicht es nicht aus, nur auf sich selbst zu starren wie auf einen isolierten Binnenzirkel. Vielmehr ist es nötig, die förderliche und die fordernde Verwobenheit in die breite Völkerwelt in den Blick zu nehmen. Dieser neue, weite Blick über den Innenraum hinaus kann vielleicht eine Motivation dafür liefern, die eigene Lebensführung zu überdenken und neu zu gestalten.
Wie das konkret in den Texten und im Buch aussieht, sei nun dargestellt. Zu beginnen ist mit dem oben schon zitierten Abschnitt Jes 2,1–5.
Die Völker kommen
Die zweite Überschrift im Prophetenbuch, Jes 2,1, wirkt wie eine kommentierende Stimme. Die Stimme stellt die Lektüre des Abschnittes 2,1–5 unter eine Regieanweisung. Was in diesem Abschnitt zu vernehmen ist, gehört zu „dem Wort“, welches Jesaja geschaut hat und welches sich auf die Zweiheit „Juda und Jerusalem“ bezieht. Beide Namen benennen Themen, die das Buch Jesaja durchziehen („Juda“ bis 65,9; „Jerusalem“ bis 66,20). Das Übergreifende im Buch gilt es zu beachten. Zwar wird unser Abschnitt nur „Jerusalem“ (vgl. 2,3) erwähnen und das ansprechen, was mit diesem Stadtnamen eng verbunden ist. Aber dem stellt die Überschrift 2,1 Signale voran, die sich an die erste Überschrift im Buch anlehnen (1,1). Die erste Überschrift bezieht sich auf das ganze Buch. Somit sind die wallfahrenden Völker zusammen mit dem wahrzunehmen, worum es der prophetischen Schrift laut ihrer ersten Überschrift insgesamt auch geht: Jesajas Vision über „Juda und Jerusalem“ (1,1). Wenn im Buch erstmals der Abschnitt 2,1–5 eine Wallfahrt der Völker zum Zion schildert, will die Schilderung anscheinend als eng auf das Buch bezogen wahrgenommen werden, und zwar derart, dass die Wallfahrt der Völker für die Konzepte im Buch bedeutsam ist. Juda und Jerusalem werden mit den Völkern konfrontiert. Man kann auch sagen: Die für das Buch ausschlaggebende theologische Größe „Israel“ wird auf die Völker bezogen.
Von Jes 2,2 an kommt der literarische Prophet Jesaja sozusagen selbst zu „Wort“. Seine Stimme ist jetzt im Text zu vernehmen. Sofort richtet Jesaja seinen Blick auf die „zukünftigen Tage“. Er denkt dabei an keine jenseitige Ära, die erst nach dem Abbruch der Geschichte eintreten würde. Jesaja versteht die kommenden Tage und das, was sich an ihnen ereignen wird, binnengeschichtlich. Jesaja rechnet damit, dass Völker in die Stadt Jerusalem kommen werden. Aber es gibt noch einen zeitlichen Spielraum, bevor die Völker herbeiströmen. Dieser Spielraum wird für Jesaja noch wichtig werden.
Jesaja ordnet das Kommen der Völker in eine hintergründige Topographie ein. Die Topographie stimmt nicht überein mit unserer Kenntnis über die faktische Lage der Stadt Jerusalem, über ihr Höhenniveau im Verhältnis zum Umland. Aber das Landschaftsbild, letztlich die Weltlandschaft, wird während des Kommens der Völker verwandelt sein. Das kontrafaktische Landschaftsbild hebt theologisch-konzeptionell auf die einmalige Bedeutung „des Berges des Hauses JHWHs“, des Zions, und von Jerusalem ab. Dieser Berg werde einst eine Festigkeit in der Schöpfung besitzen, er sei dann zugleich der höchste der Berge, und kein Hügel erreiche seine Höhe. Diese metaphorische Erhöhung Zion-Jerusalems wird mit der Aufwärtsbewegung der Völker zu dieser Stätte einhergehen: Sie werden „hinaufziehen“ wollen (Jes 2,3). Diese Aufwärtsbewegung der Völker schließt den Aspekt mit ein, dass die Völker solch „göttliche“ Höhe nicht mehr bei sich und in ihrem Umfeld werden finden können. Die Antike verband oft Götter und Berge, wobei die „Höhenverhältnisse“ Religiös-Theologisches zum Ausdruck brachten. Das Jesajabuch wird später – insbesondere ab Kapitel 40 – noch ausweisen, dass sich die Götter der Völker in der Geschichte als Nichtse entpuppen und dass sich Israels Gott JHWH allein als wahrhafte Gottheit erweist. Das klingt bereits in Jes 2 verhalten an. Die Völker werden schon vor ihrer Wallfahrt einsehen, dass ihnen Göttliches sowie göttliche Belehrung und Hilfe in der eigenen Umgebung und in dem ihnen sonst Zugänglichen entschwand, wohl aber in Zion-Jerusalem zu finden sein wird und dort als Geschenk entgegen genommen werden kann.
Das attraktive, anziehende Zion-Jerusalem mit JHWHs Wohnung in der Welt wird noch vor der Ankunft der Völker eine erste, einstweilen noch provisorische Einigung unter ihnen herbeiführen. Jesaja gibt die künftigen Worte der Völker wieder und zitiert sie. Sie werden sich gemeinsam in vereinter Rede bekunden können. Zuerst werden sie sich auf eine Absicht geeinigt haben, und zwar auf ihre gemeinsame Wallfahrt: „Kommt doch, lasst uns hinaufziehen zum Berg JHWHs, zum Haus des Gottes Jakobs“ (Jes 2,3). JHWH wird für die Völker zugleich der Gott von Israels Erzvater Jakob sein. So werden die Völker auch etwas von der Geschichte JHWHs mit Israel mitbekommen haben und damit davon, wie sich JHWH über die Zeiten hin anhand von Jakob-Israel in der Welt kundgemacht hat. Die Völker werden erahnen, wer als der eine und einzige Gott im Tempel auf dem aufgesuchten Zion präsent ist. Aufgrund des Erahnten werden die Völker von JHWH Orientierung erwarten, und sie werden sich daran auch halten wollen. Denn in ihren Worten sind sie davon überzeugt, von JHWH unterwiesen zu werden, und sie erklären zudem gemeinsam ihre Bereitschaft, seiner Unterweisung zu folgen: „Er lehre uns von seinen Wegen, und wir wollen gehen auf seinen Pfaden (2,3).“ Mit der für die Bibel typischen Wegmetaphorik wird hier ein Verhalten angesprochen, welches im göttlichen Belehren vorgezeichnet und dann in lernbereiter Folgsamkeit der Völker vollzogen werden wird.
Danach übernimmt wieder Jesaja das Wort. Dem Strömen, Gehen und Hinaufziehen der Völker zum „Berg des Herrn“ stellt er eine Gegenbewegung gegenüber: „Ja, von Zion geht Weisung aus und das Wort JHWHs von Jerusalem (Jes 2,3).“ Von zentraler Bedeutung ist der Begriff „Weisung“, hebräisch „Tora“, der kurz zuvor vorbereitet wurde durch das wurzelgleiche Verb „lehren“. Zwölfmal taucht der Begriff „Tora“ im Buch Jesaja auf (von Jes 1,10 bis 51,7) und damit vielleicht nicht rein zufällig in einer biblisch bedeutsamen Anzahl. Steht hier in Jes 2 die Tora in Parallele zum „Wort JHWHs“, dürfte Jesaja an keine feststehenden Tora-Gebote denken, sondern an eine durch das aktuelle Wort Gottes neu unterbreitete Tora. Jedenfalls wird die Tora den Völkern nicht verborgen bleiben, sondern die Tora wird sich aktiv den Völkern zuwenden.
Jesaja entfaltet keine konkreten Inhalte des JHWH-Wortes, dafür aber den Zweck, wozu das göttliche Wort ergeht. Der Zweck besteht keineswegs darin, dass JHWH zum Strafgericht über die Völker anhebt. Er wird nicht „über“ dieses oder jenes Volk richten. Vielmehr wird JHWH „zwischen“ den Völkern richten. JHWH wird sich ihres Zusammenlebens und Miteinanders annehmen, für gerechte Rechtssprechung eintreten und auf diese Weise unter ihnen Schlichtung bewirken: „Er wird richten zwischen den Nationen und zwischen vielen Völkern schlichten (Jes 2,4).“
Wird JHWH so die Angelegenheiten der Völker auf gerechte Weise entschieden haben, kommt es sodann unter den Völkern zu einem erstaunlichen Selbstlauf. Jesaja wendet sich mit poetisch dichten Worten diesem Selbstlauf zu, und dabei folgt nun die Formulierung, deren eindrückliche Wirkungsgeschichte im 20. Jahrhundert eingangs skizziert wurde: „Schwerter zu Pflugscharen“. Die Völker werden – so darf man meinen – wieder nach Hause reisen und dort eine so genannte „Rüstungskonversion“ vernehmen. Die teuren Materialien für Waffen und ihre aufwendigen Herstellungen hatten schon in der Antike wertvolle Ressourcen der Völker gebunden, die ihnen so für andere Entwicklungen und vielleicht sogar auch für soziale Aufgaben fehlten. Der Sinn des Verses 2,4 würde verkannt werden, wenn man ihn nur als romantische Idylle abtut. Der Vers befasst sich vielmehr mit dem, worauf kollektive Energien mit weitreichenden sozial-gesellschaftlichen und politischen Folgen ausgerichtet sein können. Was die Völker an Bodenschätzen in der Welt vorfinden und was ihnen an Potentialen selber zueigen ist, wird nicht mehr für Abschreckungen vergeudet oder für Eroberungen und Vernichtungen eingesetzt werden („Schwerter“, „Lanzen“), sondern wird der Ernährung dienen und das tägliche Arbeiten erleichtern dürfen („Pflugscharen“, „Winzermesser“). Doch damit nicht genug. Mit den abhandengekommenen Waffen wird auch selbstredend das Lernen und Einüben ihrer Anwendungen verschwinden: „Und sie werden ferner nicht mehr den Krieg erlernen (Jes 2,4).“ Der Prophet Jesaja rechnet somit mit einem Pazifismus, der in Zukunft möglich werden kann.
Die Grundlagen für diese kühne und hoffnungsvolle Aussicht im Jesajabuch sind zu beachten. Keine rein innerweltlichen Bestrebungen werden die neue und allseits friedliche Lage herbeiführen können. Menschliche Bemühungen allein werden das in Aussicht Gestellte nicht herbeizwingen können. Zuerst werden mittels der Tora und durch JHWH selbst Recht geschaffen und Schlichtungen herbeigeführt werden müssen, bevor die Konversionen der Rüstungsgüter erfolgen und die alten Gewohnheiten, das Kriegshandwerk zu lernen, enden. Beide, JHWH und auch seine Tora, werden Initiatoren jenes manifesten Friedens sein, in dem sich erst die Waffen und das Kriegshandwerk erübrigen werden. Die Völkerwelt wird keinen Frieden „machen“, sondern einen solchen geschenkt bekommen. Die Völker werden friedlich agieren, nachdem sie „von oben“ her und ohne Gewalteinwirkung befriedet worden sind.
Der Abschnitt endet auf eine beachtenswerte Weise und gelangt im Vers 2,5 an sein Ziel. Jesaja hat in diesem Schlussvers immer noch das Wort. Doch Jesaja ändert in diesem Vers seine Sprechrichtung. Dabei wechselt er von einer Zeitdimension in eine andere. Bei Letzterem, dem Zeitwechsel, sei begonnen. Der literarische Jesaja blickte bisher im Abschnitt in die Zukunft und besprach das, was eintreten kann. Nun wendet sich Jesaja der Gegenwart zu, in der er agiert und in welcher er redet. Jesaja spricht dabei erstmals im Abschnitt seine Adressaten, seine Hörer, an – und damit letztlich auch die Leser des Buches. Dabei stellt sich Jesaja sofort auf die Seite seiner Adressaten und reiht sich ihnen ein, wenn er ein Wir, ein „uns“ aufblitzen lässt. Jesaja geht es letztlich um die eigene Gegenwart und die seiner Adressaten.
Der Prophet zieht aus dem zukünftigen Verhalten der Völker die Konsequenzen für sein Hier und Heute. Dabei greift er in seiner Wortwahl, mit der er sich seinen Adressaten zuwendet, bezeichnenderweise auch die Sprechweise unter den Völkern auf: „Haus Jakob, kommt doch! Wir wollen gehen im Licht JHWHs! (Jes 2,5).“ Hat Jesaja soeben noch die künftige Aufmunterung unter den Völkern zur Wallfahrt auf den Berg JHWHs zitiert – „Kommt doch (2,3)!“ –, so macht er daraus einen Appell an sich selbst und an seine Klientel: „Kommt doch! (2,5).“ Hat Jesaja kurz zuvor die Bereitschaft der herbeikommenden Völker wiedergegeben, den Pfaden JHWHs zu folgen: „Wir wollen gehen (2,3)“, so appliziert er jetzt Vergleichbares auf seine Gemeinschaft und auf das, was sie tun solle: „Wir wollen gehen (2,5).“
Aufschlussreich ist in Jes 2,5 zudem, dass Jesaja den Eigennamen „Jakob“ aufgreift. Die Völker nennen ihr Ziel, den Tempel auf dem Zion, „Haus des Gottes Jakobs“ (2,3). Wie erwähnt, deuten die Völker damit an, wer auch für sie die Gottheit im Heiligtum aufgrund der bekannt gewordenen Geschichte ist. Jesaja spricht nun seine Adressaten als lebendiges „Haus Jakob“ (2,5) an. Die von den Völkern gesuchte Gottheit ist jene, welche mit den Adressaten vor Ort eine gemeinsame Vergangenheit teilt. JHWH hatte sich in der Welt bekundet und dies u.a. auch zugunsten derer getan, die unter dem Signalwort „Jakob“ firmieren. Die so Benannten leben aufgrund von Gottes Handeln auf dem Berg und in Jerusalem. Die künftige Hinwendung der Völker zum „Gott Jakobs“ betrifft – so Jesaja – seine jetzigen Adressaten als „Haus Jakobs“.
Jesaja erzeugt so im letzten Vers einen Nachklang zum erwarteten Gespräch unter den Völkern. Jesaja lässt zwar verhalten, aber doch gut vernehmbar das lokale Ziel der Völker, ihre religiöse Ausrichtung und ihre ethisch-religiöse Lernbereitschaft nachhallen. Jesaja spielt aber nicht nur mit dem „Echo“ auf die Intentionen der Völker an. Vielmehr spornt er mit dem Appell seine Adressaten dazu an, dass die Vorhaben und Ziele der Völker hier und jetzt „nachhaltige“ Wirkungen in den eigenen Reihen hervorrufen. Die Adressaten werden von ihm dazu gedrängt, sich gegenwärtig „im Licht JHWHs“ aufzuhalten und zu bewegen.
Bezieht sich Jesaja mit dem „Licht JHWHs“ auf seine eigene Rede kurz zuvor, als er von der „Tora“ und vom „Wort JHWHs“ gesprochen hat (2,3)? Von solch einem Bezug kann man wohl ausgehen. Jesajas Bezugnahme impliziert allerdings einen nicht näher entfalteten Gedankenschritt. Wenn die Tora und Gottes Wort den Völkern darlegen werden, was ihnen den Frieden ermöglicht, dann versteht Jesaja unter anderem dieses mögliche Resultat, den Frieden, theologisch-metaphorisch als „Licht JHWHs“. Somit ist von folgendem Gedankenschritt Jesajas auszugehen: JHWH wird für den künftigen globalen Zustand (sein Licht) zuvor das bereitstellen, was den Völkern ermöglicht (Tora und sein Wort), den Zustand zu erreichen, und was von den Völkern auch ergriffen wird (gehorsames Befolgen). Für Jesaja sind einerseits der Frieden und das Licht JHWHs und andererseits die Tora, das Wort JHWHs und deren Akzeptanz und aktive Umsetzung wie zwei Seiten einer Medaille zu sehen. Jesaja betrachtet dieselbe Medaille, nur ihre Kopfseite hat eine andere Prägung als die Zahlseite. Was bedeutet das nun für Jesajas Appell an seine Adressaten? Jesaja fordert seine Hörer auf, sich vom Toragehorsam der Völker und dem damit verbundenen Bewirken des Friedens so motivieren zu lassen, dass solche Wirkung oder eine ähnliche Wirkung zugleich der Status sind, in den sie sich versetzen mögen und in dem sie sich bewegen und aufhalten können: „Lasst uns gehen im Licht JHWHs!“ (2,5). Jesajas Adressaten sollen sich so verhalten und leben, wie es dem kommenden Weltfrieden entspricht.
Kommt man vom ersten Kapitel des Prophetenbuches her, so wird deutlich, dass Jesaja bei seinen Adressaten in Jes 2,5 eine eigene, breitere Kenntnis der Tora und des JHWH-Wortes voraussetzt und ein tieferes Wissen darüber, was deren gehorsames Befolgen bewirken kann. Kenntnis und Wissen der Adressaten sind jedenfalls umfangreicher, als ihnen aus den Andeutungen Jesajas in 2,1–5 hervorgehen kann. Jesaja geht davon aus, dass die Adressaten seine Einlassungen in 2,1–5 auf bereits Gehörtes beziehen. So ist jetzt diesem Gehörten und damit Kapitel 1 nachzugehen, um dann dessen Inhalte genauer auf den Appell Jesajas in 2,5 beziehen zu können.
Israel angesichts der Völker
Die Völker werden künftig von JHWH durch die Tora und sein Wort belehrt werden. Ein vergleichbares Belehren von Jesajas Israel, des „Hauses Jakob“, hat bereits in Kapitel 1 stattgefunden.
Kapitel 1 bettet dieses Belehren Israels in einen dramatischen Zusammenhang ein. Das Belehren Israels durch JHWH war überaus notwendig geworden. Denn Israel hatte sich auf Irrwegen befunden und war dabei in sein eigenes Verderben gerannt. Bevor ab Jes 1,10 die „Anführer“ und das „Volk“ Israel darüber unterrichtet werden, was JHWH wirklich gefällt, wird im Kapitel 1 hervorgekehrt, in welcher heillosen, verlustreichen Lage und belasteten Situation sich Israel vorfand.
JHWH selbst musste über sein Volk klagen und es anklagen (Jes 1,2–3). „Himmel“ und „Erde“ wurden dabei als Zeugen angerufen, um das Ausmaß des Beklagenswerten anzudeuten. JHWH hatte sich zwar Israel auf eine Art und Weise zugewandt, wie Eltern es zu tun pflegen, wenn sie ihre Kinder mühe- und hingebungsvoll großziehen. Doch trotz seines Einsatzes musste JHWH feststellen, dass sein Volk ihm gegenüber abtrünnig geworden und nicht zur Einsicht gekommen war. Dem literarischen Propheten Jesaja kommt es dann zu, in einem Weheruf die Folgen zu schildern, die sich aus Israels schuldhaftem und sündigen Verhalten ergeben hatten (1,4–9). Ein schweres Gericht war über das Volk und Land ergangen und hatte diese tief gebeugt. Das Strafgericht hatte zu weitreichenden Vernichtungen unter Israel geführt. Nur ein kleiner Rest Israels, die „Tochter Zion“, war übrig geblieben. Jesaja macht deutlich, dass sich dieser Rest von „Israel“ allein einem göttlichen Verschonen verdankt. Schuld und Sündhaftigkeit hätten auch dazu führen können, dass Israel ein unwiderruflicher Untergang ereilt und es ausgelöscht wird – wie einst „Sodom“ und „Gomorra“ (vgl. Gen 19,25.28). Doch zu solcher Auslöschung kam es nicht. JHWH hat davon abgesehen und den Rest erhalten. Jesaja deutet mit einem „Wir“ an, dass seine Adressaten und er selbst nur aufgrund der göttlichen Verschonung existieren: „Hätte JHWH Zebaot nicht einen kleinen Rest übrig gelassen, wie Sodom wären wir geworden, Gomorra wären wir gleich“ (Jes 1,9).
Beim Ton der Anklage bleibt es, wenn dann die Belehrung Israels erfolgt. Der Prophet redet in Jes 1,10 anscheinend zu den Bewohnern Jerusalems, sozusagen zum Rest Israels. Dieser Rest war zwar gerade einem Geschick entgangen, wie es ehedem Sodom und Gomorra ereilt hatte. Doch in puncto Schuld und Sündhaftigkeit sieht Jesaja sein Israel immer noch auf derselben Stufe wie die einstigen Bewohner von Sodom und Gomorra stehen. Jesaja redet deshalb seinen Hörerkreis in Israel mit den Worten an: „Anführer von Sodom [...] Volk von Gomorra!“ Mit diesem provozierenden und schockierenden Tonfall streicht Jesaja erneut die Dringlichkeit der Belehrung heraus. Israel befand sich – noch – in der Gefahrenzone, in der ihm Untergang und Auslöschung drohen. So lenkt Jesaja mit einem Höraufruf die Konzentration auf die Lehrinhalte, durch die Israel aus der Gefahr herauskommen wird, falls es diese Inhalte auch beachtet und beherzigt. Die Lehrinhalte benennt Jesaja mit zwei Begriffen, die er später ebenso bei seiner Schilderung der Völkerwallfahrt einsetzen wird (2,3) und die dort chiastisch gewendet, also in umgekehrter Reihenfolge auftauchen: „Wort JHWHs“ und „Tora (unseres Gottes)“ (1,10). Lesende werden sich so in 2,3 leicht daran zurückerinnern können, dass vor der Tora für die Völker zuerst dem gefährdeten Israel eine Tora JHWHs mitgeteilt wurde. Die Lesenden werden diese erste Tora für Israel auch bei Jesajas Appell in 2,5 mitdenken können, mit dem der Prophet Israel, das „Haus Jakob“, auffordert, sich im „Licht JHWHs“ zu bewegen. Dem gefährdeten Israel hat Jesaja jedenfalls in 1,10 zugerufen: „Hört das Wort JHWHs, Anführer Sodoms! Horcht auf die Tora unseres Gottes, Volk von Gomorra!“
Nach diesem Aufruf kommt Jesaja, der Prophet und berufene Rufer (vgl. Jes 6), seinem göttlichen Botendienst nach und unterbreitet Israel die Tora in Form einer belehrenden Rede JHWHs: Jes 1,11–17. Die Gottesrede wendet sich als Erstes Israels Kult, dessen Gottesdienst und dessen religiöser Praxis zu und übt daran heftige Kritik (1,11–15). Die Kritik geht auf göttlicher Seite mit weitreichenden Konsequenzen einher. Diese Konsequenzen reichen von JHWHs Erklärung, keinen Gefallen an Israels Opferdarbringungen zu haben (1,11), bis zu JHWHs Ansage, Israels Gebete nicht erhören zu wollen (1,15). Andere Prophetenbücher verwenden ebenso diesen Topos einer so genanten „Kultkritik“. Der Topos lehnt keineswegs jeglichen Kult und alles liturgische Agieren ab. Wohl aber entlarvt der Topos Haltungen und Verhaltensweisen in Israel, die mit einer aufrichtigen religiösen Hinwendung zu JHWH unvereinbar sind. Das alltägliche Verhalten und der soziale Umgang untereinander müssen in Israel dem Wollen und den Anliegen JHWHs entsprechen. Nur so wird Israel kultisch und religiös JHWH begegnen können. Andernfalls wird die Begegnung unmöglich. U.a. ein Detail deutet die gegenwärtige Unmöglichkeit zur Begegnung mit JHWH an. In Israel opferte man mit „Händen“ (1,12) und betete mit ausgebreiteten „Handflächen“ (1,15), doch die „Hände“ waren voller Bluttaten (1,15). Opfer und Gebete konnten die Bluttaten, die Gewaltausübungen am Nächsten (vgl. Gen 4), nicht verschleiern, und JHWH musste sich so von Israel abwenden. Folgerichtig unterbreitet deshalb die Tora am Schluss, was JHWH von Israel einfordert und was Israel tun soll (Jes 1,16–17). Bezeichnend sind die beiden letzten Forderungen. Israel hat „Waise“ und „Witwe“ bei Rechtsangelegenheiten aktiv zu unterstützen. Waise und Witwe stehen in der Antike und Bibel beispielhaft für die Kreise der Wehrlosen und Schutzbedürftigen. Damit schlägt die Tora einen Bogen, der von der Kultkritik bis zu den göttlichen Sozialforderungen reicht.
Die Tora stellt Israel vor die Entscheidung. Das macht die folgende Gottesrede deutlich (Jes 1,18–20). Diese Rede ahmt einen Rechtsstreit vor Gericht nach. JHWH setzt sich wie in einem Rechtsstreit mit Israel als seinem Gegenüber auseinander. JHWH zeigt sich bereit, auch die schwersten Vergehen in Israel zu vergeben (1,18). Die göttliche Bereitschaft zur Vergebung gestattet Israel aber keineswegs, dass es sich bequem zurücklehnen kann. Die Tora hat soeben Israel kundgemacht, was JHWH wirklich gefällt. Nun macht JHWH klar, dass Israel auf die Anliegen in der Tora reagieren muss. Diese Reaktion wird die Weichen stellen, wie sich Israels Zukunft und Geschick gestalten werden. Macht sich Israel willig und gehorsam die göttlichen Anliegen zueigen, wird es ein glückliches Leben im Land führen (1,19). Falls nicht, kommt ein gewaltsames Sterben auf Israel zu (1,20).
Eines ist noch zu den sozialethischen Ansprüchen JHWHs an Israel zu sagen. Diese Ansprüche werden in Kapitel 1 insbesondere mit den Begriffen „Recht“ (Jes 1,17) und „Gerechtigkeit“ benannt. Israels Geschick ist an das Ausüben von Recht und Gerechtigkeit gebunden. Literarische Pendelschläge machen das deutlich: Der Vers 1,21 muss eine Totenklage anstimmen; denn in Jerusalem waren zwar früher Recht und Gerechtigkeit vorhanden gewesen, beide Größen sind aber momentan abhandengekommen. Durch deren Verdrängen ist die Stadt JHWH untreu geworden und benimmt sich wie eine Dirne. Es werde schon ein Gerichtshandeln Gottes nötig sein müssen (1,24–25), das Jerusalem wieder auf ihren früheren Stand bringt, damit man sie „Stadt der Gerechtigkeit“ (1,26) nennen kann. Der Vers 1,27 schließlich bezieht Recht und Gerechtigkeit in eine mögliche zukünftige Erlösung ein: „Zion wird durch Recht erlöst, und ihre Umkehrenden durch Gerechtigkeit.“
Damit ist ein wenig das Kapitel Jes 1 beschrieben, auf dessen Hintergrund die Schilderung der Völkerwallfahrt und Jesajas Appell an seine Adressaten in Jes 2,5 zu stehen kommen. Auf diesem Hintergrund werden an Jes 2,1–5 einige Aspekte sichtbarer. Diese lassen sich in vier Punkten bündeln.
(1) Von Jes 1,1 bis Jes 2,5 wechseln die Perspektiven auf eine Weise, dass sich ein Kreis schließt. Sieht man von Randerscheinungen ab, so hat sich das erste Kapitel mit dem Binnenraum Israel befasst und ist auf diesen Binnenkreis konzentriert gewesen. Der erste Abschnitt des zweiten Kapitels weitet danach den Blickwinkel und nimmt die Völkerwelt, „alle Nationen“ (2,2), in den Gesichtskreis mit hinein. Nach dieser geweiteten Perspektive kehrt der Schlussvers des Abschnittes 2,5 wieder zum Binnenraum zurück. Ein wichtiger Effekt dieser Perspektivwechsel besteht darin, dass nun der Binnenraum Israel, das lebendige „Haus Jakob“, in eine Horizonterweiterung gebracht worden ist. Spricht Jesaja in 2,5 Israel auffordernd an, muss dieses Israel dabei die künftige Umtriebigkeit in der Völkerwelt mitbedenken.
(2) Wenn der Vers Jes 2,5 an Israel appelliert, sich im „Licht JHWHs“ aufzuhalten, dann geht dieser Appell nicht einfach davon aus, dass Israel bei einem neutralen Nullpunkt anzufangen hat, als ob nichts gewesen wäre. Kapitel 1 hat gezeigt, dass sich Israel an einem Tiefpunkt befindet. Mit der Metaphorik des Verses 2,5 gesprochen, hält sich Israel noch wie in einer Finsternis auf, dem Gegenpol von Licht, und in keiner bloßen Grauzone. Schuld und Sünde, kultische Defizite und sozialethische Mängel haben Israel von seinem Gott JHWH entfernt und das Gottesvolk belastet. Israel steht vor einem langen Weg ins Licht, den es – wie Jes 1 darlegte – mit JHWHs Hilfe und orientiert am Maßstab Tora und an Recht und Gerechtigkeit beschreiten kann. Die beiden angesprochenen Wege, der der Völker und der Israels, sind einander ähnlich, aber sie sind auch voneinander unterschiedlich. In Zukunft wird die globale Völkerwelt sowohl eine örtliche als auch eine innere Bewegung vollziehen (2,2–4), aber der Binnenraum, das Haus Jakob, möge jetzt eine sehr weitgreifende innere Bewegung vollziehen (2,5).
(3) Der Binnenkreis Israel weiß durch den geweiteten Gesichtskreis zur Genüge um die hoffnungsvollen und vielversprechenden Chancen für ein Zusammenleben in der Welt. Nationen und Völker werden in einen Friedenszustand eintreten können. Das Aussichtsreiche und Erfolgversprechende für das globale Miteinander werden dem Binnenkreis Israel wie ein Anreiz vor Augen gestellt, selber aktiv zu werden und sich zu bewegen. Was den wallfahrenden Völkern widerfahren soll, kann und darf Israel als anspornende Motivation aufgreifen. Der Gedanke bei der Motivation für den Binnenraum kann etwa so beschrieben werden: Handeln und leben wir als Haus Jakob derart, dass unsere eigene Gemeinschaft dem zukünftigen Friedenszustand und Glück unter den Völkern entspricht! – Falls aber diese Motivation nicht greift, könnte sich zumindest hypothetisch auch ein sehr düsteres Szenario einstellen, das nicht nur Israel, sondern auch die Völkerwelt betrifft:
(4) Denn der Binnenkreis Israel ist in der literarischen Darstellung von Jes 1,1–2,5 alles andere als eine in seiner Existenz gesicherte Größe. Jes 1 hatte an Vernichtungen von Teilen Israels erinnern müssen. Die Gründe und Auslöser für die Vernichtungen herrschen aber immer noch im verschonten Rest-Israel vor. Falls dieses Rest-Israel weiterhin auf dem sündhaften Stand von Sodom und Gomorra verbleiben würde, droht dann diesem Israel nicht doch noch der Untergang (vgl. 1,20)? Im Falle eines solchen Untergangs könnten die Völker in Zukunft auch keinen bewohnten Zion und keine belebte Stadt Jerusalem mehr aufsuchen. Die kühne Zukunftsvision vom Frieden unter den Völkern hätte dann eine ihrer Grundlagen verloren. Eine Ermöglichung des Völkerfriedens am Zion und in Jerusalem wäre abhandengekommen. Damit ist beim Appell in Jes 2,5 ein weiterer Gedanke präsent. Das Israel am Zion und in Jerusalem, der Binnenkreis, ist vor die Aufgabe gestellt, durch eigenes Aktivwerden den zukünftigen globalen Frieden mit zu ermöglichen und nicht zu verhindern. Dieser weitere Gedanke beim Appell lässt sich in etwa auch so umschreiben: Werden wir als Haus Jakob zu einer Tora-konformen, zu einer gerechten Gesellschaft und dadurch überlebensfähig, damit sich dadurch der Frieden unter den Völkern realisieren kann!
Die Gedanken in Jes 1,1–2,5 sind eingeflochten in eine richtungsweisende Theologie. JHWH hegt die Absicht, Zion-Jerusalem als Ausgangspunkt für einen weltweiten Frieden einzusetzen. Angesichts und aufgrund dieser göttlichen Absicht hat der Binnenraum Israel nicht allein an die eigenen Belange zu denken und nicht nur um sich selbst zu kreisen. Der Binnenraum muss auch die universellen Pläne seines Gottes mit den Völkern einbeziehen. Wenn Israel durch Toragehorsam seine Existenz schützt, bewahrt Israel zugleich seinem eigenen Gott die Möglichkeit, eine Stätte in der Welt zu haben, von der Tora ausgehen und an der ein Frieden unter den Völkern beginnen kann. Israel wird dann von JHWH eine der Chancen erhalten, mit der er Krieg und Zwist überwinden kann.
Jes 1,1–2,5 stellt im umfangreichen Jesajabuch eine Art Ouvertüre dar. Die Ouvertüre lässt vieles anklingen, was dann im Buch weiter entfaltet wird. Einzelne Punkte, die für aufschlussreiche oder für überraschende Weiterführungen stehen, seien kurz angedeutet.
Israel und die Völker
„Tora“ als eines der Leitworte des Buches kommt im Kapitel 51 das letzte Mal vor. Das Leitwort steht auch hier im erhellenden Zusammenhang: Zion befand sich in einer desolaten Lage. Doch JHWH tröstet Zion und „ihre Trümmerstätten“, und er richtet Zions Umland neu her (Jes 51,3). Die Aufforderungen am Anfang des Buches, die Tora zu befolgen, münden u.a. in Kapitel 51 in einen Toragehorsam unter den Bewohnern am Zion. JHWH kann nun solche anreden, die sich als „Kenner der Gerechtigkeit“ und als „Volk mit meiner Tora im Herzen“ erweisen (51,7). Entsprechend verkündet JHWH das Ende von Not und die Beständigkeit seines Heils (51,7–8). Erhoffte der Buchanfang, dass die Tora die Völker erreichen wird, erfüllt sich solches u.a. auch hier. Denn innerhalb der Darstellung vermeldet JHWH seinem Volk: „ [...] Tora wird von mir ausgehen und mein Recht als Licht der Völker [...] Meine Gerechtigkeit ist nahe, mein Heil ist hinausgegangen, und meine Arme verschaffen den Völkern Recht“ (51,4–5). Standen in der Ouvertüre die Tora für Israel und die Tora für die Völker eher unverbunden nebeneinander, so sind nun beide einander näher gerückt. Der Toragehorsam im Inneren geht mit einer heilsamen Wirkung der Tora in der Völkerwelt einher.
Höchst beachtlich ist nun, dass die Völker Israel in seiner Zusammensetzung verändern können: Das Jesajabuch setzt viele historische Veränderungen einfach voraus. In einer Phase gelangten ‚Israeliten’ außerhalb ihres Ursprungslandes. Sie weilen dann im Exil (Babylon) oder leben in einer Diaspora. Die Rückkehr dieser Israeliten zum Zion wird so im Buch zum Thema (vgl. Jes 48,20; 52,11–12; 55,12–13), zudem wird auch ein Zug der Völker zum Zion thematisiert, bei dem sie Nachfahren der Israeliten mitbringen (vgl. 60,5). Anscheinend passend zu diesem Hin und Her nimmt das Buch JHWH-Verehrer aus anderen Völkern in den Blick und problematisiert die Stellung dieser Verehrer im Gottesvolk Israel. Das Buch spiegelt dabei eine Auseinandersetzung im Inneren der Gemeinde Israels wider: Wer darf zur Gemeinde gehören und wer nicht? Die Auseinandersetzung spaltet die Gemeinde Israel. Eine entscheidende Gruppe im Buch Jesaja sieht die Mitgliedschaft von JHWH-Gläubigen aus den Völkern in der Gemeinde Israel als angemessen und richtig an, und die Gruppe kann sich auch auf Worte JHWHs berufen. Die Zulassung zur Gemeinde darf nicht davon abhängen, welche ethnische Herkunft jemand hat. Entscheidend sind zuerst das ethische Verhalten, die Beachtung des Sabbats, das Bekenntnis zu JHWH (vgl. 56,1–8) und die Abkehr von Fremdgottverehrungen (vgl. 66,17). Von JHWH her gilt, dass sein Tempel auf dem Zion „ein Haus des Gebetes für alle Völker genannt werden soll“ (56,7; vgl. 1Kön 8,41–43) und dass an dieser Stätte Fremde werden wohlgefällig opfern können. Das Finale des Buches unterstreicht diese Auffassung von einer offenen Israel-Gemeinde und schreibt sie buchintern fest: Hier gehen JHWHs Worte erneut auf einen gottgefälligen Kult und angemessenen Gottesdienst ein (Jes 66,20–23). „Alles Fleisch“ wird nach Jerusalem kommen, um JHWH zu verehren (66,23). Der Begriff „alles Fleisch“ benennt die neue Größe und Gemeinde, die sich aus Teilen Israels und aus Teilen der Völkerwelt zusammensetzt. Dieser Begriff „alles Fleisch“ verwies schon am Anfang der Bibel auf eine Menschheit (Gen 6–9), die noch nicht in verschiedene Ethnien gespalten war (Gen 10). Die Gottesdienstgemeinde im Buchfinale realisiert sich durch das Miteinander von jenen, die sich aus Israel und aus den Völkern aufrichtig JHWH zuwenden können.
Das Ende des Buches ist von seiner Ouvertüre her zu lesen. Dabei sind drei Punkte ausschlaggebend: (1) Wie gesehen, gelang in der Ouvertüre dem Binnenraum Israel kein JHWH gefallender Kult und Gottesdienst. Aber auch am Ende des Buches ist einem abgeschlossenen Binnenraum Israel allein ein solcher Kult und Gottesdienst nicht möglich, auch wenn Israel in Teilen von Schuld und Sünden gereinigt sein mag. Gelingender Kult und Gottesdienst werden erst durch Vertreter „allen Fleisches“, eben aus Israel und den Völkern, vollzogen werden können.
(2) Der Appell an das Haus Jakob in Jes 2,5 zielte „nur“ auf eine theologische Ethik ab. Israel sollte seinem Gott die Möglichkeit offen halten, vom Zion aus Frieden in der Völkerwelt herbeiführen zu können. Die Entwicklungen im Buch gehen dann über diese Ethik hinaus und führen zu einer neuen „Ekklesia“ (vgl. LXX Dtn 23,2–9) im Jesajabuch. Sollte eingangs die Zion-Israel-Gemeinde lediglich zugunsten der Völker agieren, treten dann zu guter Letzt Vertreter der Völker in die Gemeinde ein und formatieren ihre Zusammensetzung neu.
(3) Das Buchende erwähnt eine fortbestehende Gefahr, die schon in der Ouvertüre zum Gericht geführt hat und die im Brechen mit JHWH und mit seinen Anliegen besteht (Jes 1,2.18). Der Schlussvers hebt von der neuen Gemeinde Einzelne ab, die durch solch ein Brechen ihren Untergang herbeigeführt haben (66,24). Das Neue und das Richtungsweisende ist gegeben, aber das Alte und die Existenz Bedrohende besteht fort. Die Lesenden haben am Buchende zu überlegen und zu entscheiden, auf welcher Seite sie stehen wollen.
Schlussreflexion
Das Jesajabuch entfaltet das Thema „Israel und die Völker“ viel breiter, als es hier wenige Federstriche andeuten konnten. Doch wurden zumindest Einzelaspekte des Themas deutlich. Israel hat eine Aufgabe und Verantwortung für die Völkerwelt. Dabei sollen die Geschicke der Völker Israel im Inneren bewegen. Im Gegenzug können dann Vertreter der Völker die Zusammensetzung Israels verändern.
Die folgende Reflexion zu diesem Befund holt zu einem weiten Bogen aus und wird zugegebenermaßen gewagt anmuten. Die Reflexion bezieht einige pastorale Gedanken von Bischof Joachim Wanke ein, dem dieser Band gewidmet ist. Wanke entwickelte seine Gedanken zunächst in einer konkreten geschichtlichen Situation.
Die Geschichte der katholischen Kirche in der ehemaligen DDR und in den neuen Bundesländern durchlief einige Phasen. Eine erste Phase war geprägt von negativen Erfahrungen mit den politischen und ideologischen Realitäten im Ostblock. Die katholische Kirche und die Bischöfe der DDR richteten sich in dieser Phase mehr oder weniger im eigenen, mühsam freigekämpften Binnenraum ein. Pastorale Konzepte dachten von einem „geschützten Raum“ Kirche her. „Geschützt“ bedeutete in diesem Fall zugleich: abgeschottet. Selten geschah eine interne Ermutigung der Gläubigen und der Kirche dahin, dass sie sich gesamtgesellschaftlich engagieren könnten. Ihre notgedrungene geistige Distanz zum realen System ließ für die Kirche auch das Land und die Gesellschaft, in denen das System herrschte, eher als Nichtheimat und als Fremdes erscheinen. Diese Sichtweise und Einstellung änderten sich schrittweise – nicht zuletzt mit der Übernahme des Bischofsamtes in Erfurt durch Joachim Wanke.
Wanke trat sein Bischofsamt 1980 an, nachdem das Zweite Vatikanische Konzil zu alten, bisweilen vergessenen Einsichten über das Wesen der Kirche Gottes zurückgefunden hatte. In den Einsichten des Konzils ist der Kirche ein Weltauftrag gegeben, der sich jeweils am Ort und in der konkreten Zeit segensreich auszuwirken hat. Wanke vermochte für sein Aufgabenfeld als Bischof eine Differenzierung vorzunehmen. Er unterschied zwischen zwei Seiten: dort Staat und System, hier das Land und seine Menschen. Auf die zweite Seite lenkte Joachim Wanke seine pastoralen Überlegungen. Schon 1981 sah der Bischof auf Pastoralkonferenzen den DDR-Raum nicht mehr nur als unleidliche Schicksalsstätte für die Kirche an. Dieser Raum war für Wanke und seine Mitbrüder im Presbyterium zuerst einmal Heimat, in der das Evangelium auf „mitteldeutsch“ buchstabiert werden muss. Der Sendungsauftrag der Kirche wurde von Wanke mit einer neuen Positionierung zur Mitwelt im gemeinsamen Raum verbunden. Die Konsequenzen daraus gingen für Wanke dahin, dass die Kirche in vielen ihrer Lebensäußerungen unterschiedslos für alle Menschen des Landes solidarisch da sein muss. Der Raum für die Kirche ist eine von Gott gegebene Realität und verlangt eine Hinwendung zu den Menschen, welche dem gemeinsamen Raum angehören.
Wanke griff seine frühen pastoralen Gedanken mehrfach auf, spitzte sie aber auch zu. Dreißig Jahre nach seiner Weihe zum Bischof, am 30.11.2010, hielt er in der Katholischen Akademie Berlin einen Vortrag mit dem Titel „Katholische Kirche in Deutschland – wie geht es weiter?“ Der Vortag befasste sich mit der „Glaubwürdigkeit“ dieser Kirche. Diese hat bekanntlich in den letzten Jahren arg gelitten. Wanke nahm seine Kirche in die Pflicht: „Der Auftrag der Kirche ist es, Gott zum Vorschein zu bringen, nicht sich selbst. Es ist einfach falsch zu meinen, wir müssten als Kirche eine Gegengesellschaft zur Welt bilden, vielleicht noch perfekter als diese werden. Gerade diese Mentalität hat in der Vergangenheit manche strukturelle Heuchelei verursacht. Der Schein war dann wichtiger als das Sein. Die Kirche muss sich als Ferment im Ganzen verstehen, nicht als Rückzugsort für die Vollkommenen und Reinen.“ Ferment bedeutet u.a. „Gärungsmittel“ oder „Sauerteig“. Beide wirken, sobald sie in organischer Materie eingemischt sind. Wo hat Kirche zu wirken?
Die pastoralen Gedanken Wankes enthalten Momente, die offenkundig dem ähneln, was hier aus dem Jesajabuch erhoben werden konnte: Gemeinschaften, die sich vom biblischen Gott her verstehen, können keine rein auf sich bezogenen Binnenräume bleiben, sondern haben sich in weiten Bezugsfeldern wiederzufinden. Doch ein direkter Vergleich der Gedanken Wankes mit den Inhalten des Jesajabuch verbietet sich. Die Differenzen in den historischen Umständen und in den Konstellationen, in den die jeweiligen Gemeinschaften stehen, sind zu groß.
Vor allem aber ist der Unterschied zu beachten, ja zu betonen, dass im Jesajabuch Israel im Fokus steht und bei Wankes Gedanken die Kirche. Zwar fußt die christliche Kirche auf dem biblischen Israel auf, und Christen begegnen im aktuellen Judentum ihren „älteren Brüdern“ (Johannes Paul II.). Doch das Alte Testament kreist im sogenannten ersten Lesegang durch die christliche Bibel zunächst einmal um Gott, die Welt und insbesondere Israel, und Bezüge auf Christen und Kirche fehlen dabei im Alten Testament. Erst danach kommt von christlicher Seite her der notwendige zweite Lesegang unter Kenntnis des Neuen Testamentes hinzu, und dabei erst dürfen sich Christen im Alten Testament – ohne das Judentum zu vereinnahmen – erhellend widerspiegeln.
Unter diesen Konditionen und Einschränkungen lassen sich dem Jesajabuch Aspekte ablauschen, die sowohl Wankes Gedanken als auch eine Selbstbesinnung der Kirche theologisch grundieren und vertiefen können.
Das Prophetenbuch stellte sich dem Wandel und Wechsel in der Geschichte. Das Gottesvolk erlebte Verluste und Niederlagen, machte Erfahrungen mit dem Exil und in der Diaspora und hatte mühsame Neuanfänge in der alten Heimat zu bestehen. Die geschichtlichen Entwicklungen wurden im Buch nicht nur einfach zur Kenntnis genommen. Die Geschichte wurde von Gott her gedeutet und verstanden. Nicht zuletzt die Einsicht, dass JHWH mit langem Atem sein Volk durch Zeiten und Räume leitet, führte im Buch zur Erkenntnis der Einzigkeit JHWHs. Aufgrund dieser Einzigkeit wurde JHWH zugleich als Schöpfer der Welt und als der Lenker auch der Geschichte der Völkerwelt angesehen.
Damit war im Prophetenbuch eine zentrale theologische Ausgangsbasis gegeben. In dieser Denkweise steht zuerst JHWH in universellen lebendigen Bezügen. Und umgekehrt steht dann auch jede Mitwelt, die es zum Gottesvolk geben kann, schon immer in Beziehung zu JHWH. Von dieser Theologie her hat das – bzw. ein – Gottesvolk je neu seine Mitwelt in den Blick zu nehmen und der Mitwelt zu begegnen.
Literatur
Berges, U., Das Buch Jesaja. Komposition und Endgestalt, Freiburg i. Br. 1998 (Herders biblische Studien 16).
Beuken, W. / Berges, U., Jesaja 1–12, Freiburg i. Br. 2003 (Herders theologischer Kommentar zum Alten Testament).
Fischer, I., Tora für Israel – Tora für die Völker. Das Konzept des Jesajabuches, Stuttgart 1995 (Stuttgarter Bibelstudien 164).
Henrix, H. H., Judentum und Christentum. Gemeinschaft wider Willen, Kevelaer 2004 (Topos 525).
Lohfink, N. / Zenger, E., Der Gott Israels und die Völker. Untersuchungen zum Jesajabuch und zu den Psalmen. Stuttgart 1994 (Stuttgarter Bibelstudien 154).