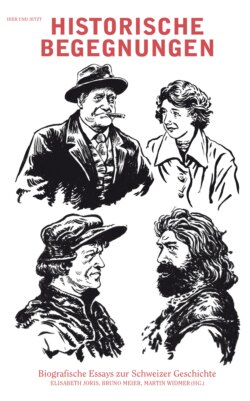Читать книгу Historische Begegnungen - Группа авторов - Страница 24
Verbote und Verfolgung
ОглавлениеAusgerechnet in dieser brenzligen Lage um die Jahreswende 1524/25, als der Zürcher Rat und ihr erster Prediger Zwingli peinlich darauf achteten, keinen weiteren Anlass zur Verstimmung der Eidgenossen zu geben, verlangten Conrad Grebel und seine Freunde, von politischen Rücksichten unbekümmert, die Abschaffung der Kindertaufe. Sie predigten gegen eine Wand der Ablehnung. Am 18. Januar 1525 stellte der Zürcher Rat die Verweigerung der Kindertaufe und jede Aufforderung zum Verzicht auf sie unter Strafe. Die erste Taufdisputation, die am Vortag, dem 17. Januar 1525, stattfand, war ergebnislos verlaufen.
Am 21. Januar 1525 schliesslich, acht Tage nach dem Besuch der gemässigten Gruppe der Eidgenossen, belegte der Zürcher Rat die Gruppe der jungen Radikalen ihrer abweichenden Meinung wegen mit einem Versammlungs- und Redeverbot. Sie hatten nicht nur eine eigene Bibelschule unterhalten und öffentlich bei jeder Gelegenheit disputiert, sondern unterhielten engste Kontakte zu den zwei in Kirchenfragen rebellischsten Landgemeinden – Witikon, hoch oberhalb der Stadt gelegen, und Zollikon, der stadtnächsten Gemeinde am See. Nun sollten die Nichtzürcher unter ihnen des Landes verwiesen werden, darunter der Prediger Wilhelm Reublin, den die Witikoner Bauern selbst eingestellt hatten und Johannes Brötli, der in Zollikon radikal-evangelisch predigte.
Ebenfalls in jenen Tagen, am 6. Januar 1525, hatte Conrad Grebels Frau Barbara eine Tochter geboren: Rachel. Sie sei «noch nicht in dem Römischen Wasserbad getauft und geschwemmt», meldete Conrad seinem Schwager Vadian am 14. Januar 1525 herausfordernd. Ahnungsvoll hatte er ihm bereits am 15. Dezember 1524 geschrieben: «Ich meine nicht, dass Verfolgung ausbleiben wird.»
Nach jenem Verbot vom Samstag, 21. Januar, kamen die Radikalen ein letztes Mal in der Zürcher Wohnung von Felix Manz und dessen Mutter Anna Manz zusammen – ob noch am selben Abend oder einem der folgenden Tage ist nicht bekannt. Da kniete Blaurock, ein verheirateter ehemaliger Priester aus Graubünden, der erst seit wenigen Wochen in Zürich wohnte und eigentlich Georg Cajacob hiess, vor Conrad Grebel nieder und bat darum, so wie es in den Evangelien von Johannes dem Täufer und Jesus geschrieben stand, von ihm getauft zu werden. Mit dabei waren auch der Bündner Andreas Castelberger, Zwinglis langjähriger Buchhändler, sowie der Zürcher Bäcker Heinrich Aberli und zahlreiche andere. Conrad Grebel erfüllte Blaurocks Bitte, goss ihm anscheinend mit einer Schüssel Wasser über das oben kahle Haupt mit den am Rand noch langen, schwarzen Haaren und vollzog das Ritual, das fortan ihren Zusammenhang stiften sollte. Darauf erhob sich Blaurock und taufte alle übrigen. Ohne priesterliche Weihe zogen Conrad Grebel und Felix Manz fortan predigend und taufend über die Lande.
Zwar brachte die blutige Niederlage des französischen Heers und der eidgenössischen Söldner in der Schlacht bei Pavia am 24. Februar 1525 eine vorübergehende Entspannung der Kriegsgefahr. Der entscheidende Schlagabtausch erfolgte schliesslich 1529 und 1531 in den beiden Kappeler Kriegen. Im zweiten fand Zwingli auf dem Schlachtfeld bekanntlich den Tod.
Doch das vorübergehende Nachlassen des eidgenössischen Drucks auf Zürich im Jahr 1525 blieb für die Auseinandersetzung zwischen den Täufern und Zwingli selbst folgenlos. Seit dem 18. Januar 1525 drohte denen, die tauften oder sich taufen liessen, die Verbannung. Das wurde im Ratsbeschluss vom 11. März 1525 bestätigt und blieb auch so nach der erneut ohne eine Annäherung der Standpunkte verlaufenen zweiten Taufdisputation vom 20. März 1525. Doch faktisch wurde die Strafe gegen die «Wiedertäufer», wie sie nun polemisch genannt wurden, bereits verschärft: Der Zürcher Felix Manz, der seit Anfang Februar gefangen war, ebenso wie viele andere aus Zollikon, die nicht widerrufen wollten, kamen in unbefristete Beugehaft – zunächst wurden sie wegen ihrer grossen Zahl im ehemaligen Augustinerkloster eingesperrt.
Conrad Grebel blieb zunächst in Freiheit, weil er Ende Januar nach Schaffhausen auswich – «betrübt, aber in Christo», wie ein Mitstreiter über ihn berichtete. Dort feierte er als Laie Abendmahl, indem er ein Brot zerschnitt und verteilte. Willige taufte er im Rhein – offenbar aber erst, nachdem Wolfgang Uoliman, ein ehemaliger Klosternovize und seit Jahren auf Seiten der Reformation, Grebel dazu gedrängt hatte, wie es der Chronist Kessler überliefert hat.
In St. Gallen dann, wo Mitstreiter schon erfolgreich vorgearbeitet hatten, zog Conrad Grebel am Palmsonntag, 9. April 1525, mit einer Volksmenge vor die Tore der Stadt und taufte eine grosse Zahl Menschen, die sich aller Kleider entledigten und mit ihm in die Sitter, den örtlichen Fluss, stiegen. Auf diese Wassertaufe geht auch Grebels Ausspruch zurück, mit dem er angeblich Diskussionen mit Gegnern aus dem Weg ging: Er forderte sie nämlich auf, «nackt» zu ihm zu kommen, wenn sie mit ihm reden wollten – das hiess für ihn so viel wie: zuerst das sündige Leben ganz hinter sich zu lassen.
Als der Druck auf die Täufer auch in St. Gallen zunahm, begab sich Grebel wieder nach Zürich zu seiner Frau – und hielt sich eine Zeit lang vorsorglich zurück. Vermutlich war ihr erwähntes drittgeborene Kind, die Tochter Rachel, die er nicht dem «römischen Wasserbad» hatte ausliefern wollen, während seiner Abwesenheit gestorben. Getauft? Es ist möglich, dass der Ehestreit um die Seele von Rachel mit ein Grund war, weshalb er Zürich verlassen hatte.
Zu einem neuen Streit der Eheleute kam es, als Manz nach einigen Wochen aus der Haft flüchten konnte und bei ihnen anklopfte. Wann genau, lässt sich nicht bestimmen – es gibt zwar einen Brief Conrad Grebels an den Buchhändler Andreas Castelberger, der die Vorgänge schildert, aber der trägt kein Datum. Vermutlich erfolgte dieser erste Gefängnisausbruch Ende April oder Anfang Mai 1525. Felix Manz durfte sich eine Nacht lang bei Conrad und Barbara Grebel verstecken, doch in der darauffolgenden Nacht wollte Conrad Grebel den Freund Manz auf seiner Flucht begleiten und wieder in den Untergrund gehen. Seine Frau Barbara vereitelte es, indem sie bei ihrem Schwiegervater Junker Jakob Grebel «kein geringes Trauerspiel» verursachte, wie Conrad Grebel an Castelberger schrieb. Manz floh allein und wandte sich nach Graubünden, in die Heimat des längst ausgewiesenen Blaurock, um mit ihm weiter zu predigen. Aber die Stadt Chur fasste ihn – in einem Schiff wurde Manz schliesslich am 18. Juli 1525 nach Zürich ausgeliefert.
Inzwischen hatten die verbliebenen Zollikoner Täufer – vermutlich am Sonntag, 11. Juni 1525 – eine aufsehenerregende, endzeitliche Bussdemonstration in Zürich durchgeführt, über die Zwingli in seinem Buch «Elenchus» berichtete: Auch Frauen und Kinder nahmen teil, statt eines Gürtels trugen sie «eine Weidenrute oder einen Strick um die Lenden». «Auf den Strassen riefen sie schauerlich: Wehe, wehe! Wehe Zürich! Einige gaben, Jonas nachahmend, der Stadt noch eine vierzigtägige Frist.» An jenem Tag war wegen der anhaltenden Unruhen auf der Landschaft eine Anfrage bei den Zünften und den Landgemeinden angesetzt worden – die Überraschung war also vollkommen.
Am Montag, 12. Juni, erliess der Zürcher Rat ein Verbot solcher Umzüge und ordnete Folgendes an: eine kleine Gruppe von Ratsleuten erhalte die Vollmacht, die Wachen an den Toren und auf dem Rathaus je nach Lage zu verstärken und Massnahmen zu ergreifen, wenn die Täufer aus Zollikon mit ihren Frauen und Kindern – zu ergänzen wäre wohl: wieder – in die Stadt hineinkämen «und über ein statt Zürich o we unnd derglich schrygen weltind». Gleichentags wurde auch Castelberger mit seiner Frau und den Kindern auf ein Schiff gesetzt und verbannt. Da er an einer Krücke ging, war die schon am 21. Januar verfügte Ausweisung mehrfach hinausgeschoben worden.
Bei der Räumung von Castelbergers Wohnung muss jener undatierte Brief, den Conrad Grebel ihm über die Umstände der Flucht von Manz geschrieben hatte, den Ratsherren in die Hände gefallen sein. Auf jeden Fall floh Grebel aus der Stadt. War es Castelberger noch gelungen, ihn zu warnen? Oder hatte Conrad Grebel die Bussdemonstration mitorganisiert und musste ohnehin eine Verhaftung befürchten?
In Abwesenheit wurde nunmehr auch eine Untersuchung gegen Conrad Grebel durchgeführt. Währenddessen trat er selbst in den Zentren des Bauernaufstands auf, unter anderem in Hinwil im Zürcher Oberland, predigte und las aus den Evangelien. Aufgefordert, sich zu stellen, verlangte Conrad Grebel freies Geleit – es wurde ihm nicht gewährt, und sein Bote wurde verhaftet, zusammen mit vieren aus Zollikon, die sich, anders als er, guten Glaubens im Zürcher Rathaus eingefunden hatten.
Die bäuerlichen Forderungen im Deutschen Bauernkrieg, vor allem die Zwölf oberschwäbischen Artikel, die zwischen dem 28. Februar und dem 3. März 1525 verfasst worden waren und einen klar evangelischen Anspruch hatten, wirkten auf jene Artikelbriefe zurück, welche die Zürcher Bauern Ende April, Anfang Mai 1525 erhoben, im Anschluss an die Besetzung der Klöster Rüti und Bubikon im Zürcher Oberland, 23. bis 25. April 1525. Die schwere Niederlage der deutschen Bauern blieb ebenfalls nicht ohne Rückwirkungen – Zürich nahm sich mit der Beantwortung der bäuerlichen Beschwerden plötzlich viel Zeit und lehnte die allermeisten Forderungen ab. Nur in der Frage des Kleinen Zehnten kam die Stadt den Bauern entgegen, und die Leibeigenen, die der Stadt Zürich gehörten, wurden für frei erklärt, mit Ausnahme derjenigen aus der Landvogtei Grüningen im Zürcher Oberland, die dadurch für die Klosterbesetzung bestraft werden sollten. Sie blieben unfrei, genauso wie die Leibeigenen aller übrigen Herren, deren Rechte Zürich schützte.
Felix Manz wurde am 7. Oktober 1525 überraschend aus der Haft entlassen. Fast scheint es, als hätten die Behörden ihn ohne sein Wissen dazu verwenden wollen, sie auf die Spur Conrad Grebels zu führen – der im Zürcher Oberland unter den enttäuschten Bauern grossen Zulauf fand. Denn schon einen Tag später, am 8. Oktober 1525, gelang der Zugriff auf Conrad Grebel und auf Blaurock, der inzwischen in die Zürcher Landschaft zurückgekehrt war. Truppen wurden bereitgestellt, um gegebenenfalls mit Zürcher Kriegsschiffen nach Zollikon gebracht zu werden («wann sie erfordert werden»). Felix Manz selbst konnte sich zwar der Verhaftung entziehen und versteckte sich im Wald oberhalb von Bäretswil in der seither so genannten «Täuferhöhle», doch am 31. Oktober 1525 wurde auch er gefasst.
In der dritten Taufdisputation, die vom 6. bis 8. November 1525 mit den Gefangenen durchgeführt worden war, erhielten sie wegen ihrer früheren Klage, Zwingli lasse niemanden zu Wort kommen, freie Redezeit. Die Veranstaltung im Grossmünster glich trotzdem eher einem öffentlichen Gerichtsverfahren – die Täufer wurden für überwunden erklärt und, da sie sich weigerten zu widerrufen, in Haft behalten.