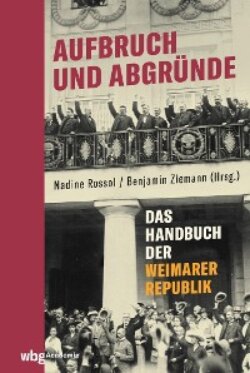Читать книгу Aufbruch und Abgründe - Группа авторов - Страница 56
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wahlen, Wahlkämpfe und Demokratie
ОглавлениеThomas Mergel
„Wer ist Sieger geblieben in diesem furchtbarsten aller Weltkriege? Die Demokratie. – Die einzige Großmacht im Kreise unserer Gegner, die keine Demokratie war, ist ebenso wie wir zusammengebrochen.“1 So formulierte die liberale „Frankfurter Zeitung“ im Umfeld der Weimarer Verfassungsberatungen ihre Lehre aus dem Weltkrieg, eine Lehre, die von vielen deshalb als alternativlos empfunden wurde, weil die einzige andere damals denkbare Option, die Monarchie, sich selbst desavouiert hatte.2 Was genau allerdings der emphatische Begriff „Demokratie“ positiv bedeuten und in welcher Weise diese Zielbestimmung in politische Strukturen übersetzt werden sollte, war nicht eindeutig zu definieren. Klar war allerdings, dass politische Entscheidungen die Legitimität einer breiten Mehrheit haben sollten. Das konnte verschiedene Formen der Ausgestaltung bedeuten. „Demokratie“ war nicht nur als System neu, sondern musste auch von neuen Spielern erprobt und gelernt werden.
Die Entscheidung für eine parlamentarische Demokratie war schon sehr bald nach der Revolution gefallen. Mit der Ernennung Max von Badens als Reichskanzler und den Oktoberreformen von 1918, die die parlamentarische Regierungsform einführten, waren die Weichen dafür gestellt, noch bevor revolutionäre Bewegungen überhaupt sichtbar waren. Damit stand im Grunde schon eine Option fest: Die Parteien der späteren „Weimarer Koalition“ (DDP, SPD und Zentrum) wollten eine Republik, mit einer parlamentarisch verfassten und verantwortlichen Regierung, die sich auf politische Parteien stützte und durch ein allgemeines Wahlrecht für alle mündigen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger legitimiert war.
Die Alternative eines Rätesystems, so intensiv sie auch in den Wintertagen um die Jahreswende 1918/19 öffentlich debattiert wurde, hatte andere Vorstellungen von Legitimität als parlamentarische Repräsentationsvorstellungen. Sie akzeptierte nämlich nicht die Idee einer allgemeinen Staatsbürgerschaft mit einem allgemeinen Wahlrecht. Stattdessen ging sie davon aus, dass nur diejenigen ein Mitspracherecht hätten, die in der Produktion (und – unter Kriegsbedingungen – im Militär) tätig waren, nicht dagegen diejenigen, die außerhalb des Lohnarbeitsprozesses standen, etwa Hausfrauen oder Rentner. Aktiv wahlberechtigt für die Räte waren also nur die „Hand- und Kopfarbeiter“ – neben den Arbeitern auch Beamte und Angestellte, aber keine Selbstständigen und Unternehmer. Auch in Bezug auf die Handlungsspielräume der Gewählten bestanden andere Vorstellungen, denn bei den Räten herrschte ein imperatives Mandat und nicht die Gewissensfreiheit des Abgeordneten. Allerdings entwickelte sich alsbald ein breiteres Verständnis des Räteprinzips, das auch Bauernräte, Bürgerräte, Lehrerräte oder Schülerräte kannte, die in der unübersichtlichen Revolutionssituation im Grunde Selbstverwaltung übten.3 Auch die Soldatenräte waren keineswegs von radikalen Gruppen beherrscht; viele ihrer Mitglieder waren überdies keine Arbeiter, sondern Bürgerliche.4 Doch als politische Verfassung stand das Rätesystem außerhalb einiger radikaler Sozialistenkreise selbst während der Revolution 1918/19 kaum zur Debatte.5
Eine auf ein allgemeines Staatsbürgerrecht gestützte parlamentarische Demokratie war daher schon in den Tagen des Winters 1918/19 ohne Alternative. Konkret wurde sie, als es um die Auswahl derer ging, die die Bürgerschaft repräsentieren und politische Entscheidungen fällen sollten. Wahlrecht, Wahlen und Wahlkämpfe standen deshalb in besonderer Weise im Blick der Kommentatoren, erst recht der historischen Rekonstruktionen nach 1945. An ihnen sollte sich zeigen, wie „demokratisch“ die Weimarer Republik war. Hinter dieser Fragestellung stand – erstens – im Gefolge der Kontinuitätsdebatte zwischen der Weimarer und der Bonner Demokratie lange Zeit eine normative Erwartung, die den Grad an Demokratie an einer Bonner Messlatte orientierte.6 Zweitens hat die Forschung über Jahrzehnte hinweg wenig beachtet, dass die Weimarer Demokratie nicht aus dem Nichts entstand, sondern auf einer langen Tradition beruhte. In den politischen Orientierungen und den Wahlentscheidungen nach 1918 zeigten sich Mentalitäten und Zugehörigkeiten, die nicht erst nach dem Ersten Weltkrieg entstanden. Diese Traditionsgebundenheit politischer Partizipation wie auch die Momente ihres Wandels liegen möglicherweise quer zu den Erwartungen, die man in der Rückschau an das politische Verhalten der „Weimarer“ haben mochte.
Im Folgenden soll es um eine Diskussion der politischen Partizipation, ihrer Regeln und ihrer Interpretationen vor dem Hintergrund dieser beiden Momente gehen: Erstens eines Begriffs von Demokratie, der nicht allein an der normativen Folie der Bundesrepublik geschult ist, und zweitens der Traditionen und Mentalitäten, die fortwirkten. Die Frage nach den Zugehörigkeiten wird im Folgenden deshalb mehr im Blick sein als die nach politischen Überzeugungen, die sich bei den Vielen gar nicht hinreichend sicher festmachen lassen. Dabei soll es wegen der Begrenztheit des Raums im Wesentlichen um die Wahlen auf Reichsebene gehen. Ausgehend von erstens der enormen Ausweitung des Elektorats und zweitens einer Diskussion der Vorstellungen von politischen Zugehörigkeiten und „guter Politik“, sollen in einem dritten Schritt die Bedingungen und Möglichkeiten politischer Partizipation im Mittelpunkt stehen. Im vierten Abschnitt rücken die Formen politischer Kommunikation und Konkurrenz im Wahlkampf in den Fokus, bevor im letzten Teil die Wahlergebnisse auch unter der Fragestellung analysiert werden sollen, welche Vorstellungen einer guten politischen Ordnung sich aus ihnen ablesen lassen.