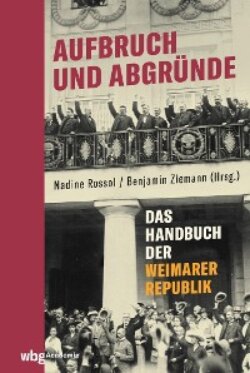Читать книгу Aufbruch und Abgründe - Группа авторов - Страница 60
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Wahlkämpfe und politische Kommunikation
ОглавлениеDas polarisierende Element galt für Wahlen generell. Die rechtsliberale „Deutsche Allgemeine Zeitung“ formulierte eine breit geteilte Einstellung, wenn sie 1920 die Reichstagswahlen als „Kampf“ bezeichnete, und zwar als „Kampf, der in seinen Mitteln wenig wählerisch ist“. Sie sprach vom „Durcheinanderfluten politischen Haders und politischer Mißgunst“, sprich: Wahlen spalteten die Gesellschaft und verfeindeten die Menschen.49 Dagegen hatten die liberalen Eliten seit dem 19. Jahrhundert ein probates Mittel gekannt: Sachlichkeit. Sie hatten die Wahlen als Teil und Ausdruck politischer Erziehung der unmündigen Massen verstanden, und deshalb waren Wahlkämpfe immer eine Gelegenheit zur politischen Pädagogik. Lange hatte sich im Kaiserreich die Gewohnheit gehalten, selbst zu Parteiveranstaltungen auch Kandidaten gegnerischer Parteien einzuladen. Das kam auch in der Weimarer Republik noch vor. Die sachliche Debatte sollte dem Krawall einen Riegel vorschieben. Nun waren die Massen mittlerweile nicht mehr so unmündig, aber dafür war die Kluft zwischen den verschiedenen Milieus und Lagern gewachsen. Dass Deutschnationale sich bei einer Wahlkampfveranstaltung von den Argumenten des DDP-Kontrahenten so sehr überzeugen ließen, dass sie ihrer Partei den Rücken kehrten und der DDP die Hand reichten, konnte als eine geradezu skurrile Geschichte Nachrichtenwert beanspruchen.50 Aber es bleibt festzuhalten, dass Wahlkampf in der Weimarer Republik nach wie vor im Wesentlichen versammlungs- und redebasiert war und einem Bild des Staatsbürgers verhaftet blieb, der kundig und interessiert den politischen Argumenten zu folgen in der Lage war.
Die deutschen Besonderheiten zeigen sich im Vergleich.51 Im Unterschied zu Großbritannien, wo der Wahlkampf dem Modell des Marktes folgte, auf dem die Kandidaten sich den Wählern als „Kunden“ anboten, zielten deutsche Kampagnen auf die Organisation von Gefolgschaft, die als nach innen homogene und nach außen diskrete gesellschaftliche Gruppe verstanden wurde. In dieser Hinsicht erschienen Wahlkämpfe als die Bühne, auf der sich die politischen Lager zeigten, sammelten und sich ihrer Anhängerschaft versicherten. Wahlveranstaltungen wandten sich weniger an diejenigen, die dem eigenen Lager fernstanden, sondern an die Überzeugten. Vorfeldorganisationen wie Kirchen, Gewerkschaften, aber auch lokale Vereine verstanden sich selbstverständlich als Wahlhelfer, die das eigene Lager mobilisieren wollten. Selbst bei Hausbesuchen wurden vornehmlich diejenigen aufgesucht, die man schon als Parteianhänger kannte. Auch ein großer Teil der Presse sah sich als parteinah, wenn nicht gar als verlängerter Arm der Parteipolitik, und keineswegs als neutral berichtende Stimme im Konzert der politischen Öffentlichkeit.52 Die Suggestion der Rationalität aber blieb erhalten. Wahlkämpfe waren keine karnevaleske Show mit viel Alkohol und Raufereien, wie es in England Tradition war, sondern schrift- und redebasierte Unterweisung und/oder Diskussion der beteiligten Kandidaten, weniger unter freiem Himmel als in geschlossenen Räumen, häufig mit Eintrittsgeld. Das galt auch für das Wahlkampfmaterial der Parteien selbst, das sich in Fortführung der politischen Kommunikation des Kaiserreichs als Bleiwüstenkultur präsentierte – und dies in solchen Massen, dass vor der Wahl die großen Plätze von Flugblättern bedeckt waren. Eine neuerliche Konjunktur erlebte auch das von Parteien herausgegebene, im Kaiserreich erfundene Wahlkampfhandbuch, das mehrere Hundert Seiten umfassen konnte, Geld kostete und gewissermaßen ein Kompendium aller Argumente für eine Partei umfasste: nebenher auch ein Stück politischer Bildung.
Allerdings eröffneten neue Medien auch neue Formen der politischen Kommunikation, die über die eigenen Milieugrenzen hinausreichen konnten.53 Das galt nicht für den Rundfunk, der im Wesentlichen als ein staatliches Bildungsorgan verstanden wurde. 1924 waren einige Wahlreden übertragen worden, aber auf Betreiben der meisten Parteien und des Innenministers wurde diese Praxis wieder abgestellt. Auch das Kino wurde noch wenig zur Massenkommunikation genutzt, weil es hauptsächlich eine städtische Angelegenheit war, und über erste Versuche ist die Werbung mit bewegten Bildern in der Weimarer Republik nicht hinausgekommen. Neue Druck- und Vervielfältigungstechniken aber eröffneten neue Möglichkeiten für Bilder in Papiermedien. Ab 1924, verstärkt 1928, stellte die SPD ihre Kandidaten auch in ihren Zeitungen mit Bild und Bildunterschrift vor, wie etwa „Franz Künstler, Maschinenschlosser aus Berlin-Neukölln. Der Typus des aus eigener Kraft vorwärtsstrebenden Arbeiters. Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Gross-Berlins und damit Leiter des Wahlkampfes in den Berliner Wahlkreisen.“54 Trotz des Verhältniswahlrechts wollte man seine Kandidaten als Personen präsentieren. Auch die Illustrierten nahmen die Politiker gerne als Ikonen auf.
Auffälliger als die realistische Personalisierung im Bild war eine politische Ikonografie, die sich grundlegend von den Bildkulturen in der Werbung oder der Fotografie unterschied.55 Große, farbstarke Plakate präsentierten politische Symbole, die Parteien zugeordnet werden sollten und die sich gegenseitig Konkurrenz um die visuelle Besetzung des öffentlichen Raums machten. Bereits 1920 traten Plakatabreißkolonnen auf den Plan, und die staatliche Verwaltung mühte sich, um den öffentlichen Raum einigermaßen reguliert zu halten.56 Diese neuen technischen Mittel kamen vor allem in den Städten zum Einsatz. Für die Provinz sollte man ihren Einfluss jedoch nicht überschätzen. Auf den Dörfern und in den kleinen Städten war Wahlkampf nach wie vor im Wesentlichen Versammlungswahlkampf, mit Reden und Rednern, häufig durchaus mit Diskussionen, mit Flugblättern und vielleicht kleinen Umzügen.
Das galt auch für die Nationalsozialisten. Ihnen hat man lange Zeit einen technisch und ästhetisch revolutionären Wahlkampf attestiert, der auf einer „aufrüttelnden“, emotionalisierenden Bildpropaganda beruhte, die häufig verblüffende Ähnlichkeit mit der Bildsprache der kommunistischen Propaganda aufwies.57 Die neuere Forschung streicht demgegenüber den Charakter des Nationalsozialismus als einer Versammlungsbewegung heraus, die bis in die kleinen Städte und Dörfer reichte und dort das Vereinsleben und die Honoratioren infizierte.58 Auf diesen Versammlungen, häufig über Eintrittsgelder finanziert, wurde vor allem gesprochen, sodass sich der Nationalsozialismus trotz seiner sensitiven Anmutungen durch Bilder, Aufmärsche und Lichtdome – fast alles Momente, die erst nach 1933 zum Tragen kamen – in die sprachzentrierte Tradition der deutschen politischen Kommunikation stellte. Das rasche Aufgreifen der neuen akustischen Verstärkungstechnologien, Mikrofon und Lautsprecher, ermöglichte den Nationalsozialisten die Beschallung größerer, zentraler Veranstaltungen, und zwar so, dass Dissens nicht mehr gehört wurde.59
Auch wenn Wahlveranstaltungen der Nationalsozialisten in vielen Bereichen nach gängigen politischen Konventionen gestaltet waren, fokussierten sie sich auf eine personalistische Präsentation Adolf Hitlers als „Führer“ und populistischen Tribun der Massen. Seit dem Ende der 1920er Jahre wurde dieses Image immer mehr professionalisiert und in die Provinz getragen. Hitler wurde zu einem „Markenartikel“ ausgebaut, und deshalb hieß die NS-Bewegung auf den Wahlzetteln „Hitler-Bewegung“.60 Adolf Hitler, der bis 1932 kein deutscher Staatsbürger war und bis dahin also auch nicht gewählt werden konnte, figurierte in den Wahlkämpfen als Symbol für eine politische Sehnsucht, die sich in einer Person repräsentiert sehen wollte. Bei den Reichspräsidentenwahlen 1932 wurde dieses Konzept konsequent umgesetzt. Hitler unternahm im April 1932 eine deutschlandweite Wahlkampfreise – mit dem Flugzeug. In sieben Tagen besuchte er 21 Städte. Drei- bis viermal am Tag schwebte er an einem anderen Ort ein, begeistert begrüßt von einer sorgsam choreografierten Menge, hielt eine Rede und entschwand wieder in die Lüfte. Die Filmemacherin Leni Riefenstahl begleitete diesen „Deutschlandflug“. Ihr Film „Hitler über Deutschland“ war ein – ästhetisch wegweisendes – Propagandaprodukt, das personale Zugänglichkeit, vergegenständlicht in Massen von begeisterten Menschen, vor allem jungen, mit der Position des fliegenden Hitler „über“ Deutschland verknüpfte und so die Führersehnsucht an die Person Hitlers band.61
Das war nicht selbstverständlich so. Die Sehnsucht nach einem Führer dieser Art war in der Weimarer Republik allgegenwärtig, beschränkte sich aber keineswegs auf die antirepublikanische Rechte. Am Horizont stand nicht in erster Linie die Sehnsucht nach einer Diktatur, sondern nach einer organischen Einheit von politischer Führung und Volk.62 Die Suche nach einem Führer, der – ganz im Sinne Max Webers – das Charisma besaß und über die Legitimität verfügte, für alle zu sprechen und so die Deutschen zu einer Einheit zusammenzuschweißen, war auf der Linken, erst recht in der bürgerlichen Mitte, genauso spürbar wie auf der Rechten. Es wurde nach einem solchen Führer gesucht, der sich kraft Charismas über die politische „Maschine“ der Republik hinwegsetzen und als Persönlichkeit die Authentizität mitbringen würde, die Führung und Gefolgschaft versöhnen könnte.63 Hitlers Führerrepräsentation nahm sowohl die Vorstellungen der Linken auf, dass es sich um einen Mann aus dem Volk handeln müsse, als auch die der Rechten, dass es um eine entschlossene Führung, auch gegenüber dem Ausland, gehen solle. In den beiden Begriffen, dem Nationalen und dem Sozialistischen, verbanden sich zwei Erwartungen an eine homogene, harmonische Einheit.