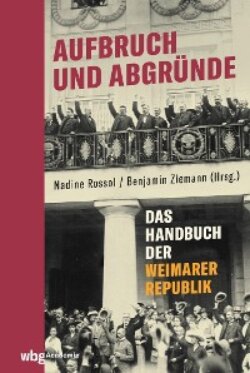Читать книгу Aufbruch und Abgründe - Группа авторов - Страница 62
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Schluss
ОглавлениеDie Weltwirtschaftskrise beschleunigte ein Unwohlsein in der Parteienrepublik, das nicht so sehr mit den tatsächlichen Leistungen oder Verfehlungen des politischen Systems und auch nicht viel mit einem intrinsischen demokratischen Bewusstsein zu tun hatte, sondern das die politischen Mechanismen und Konflikte an einer Sozialidee maß, die eine Gesellschaft der Ähnlichkeit anstatt der interessenpolitischen oder weltanschaulichen Differenz wollte. Diese Gesellschaft sollte am Ende auch die eigene Milieu- oder Lagerzentrierung überwinden; eine straff geführte politische Ordnung anstatt einer Aushandlungsdemokratie; eine Einigung im Zeichen der außenpolitischen Gegner und des tiefen Traumas, das die Weltkriegsniederlage hinterlassen hatte. Viele dieser Sehnsüchte speisten sich aus dem Weltkrieg, dessen mythisierte Gemeinschaft ein ums andere Mal als Gegenfolie herhalten musste. Freilich aber – und das hatte sich seit 1918 grundlegend geändert – wollten die Weimarer Bürger nicht mehr von einer Obrigkeit alten Stils regiert werden.
Man kann insofern trotz ihres Endes die Geschichte der Weimarer Republik als die einer Demokratisierung beschreiben. Das gilt nicht nur für den Grad an Inklusion und Ausweitung der Staatsbürgerschaft, nicht nur in Hinsicht auf die direkte Partizipation der Bürger. Anstatt einen normativen Begriff von Demokratie im Sinne unserer heutigen, liberalen parlamentarischen Demokratie als Messlatte zu nehmen und zurückzuprojizieren, scheint es geraten, unabhängig von den jeweils verfolgten politischen Zielen nach dem Telos der Demokratie in ihrem herkömmlichen Sinn als Volksherrschaft zu fragen. Die Weimarer Bürger waren insgesamt an Politik sehr interessiert, und trotz zwischendurch sinkender Wahlbeteiligung (aber niemals unter 75 Prozent: 1928) haben sie fleißig gewählt, so viel wie und teilweise mehr als in den meisten anderen europäischen Staaten.76 Sie wählten nun aber zunehmend Parteien und Politiker, die nach westlich-liberalem Muster nicht als „demokratisch“ gelten konnten (und das galt keineswegs nur für die Nationalsozialisten). Doch auch diese Wahl war eine Wahl. Sie entstand aus einem Bedürfnis nach Führung und Autorität, nach klarer Richtung und Zugehörigkeit. Damit lagen die Wähler in der Weimarer Republik auf einer ähnlichen Linie wie diejenigen anderer europäischer Länder; auch in anderen Staaten der Zwischenkriegszeit waren Nationalismus und das Bedürfnis nach starken Führern verbreitet. In diesem Zusammenhang mag es erkenntnisträchtiger sein, die Weimarer Republik an ihren Nachbarn im Osten und Süden zu messen anstatt an den westeuropäischen Nachbarn, die erst nach 1945 zu breit geteilten Vorbildern wurden.
Dass man, wie Carl Schmitt meinte, es auch „Demokratie“ nennen müsse, wenn statt einer großen Anzahl von Vertrauensleuten des Volkes (= des Parlaments) nur ein einziger Vertrauensmann entscheide,77 dass also der plebiszitär legitimierte Diktator eben genauso Volksvertreter sei wie ein Parlament und als „selbst gewählter Führer der Massen“ auch gegen die Apparate von Verwaltung und Verbänden etwas durchsetzen könne: das verwies auf eine Vorstellung vom Volkswillen, die wenig mit Pluralität anfangen konnte, umso mehr aber mit der Vorstellung von einem einheitlichen Staatsbürgervolk und einem daraus erwachsendem einheitlichem volonté générale. Diese Vorstellung war breit geteilt. Dass am Ende ein Adolf Hitler stehen würde, war zu Beginn der Republik nicht vorstellbar. Dass dieser allerdings ein von weiten Kreisen des „Volks“, wenn nicht ersehnter, doch jedenfalls akzeptabler Führer war: Das steht außer Frage.