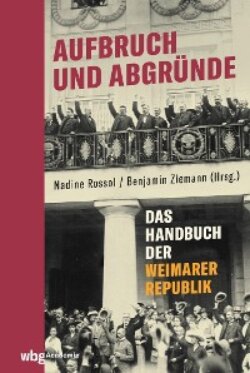Читать книгу Aufbruch und Abgründe - Группа авторов - Страница 43
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Zwischen parlamentarischer und präsidialer Demokratie
ОглавлениеIn Deutschland hatte man sich in den Jahren vor 1918 kaum ernsthaft mit der Idee einer rechtsstaatlichen Demokratie auseinandergesetzt. Zwar hatte der Soziologe und Nationalliberale Max Weber während des Krieges beißende Kritik an der deutschen Politik geübt und ein robusteres Parlament gefordert, doch angesichts der Revolution wirkte sein Vorschlag nun eher zaghaft. Zudem gab es nur wenige konkrete Modelle demokratischer Republiken, auf die man sich stützen konnte. Die Vereinigten Staaten waren das älteste Beispiel, das starke präsidiale Autorität mit einer strikten Gewaltenteilung (und einer Reihe von Kuriositäten wie dem Wahlkollegium) verband. Doch war die US-Verfassung nur ein halbes Jahrhundert zuvor nicht imstande gewesen, die Republik zusammenzuhalten. Der US-Präsident konnte seine eigenen Regierungen bilden und hatte weitgehende Kontrolle über ein Patronagesystem von Beamten. Obwohl der Kongress die Ambitionen des Präsidenten drastisch einschränken konnte, sei es durch seine Kontrolle über den Haushalt oder auf andere Weise, gab es eine scharfe Trennlinie zwischen dem Kongress und dem präsidialen Kabinett. Das US-System begünstigte unprofessionelle Beamte, übermächtige Führungskräfte und eine unverantwortliche Legislative und stellte insofern kein Modell dar, dem die deutschen Gründer nacheifern wollten. Das andere wichtige Modell, das zur Verfügung stand, stammte aus der Dritten Französischen Republik, die nach der französischen Niederlage gegen Deutschland im Jahr 1871 geschaffen wurde. Dieses parlamentarische System war jedoch instabil (zumindest auf Koalitionsebene; viele Minister blieben tatsächlich über Jahre in ihren Ämtern) und ohne eine starke Exekutive.14 Die Suche der Verfassungsgeber der Weimarer Verfassung nach einer Alternative zu beiden Modellen resultierte in einem seither als „semipräsidentiell“ beschriebenen System, das darauf abzielte, sowohl den Präsidenten als auch das Parlament zu stärken und beide miteinander zu verbinden.15
Der Reichstag bildete das zentrale Element der neuen Demokratie und war dementsprechend das erste Staatsorgan, das in der Verfassung detailliert beschrieben wurde. Über die Zentralität des Reichstags gab es in der Nationalversammlung einen annähernden Konsens; die Verteidiger einer Räterepublik blieben eher marginal. Gleichzeitig war jedoch auch das Misstrauen gegenüber dem Parlament als Institution weit verbreitet, vor allem auf dem rechten Flügel. Der Reichstag wurde von allen Männern und Frauen über 20 Jahren gewählt, was die Weimarer Republik demokratischer machte als die Vereinigten Staaten bis zur Mitte der 1960er Jahre mit ihrer Entrechtung armer und afroamerikanischer Wählerinnen und Wähler, als Frankreich, das Frauen ausschloss, und als Großbritannien, das viele Frauen auch nach dem Representation of the People Act von 1918 von der Wahl ausschloss. Auch über das allgemeine Wahlrecht herrschte breite Übereinstimmung, obwohl selbst innerhalb der Deutschen Demokratischen Partei (DDP) Unbehagen darüber herrschte, allen Frauen das Wahlrecht zu gewähren.
Die Verfassung legte ebenfalls fest, dass die Abgeordneten nach dem „Grundsatz der Verhältniswahl“ (Art. 22) gewählt werden. Dies war eine Reaktion darauf, dass die Einteilung der Wahlkreise vor dem Krieg städtische und insbesondere sozialdemokratische Wählerstimmen benachteiligt hatte. Obwohl sich viele Liberale und Konservative ursprünglich gegen das Verhältniswahlrecht, das die Macht der Parteien stärkte, zugunsten der Mehrheitswahl ausgesprochen hatten, stimmten sie letztlich dem Verhältniswahlrecht bei den Wahlen zur Nationalversammlung 1919 zu. Denn sie befürchteten, dass ein erdrutschartiges Abstimmungsergebnis zugunsten der Linken ihre eigenen Parteien sonst nahezu verdrängen würde. Die Nationalversammlung begrüßte diese Entscheidung für das Verhältniswahlrecht und den Parteienpluralismus. Das von der Verfassung geforderte Prinzip der Verhältniswahl konnte in vielen verschiedenen Formen garantiert werden. In der Weimarer Republik wies es im Wesentlichen jeder Partei die Anzahl von Abgeordneten zu, die der Gesamtstimmenzahl der jeweiligen Partei entsprach. Wenn also zum Beispiel eine Partei genügend Stimmen für 25 Kandidaten erhielt, wurden die Kandidaten Nummer 1 bis 25 auf der Parteiliste zu Abgeordneten. Dieses Verfahren gab den Parteien weitreichende Macht über ihre einzelnen Vertreter, da sie die Listen erstellten. Es ermöglichte außerdem eine Vielzahl von Parteien in einem Land, das politisch zersplittert war, was wiederum viele verschiedene politische Positionen im Reichstag bedeutete. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wahlsystem für den Reichstag den Parteienpluralismus anerkannte und verstärkte – und zwar absichtlich. Doch gerade dieser Parteienpluralismus beunruhigte die Kritiker.
Der Reichstag entwickelte und kontrollierte seine eigenen Regeln, er stand nicht unter der Aufsicht anderer Teile des politischen Systems. Mindestens alle vier Jahre fanden Wahlen zum Reichstag statt. In der Praxis stellte jedoch das Recht des Reichspräsidenten, den Reichstag aufzulösen, sicher, dass kein Parlament eine volle Legislaturperiode lang im Amt blieb. Dennoch gab es mehr Kontinuität, als es auf den ersten Blick erscheinen mag, da einzelne Personen wie Außenminister Gustav Stresemann unter aufeinanderfolgenden Regierungen dienten – in seinem Fall von 1923 bis 1929.16 Der Reichstag hatte zudem die Macht, das Erscheinen eines Kanzlers oder Ministers vor dem Reichstag zu verlangen, und er hatte die Befugnis, sein mangelndes Vertrauen in den Reichskanzler oder einen Minister zu erklären und damit den Rücktritt einzelner Personen oder der gesamten Regierung zu erwirken (Art. 54). Insofern konnte der Reichstag nun, anders als in der alten Verfassung, die politische Kontrolle über die Regierung ausüben. Zusätzlich zu diesen Kontrollen konnten 20 Prozent der Abgeordneten einen Untersuchungsausschuss über die Aktivitäten der Regierung bilden, die es Kritikern aus der Opposition ermöglichte, Handlungen der Regierung aufzudecken (Art. 34). Und nicht zuletzt konnte der Reichstag gegen Regierungsmitglieder und sogar den Reichspräsidenten wegen Gesetzesverstößen Anklage erheben und eine Klage vor dem neuen Staatsgerichtshof, eine Art Verfassungsgericht mit begrenzter Zuständigkeit, anstrengen (Art. 59). Aus Sicht ihrer Gründer schien die Weimarer Verfassung also ein starkes Parlament zu gewährleisten.
Gleichzeitig etablierte sie aber auch einen starken Reichspräsidenten, der handlungsfähig war, wenn sich das Parlament als handlungsunfähig oder unverantwortlich erwies. Der starke Reichspräsident war für viele Sozialdemokraten und sicherlich auch für die Unabhängigen Sozialdemokraten ein strittiger Punkt. Die Konservativen, Liberalen und die katholische Zentrumspartei schlossen sich jedoch den Argumenten von Hugo Preuß und Max Weber an, denen zufolge die politischen Parteien, die noch unter dem alten Regime gegründet worden waren, nicht verantwortungsbewusst genug sein könnten, um die Macht im Interesse der ganzen Nation auszuüben.17 Die Verfassung schrieb vor, dass der Reichspräsident mindestens 35 Jahre alt sein müsse; andere Forderungen, wie etwa, dass er (oder sie) mindestens zehn Jahre lang Staatsbürger zu sein habe – was Hitler ausgeschlossen hätte –, wurden von der Nationalversammlung abgelehnt. Der Reichspräsident wurde vom „ganzen deutschen Volke“ (Art. 41) in einer zweistufigen Abstimmung gewählt: Ergab die erste Abstimmung, bei der viele Parteien ihre Kandidaten vorschlugen, keine absolute Mehrheit, so fand ein zweiter Wahlgang statt. Der zweite Wahlgang war keine Stichwahl unter den Spitzenkandidaten, sondern eine Wahl, bei der auch neue Kandidaten ins Rennen gehen konnten, wie es Paul von Hindenburg 1925 und Adolf Hitler 1932 taten. Im zweiten Wahlgang war eine einfache Mehrheit erforderlich, um den Reichspräsidenten zu wählen.
Das Ziel lag darin, einen einzigen exekutiven Vertreter der gesamten Bevölkerung zu benennen. Doch ein Reichspräsident allein schuf noch keine politisch geeinte Nation. Das komplexe System brachte Kandidaten aus mehreren Parteien hervor. Die Reichspräsidentschaftswahl war daher kein Plebiszit mit der Absicht, eine einzige Führungsfigur zu bestätigen. Vielmehr ließ sie eine große Zahl von Wählerinnen und Wählern im Lager der unterlegenen Partei zurück und beraubte sie so für die lange siebenjährige Amtszeit (ohne Begrenzung der Amtszeiten) einer repräsentativen „Stimme“ im Reichspräsidentenamt. Präsidialsysteme tragen nicht notwendig zu einer größeren Legitimität der Regierung bei, sondern können zu größerem Misstrauen und Uneinigkeit bei den Gegnern führen.18 Die Behauptung vieler Rechter, der Reichspräsident habe die vereinte Nation repräsentiert, während die Vielzahl der Parteien die Nation zersplittert habe, entsprach nicht der empirischen Realität. Die politischen Implikationen dieser beiden unterschiedlichen Auffassungen von Demokratie – vereinte Nation unter einem Führer oder pluralistische, in einem Parlament organisierte Interessen – wurden erst im Laufe der Republik allmählich deutlich, zum Beispiel in der am Ende dieses Abschnitts beschriebenen Debatte unter Juristen.19
Der Reichspräsident verfügte über weitreichende Befugnisse. Er ernannte den Reichskanzler und die Minister und hatte das Recht, sie nach Belieben abzusetzen. Die Verfassung sah nicht vor, dass die Parteien im Reichstag dem Präsidenten Kabinettsvorschläge unterbreiten, wie es in einem parlamentarischen System der Fall wäre (Art. 53). Artikel 54 gab, wie bereits erwähnt, dem Reichstag zwar das Recht, einem Minister das Vertrauen zu entziehen, doch war dies ein negativer und kein positiver Akt. Die Befugnis zur Kabinettsbildung lag beim Reichspräsidenten, nicht beim Reichstag. Zudem befehligte der Reichspräsident die Streitkräfte direkt (Art. 47), nach dem Vorbild der USA. Artikel 48 räumte dem Reichspräsidenten weitreichende Notstandsbefugnisse ein: So konnte er die Bundesstaaten (umbenannt in Länder, um deren Statusverlust zu betonen) zwingen, dem Reichsrecht zu folgen (Abs. 1) und bestimmte verfassungsmäßige Rechte im Rahmen der Wiederherstellung der „öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ auszusetzen (Abs. 2). Diese Notstandsbefugnisse sollten sich in den ersten Jahren der Republik als unerlässlich erweisen, da sich Reichspräsident Ebert 1919 und 1920 mit der Gefahr eines Bürgerkriegs von links und rechts, 1923 mit der französischen Besetzung des Ruhrgebiets und 1923 mit dem Hitler-Ludendorff-Putsch konfrontiert sah. Ebert bediente sich des Artikels 48 ausgiebig, um Aufständen entgegenzutreten, 1923 sogar, um eine linke Regierung in Sachsen abzusetzen, die begonnen hatte, gegen die Verfassung zu verstoßen. Während der wirtschaftlichen und sozialen Umwälzungen zwischen 1922 und 1924 nutzte er den Artikel 48 sogar zur Verabschiedung von Gesetzen – zwar in Abstimmung mit dem Reichstag, aber dennoch nicht in einem regulären Gesetzgebungsverfahren. Ebert dehnte den Anwendungsrahmen des Artikels 48 drastisch aus. Während Ebert Notstandsverordnungen zum Schutz der Republik benutzte, diente Artikel 48 später als Werkzeug für die Kamarilla um Reichspräsident Hindenburg, die nach 1929 eine autoritärere Regierung anstrebte.20
Trotz der unterschiedlichen Wege, mit denen Artikel 48 letztlich zum Ende der Republik beigetragen hat, sollte nicht vergessen werden, dass er ursprünglich als Bestandteil eines Systems der Gewaltenteilung gedacht war. So hatte der Reichstag zum Beispiel das Recht, vom Reichspräsidenten die Aussetzung von Notverordnungen zu verlangen (Art. 48, Abs. 3). Das Parlament konnte die Ausrufung des Ausnahmezustands durch die Reichsregierung anfechten, wie es 1930 und 1932 geschah. Darüber hinaus verpflichtete die Verfassung den Reichstag, klarere Richtlinien für die Ausübung von Notstandsbefugnissen zu entwickeln (Art. 48 Abs. 5). Die parlamentarischen Versuche nach 1925, die Befugnisse des Reichspräsidenten auf diese Weise zu definieren und zu begrenzen, wurden jedoch von den Konservativen um Hindenburg abgelehnt und untergraben, wobei sie sich bei ihren Plänen für ein Präsidialregime wiederum auf eine breit gefasste Definition von Notstandsbefugnissen stützten.21 Der Reichstag hatte ebenfalls das Recht, den Reichspräsidenten abzusetzen (Art. 43, Abs. 2). Dieses Verfahren gestaltete sich in der Praxis jedoch schwierig: Erstens musste der Reichstag dem Antrag mit einer Zweidrittelmehrheit zustimmen; zweitens musste der Vorschlag zur Absetzung des Reichspräsidenten als Volksabstimmung dem deutschen Volk vorgelegt werden. Im Vergleich dazu war das Recht des Reichspräsidenten, das Parlament aufzulösen (Art. 25), einfach und direkt. Er war formal daran gehindert, das Parlament zweimal aus dem gleichen Grund aufzulösen, doch erscheint in der Politik jeder Vorfall etwas unterschiedlich, sodass diese Regel wenig praktische Wirkung hatte.
Artikel 48 war nicht dazu bestimmt, das Parlament zu untergraben, sondern es in schwierigen Zeiten zu unterstützen. Genauso hat Reichspräsident Ebert, ein engagierter Demokrat, den Artikel in den ersten, schwierigen Jahren der Republik auch genutzt. Sein Ziel war es, die Ordnung wiederherzustellen; er tat dies jedoch in Zusammenarbeit mit dem Parlament, um es zu stärken. Reichspräsident Hindenburg hingegen benutzte Artikel 48 in der Krisenzeit, um die Macht des Reichspräsidenten zu stärken. Er strebte an, „überparteiliche“ Minister zu ernennen, die nicht an einzelne Parteien im Parlament gebunden waren, was die parteienfeindliche und antidemokratische Stimmung der Rechten widerspiegelte. Seine antiparlamentarische Haltung wurde noch verstärkt durch die mangelnde Bereitschaft der Parteien, in den schwierigen Jahren der Republik Verantwortung zu übernehmen.
Hindenburgs antiparlamentarische Absichten wurden 1930 deutlich, als eine große Koalition unter dem Druck der Forderungen nach einer Kürzung der Arbeitslosenversicherung während der Weltwirtschaftskrise zerbrach. Der Vorsitzende der Zentrumspartei Heinrich Brüning wurde am 29. März 1930 zum Reichskanzler eines „Präsidialkabinetts“ ohne parlamentarische Mehrheit ernannt. Er legte dem Reichstag im Juli 1930 ohne Beratung einen Haushaltsentwurf vor, den das Parlament ablehnte. Die Reichsregierung setzte daraufhin den gleichen Gesetzentwurf mittels Artikel 48 durch, was den Reichstag dazu veranlasste, die Notverordnung aufzuheben. Hindenburg löste daraufhin den Reichstag auf, setzte die Notverordnung wieder in Kraft und setzte Neuwahlen an. Bei den Wahlen am 14. September 1930 erhielt die NSDAP 18,3 Prozent und die KPD 13,1 Prozent der Stimmen; Protestwähler neutralisierten das Parlament mit Erfolg. Um eine weitere, noch katastrophalere Wahl zu vermeiden, mussten die demokratischen Parteien des Reichstags den Präsidialerlass tolerieren. Hindenburgs Anwendung von Artikel 48 hatte ihm geholfen, eine Krise herbeizuführen, die das Parlament lähmte, die ihn aber auch ohne klare Volksbasis ließ und den endgültigen Zusammenbruch der Republik 1932/33 in Gang setzte. Die Autoren der Weimarer Verfassung hatten niemals die Absicht, einen Vertreter des alten Regimes wie Hindenburg mit derartigen Befugnissen auszustatten. Doch genau dies hatten sie getan.22
Reichspräsident und Parlament vertraten in diesem Balanceakt die Nation auf unterschiedliche Weise. Der Reichspräsident sprach mit einer Stimme und schien die gesamte Nation zu vertreten. Das Parlament hingegen sprach mit vielen Stimmen, denn das Abstimmungssystem stellte ja gerade sicher, dass Parteien mit unterschiedlichen Meinungen vertreten waren. Mit anderen Worten, beide artikulierten den „Volkswillen“ unterschiedlich – und dies wirkte sich wiederum auf die Art und Weise aus, wie die Verfassung verstanden wurde. Die Verfassungskonzeption von Hugo Preuß spiegelte in vielerlei Hinsicht die Vorstellungen der Gründerväter der Vereinigten Staaten wider. In beiden Vorstellungen existierte „das Volk“ auf verschiedenartige Weise im politischen Prozess. Es war durch seine vielfältigen Stimmen und die Pluralität der Parteien im Reichstag vertreten und spiegelte damit die gesellschaftliche Realität wider. Es war zudem im Reichspräsidenten durch eine einzelne Person vertreten, um ein Gegengewicht zum Pluralismus des Reichstags zu schaffen. Darüber hinaus konnte das Volk durch Gesetzesinitiativen und Volksabstimmungen (im nächsten Abschnitt erörtert) direkt handeln. Mit anderen Worten: Die Verfassung (und Preuß) lehnte die Vorstellung ab, wonach der Wille des Volkes nur durch ein einziges Organ oder einen einzigen Prozess zum Ausdruck kommt, ebenso wie die Föderalisten in den USA versuchten, Schutzmechanismen gegen die Usurpation durch ein Amt einzurichten.23
Hermann Heller, einer der wenigen Sozialdemokraten unter den führenden Verfassungstheoretikern der Republik, entwickelte eine überzeugende Theorie dieser Vorstellung von Demokratie als einem Prozess der Bildung eines „Volkswillens“. Demnach erzwang der Prozess selbst die Kommunikation von Prinzipien und Interessen und führte möglicherweise zu einem anderen Ergebnis als die direkte Meinungsäußerung im Vorfeld eines solchen Prozesses. Hellers Ansatz lehnte wie der von Preuß die Vorstellung ab, dass der Wille des Volkes bereits vor dem Verfassungsgebungsprozess existierte, wie es in der Weimarer Republik sowohl die rechtsextremen als auch die linksextremen Parteien unterstellten.24 Heller und Preuß gingen beide davon aus, dass eine Verfassung eine Art tieferliegenden nationalen Wertekonsens erfordere, eine Annahme, die andere Demokraten nicht unbedingt teilten. Der Jurist Hans Kelsen, selbst maßgeblich an der Ausarbeitung der neuen demokratischen Verfassung Österreichs beteiligt, dachte über Demokratie in ähnlicher Weise wie Preuß und Heller nach, jedoch mit dem entscheidenden Unterschied, dass für Kelsen der „Volkswille“ lediglich als Ideologie existierte. Für Kelsen war Demokratie ein Prozess der Interessen- und Machtorganisation, nicht die Spiegelung eines grundlegenden Konsenses, den er für nicht existent hielt. Das Argument für ein demokratisches System bestand nicht darin, dass es den Willen der gesamten Bevölkerung zum Ausdruck bringe, da dies empirisch schlicht nicht der Fall war. Das Argument lautete vielmehr, dass das demokratische System die meisten Menschen besser zufriedenstellte als jedes andere System, zudem ließ es die Möglichkeit offen, dass eine andere Mehrheit den „Volkswillen“ in Zukunft ändern könnte.25 Kelsens Ansatz war ohne Zweifel für viele insofern beunruhigend, auch für Heller auf der Linken, als Kelsen behauptete, dass die Bürger demokratisch herbeigeführte Entscheidungen als rechtmäßig zu akzeptieren hätten, auch wenn diese auf Werten beruhten, mit denen sie nicht einverstanden waren. Dies sei der Preis dafür, die Tatsache des Pluralismus und das Wagnis der demokratischen Selbstbestimmung anzunehmen, wie Kelsen und auch andere zeitgenössische Juristen der gemäßigten Linken, wie Gustav Radbruch, argumentierten.26
Ein Großteil der Rechten hing weiterhin der Vorstellung von der im Krieg geeinten Nation an und betrachtete Parteien und Parlament als eine künstliche Spaltung der Nation. Einige, wie der ehemalige General Ludendorff, brachten ihren Glauben an eine geeinte und homogene Nation in gewalttätigen Aktionen zum Ausdruck, während andere versuchten, die Republik in ein autoritäres Regime auf der Grundlage einer plebiszitären Entscheidung umzuwandeln. Ihre Argumente waren zwar antiparlamentarisch, machten aber dennoch Gebrauch von der Idee der nationalen oder vom Volk ausgehenden Selbstbestimmung. So waren auch sie an der Debatte darüber, was Demokratie ist, beteiligt, selbst wenn sie den Autoritarismus befürworteten.27