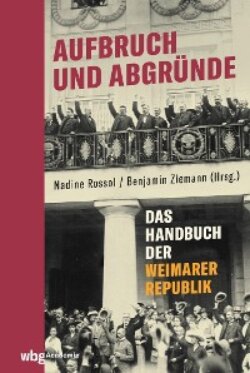Читать книгу Aufbruch und Abgründe - Группа авторов - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Koalitionsbildung im Parlament
ОглавлениеAls Friedrich Ebert im Februar 1924 den militärischen Ausnahmezustand aufhob, war das Kabinett des Zentrumspolitikers Wilhelm Marx bereits seit einigen Wochen im Amt. Unterstützt durch wechselnde Koalitionsparteien und ein am 8. Dezember verabschiedetes, zeitlich begrenztes Ermächtigungsgesetz hatte die Regierung das Mandat, verschiedene finanzielle und wirtschaftliche Maßnahmen zu erlassen und dadurch schrittweise eine Währungsreform auf den Weg zu bringen. Für eine Analyse der Koalitionsbildung ist es allerdings sinnvoller, den Untersuchungszeitraum etwas später anzusetzen und mit dem Kabinett Marx II zu beginnen, das nach den Reichstagswahlen vom 4. Mai gebildet wurde. Diese Minderheitsregierung setzte sich aus parteilosen Ministern und Vertretern der drei bürgerlichen Parteien – dem Zentrum, der DDP und der DVP – zusammen. Sie hatte nur 138 der 472 Reichstagsabgeordneten hinter sich und war daher von Fall zu Fall angewiesen auf die Unterstützung entweder der SPD mit 100 Sitzen oder der nationalkonservativen DNVP und anderer rechter Parteien, die etwas mehr als 95 Abgeordnete stellten. Diese Situation war langfristig kaum tragfähig. So wurde der im Mai 1924 gewählte Reichstag schließlich am 20. Oktober 1924 wieder aufgelöst. In seiner letzten Sitzung am 30. August bewilligte er, ohne eine formale Abstimmung, die Einführung der neuen, durch Gold gedeckten Reichsmark und erfüllte damit eine Bedingung des Dawes-Plans.15
Die Reichstagswahlen am 7. Dezember 1924 führten einen Monat später zum Rücktritt der zweiten Regierung Marx und zur Bildung der ersten Bürgerblock-Regierung mit rein bürgerlicher Kabinettsbeteiligung unter der Leitung des ehemaligen Finanzministers und parteilosen Technokraten Luther und mit den vier wichtigsten rechts von der Mitte angesiedelten Parteien Zentrum, DVP, DNVP und BVP. Diese Regierung kam mit 242, beziehungsweise 274, von 493 Stimmen (je nachdem, ob die linksliberale DDP im Reichstag mitspielte oder nicht) näher an eine Mehrheit heran. Sie konnte sich fast bis Ende 1925 halten, als die DNVP aus Protest gegen die Verträge von Locarno, vor allem den Rhein- oder Westpakt, denen zufolge Deutschland die neuen, nach 1919 gezogenen Grenzen Westeuropas formal anerkennen musste, die Regierung verließ. Kurz darauf billigte der Reichstag die Locarno-Verträge mit den Stimmen der SPD. Doch die Weigerung der Sozialdemokraten, sich in innen- und wehrpolitischen Fragen mit der DVP zu verständigen, verhinderte, zumindest vorläufig, die Bildung einer Großen Koalition.16 Stattdessen konnte Luther als Reichskanzler mit einer umgestalteten bürgerlichen Minderheitsregierung bis Mai 1926 weiterregieren.
Von Mai 1926 bis Juni 1928 leitete Marx zwei weitere bürgerliche Minderheitsregierungen, die erste ohne Beteiligung der DNVP und ab Januar 1927 die zweite, eine wiederbelebte Bürgerblock-Regierung mit einigen DNVP-Ministern, einschließlich Oskar Hergt als Vizekanzler und Justizminister. Es bleibt umstritten, ob sich die bis dahin stramm antirepublikanische DNVP ab Mitte der 1920er Jahre tatsächlich auf dem Weg hin zu einer „stummen“ oder schrittweisen Parlamentarisierung befand. Diese Entwicklung fand mit den enormen Verlusten unter den Stammwählern bei den Reichstagswahlen vom Mai 1928 und einer in der Folge deutlichen Verlagerung nach rechts unter dem neuen Vorsitzenden Alfred Hugenberg zweifellos ihr Ende.17 Die anderen etablierten bürgerlichen Parteien unterstützten von nun an eine Große Koalition unter Führung der SPD, die ihren Stimmenanteil von 26 auf knapp 30 Prozent steigern und somit für sich beanspruchen konnte, die Wahlen nominell „gewonnen“ zu haben. Der SPD-Vorsitzende und Reichskanzler Hermann Müller mit seiner Fünfparteienkoalition aus Mitte-links- und Mitte-rechts-Parteien führte die letzte Regierung der Weimarer Republik, die auf verfassungsrechtlicher und parlamentarischer Grundlage stand. Müllers Nachfolger, der konservative Zentrumspolitiker Heinrich Brüning, der ab März 1930 unter Beteiligung der Mitte-rechts-Parteien eine Minderheitsregierung ohne die SPD leitete, benutzte präsidiale Notverordnungen, um seine Politik auch ohne Reichstagsmehrheit durchzusetzen.
Tab. 3.1 Koalitionsregierungen der Weimarer Republik von 1924 bis 1930
Quelle: Wahlen in der Weimarer Republik, http://www.gonschior.de/weimar/
Gab es bestimmte Muster, nach denen sich diese verschiedenen Koalitionsregierungen zusammensetzten, und wie stellten die Medien sie dar? Und in welchem Umfang spiegelte sich die Erfahrung der Koalitionsbildung auf Reichsebene auch in den Ländern wider? Um die erste Frage zu beantworten, muss zunächst zwischen objektiven Realitäten und subjektiven Wahrnehmungen unterschieden werden. Im Nachhinein treten hinter den häufigen Regierungswechseln erhebliche Kontinuitäten auf politischer und personeller Ebene zutage, ebenso wie ein wachsendes Selbstverständnis des Reichstags als eines „sozialen Raums“, in dem Absprachen getroffen und Gesetze gemacht wurden. So bekleidete zum Beispiel Gustav Stresemann den Posten als Außenminister vom 30. November 1923 bis zu seinem frühzeitigen Tod am 3. Oktober 1929 und wurde erst dann durch seinen DVP-Kollegen Julius Curtius ersetzt. Die lange Amtszeit machte ihn zur Verkörperung der Weimarer Außenpolitik der späteren 1920er Jahre. Trotz des Widerstands gegen seinen prowestlichen Ansatz vonseiten der DNVP und der Parteien rechts von ihr (und der extremen Linken) war es ihm möglich, eine Reihe von Erfolgen für sich zu verbuchen: 1924 den Dawes-Plan, 1925 die Verträge von Locarno, 1926 Deutschlands Beitritt zum Völkerbund, 1929 den Young-Plan und zwischen 1927 und 1930 – fünf Jahre früher als geplant – den Rückzug der Alliierten aus dem militärisch besetzten Rheinland.18 Otto Geßler von der DDP war als Verteidigungsminister sogar noch länger im Amt (März 1920 bis Januar 1928), während der Zentrumspolitiker Heinrich Brauns volle acht Jahre, vom Juni 1920 bis Juni 1928, als Reichsarbeitsminister diente. Auch andere Politiker bekleideten mehr oder weniger ununterbrochen Ministerämter, wenn auch manche das Ressort wechselten, so beispielsweise Hans Luther (Dezember 1922 bis Oktober 1923 Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft; Oktober 1923 bis Januar 1925 Reichsfinanzminister; Januar 1925 bis Mai 1926 Reichskanzler); Julius Curtius (Januar 1926 bis Oktober 1929 Reichswirtschaftsminister; Oktober 1929 bis Oktober 1931 Reichsaußenminister); Karl Stingl (November 1922 bis August 1923 und Januar 1925 bis Dezember 1926 Reichspostminister) und Stingls Kollege von der BVP, Georg Schätzel (Januar 1927 bis Mai 1932 Reichspostminister).19
Im Reichstag entwickelte sich zunehmend eine parlamentarische, parteiübergreifende Kultur, die sich durch eine gemeinsame Semantik und ein gemeinsames Verständnis über eine möglichst effizient durchgeführte Gesetzgebung auszeichnete – mit ein oder zwei zugegebenermaßen bedeutenden Ausnahmen. Historiker weisen hier besonders auf den sogenannten Flaggenstreit vom Mai 1926 hin, bei dem ein vermeintlich trivialer Disput über die Frage, welche Flagge(n) in den deutschen Handelsmissionen und Konsulaten in Übersee gehisst werden sollte(n) – eine Sache von größter symbolischer Bedeutung für Republikaner und Antirepublikaner gleichermaßen –, zu einem Misstrauensvotum und dem Zusammenbruch des zweiten Kabinetts Luther führte.20 Für Franklin C. West und andere Historiker war der Flaggenstreit ein Beispiel unter vielen für das Hauptproblem des Weimarer Vielparteiensystems: „Keine Parteiführung konnte oder wollte Maßnahmen riskieren, welche die Einheit der Partei gefährdet hätten“.21 Kompromisse zwischen den Parteien seien nur dann möglich gewesen, wenn sie „die eigenen Prinzipien so wenig wie möglich unterliefen“.22 Diese Sichtweise bedarf allerdings der Revision oder zumindest einer Nuancierung. Vor allem sollte sie nicht darüber hinwegtäuschen, dass – wie Benjamin Ziemann es ausgedrückt hat – die „formalen Regeln und informalen Verfahren des parlamentarischen Lebens“ ihre eigenen kulturellen Auswirkungen hatten, indem sie „ein Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Abgeordneten beförderten, das in der Lage war, politische Konfliktlinien zu transzendieren“.23 Seit Januar 1925, wie schon zwischen Juni 1920 und Mai 1924, übte der Sozialdemokrat Paul Löbe das Amt des Reichstagspräsidenten aus. Dies erwies sich als entscheidend, nicht nur um die Exekutivgewalt rechenschaftspflichtig zu machen, sondern auch zur Einhaltung demokratischer, rechtsstaatlicher Verfahrensweisen, ganz besonders bei der Verhandlung und Verabschiedung der Stresemann'schen Außenpolitik. Vize-Reichstagspräsidenten von der DNVP, der DVP und dem Zentrum unterstützten Löbe in dieser Aufgabe. Auf diese Weise kam den Sozialdemokraten, selbst wenn sie nicht an der Regierung waren, eine entscheidende Rolle bei der Gesetzgebung auf Reichsebene zu. Ein reibungsloser Ablauf im Reichstag war so in ihrem ureigensten Interesse, ganz unabhängig von der Frage der Parteigeschlossenheit. Ähnliches galt für die DNVP, zumindest bis Mai/Juni 1928.24
Eine der wichtigsten sozialen Rechtsvorschriften während dieses Zeitraums war das Gesetz über die Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (AVAVG), das der Reichstag am 16. Juli 1927 verabschiedete und das am 1. Oktober 1927 in Kraft trat. Es schuf eine neue finanzielle Basis für Leistungen der Arbeitslosenversicherung bei kurzfristiger, unfreiwilliger Arbeitslosigkeit durch die Beteiligung von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und dem Reich unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Familienangehörigen. Die Zahlungen konnten für maximal 26 Wochen bewilligt werden.25 Eine Reihe neu eingerichteter Arbeitsämter sollte die Arbeitssuchenden unterstützen. Das Gesetz ist nachträglich oft kritisiert worden, da es nur für durchschnittlich 700 000 und höchstens 1,4 Millionen Arbeitslose konzipiert war und sich daher während der Wirtschaftskrise nach 1929 als nicht praktikabel erwies. Rechtsgerichtete Wirtschaftswissenschaftler instrumentalisierten das AVAVG spätestens seit 1928 als ein Beispiel für die „exzessive“ unternehmerfeindliche Weimarer Sozialpolitik.26 Gleichwohl stellte Rudolf Wissell, von 1928 bis 1930 sozialdemokratischer Reichsarbeitsminister der Großen Koalition, in einem vier Wochen nach seinem Ausscheiden veröffentlichten Artikel fest, dass das AVAVG trotz seiner Probleme „eine stets brennend empfundene Lücke im System der Sozialversicherung schloss“ und damit „eine alte Forderung der Arbeiterklasse erfüllt“.27 Darüber hinaus wurde es im Reichstag „mit einer erdrückenden Mehrheit von den Deutschnationalen zu den Sozialdemokraten“ angenommen: 355 der 493 stimmberechtigten Abgeordneten votierten für das Gesetz und nur 47 – die nationalsozialistische und die kommunistische Fraktion sowie eine Handvoll abtrünniger DNVPler – dagegen.28
Für Wissell, Anhänger eines deterministischen ökonomischen Modells, stand das Jahr 1927 „sozialpolitisch unter einem besonders günstigen Stern“, denn der „Arbeitsmarkt hatte sich, nachdem die Auswirkungen der sogenannten Reinigungskrise [des Jahres 1926] überwunden waren, sehr erfreulich gestaltet“, zumindest im Vergleich zum Winter 1928/29.29 Man könnte diese positive Entwicklung aber auch als ein Zeichen für die zunehmende Bedeutung von parlamentarischer Alltagskultur und parteiübergreifender Koalitionsbildung interpretieren. Beide fungierten als eigenständige Faktoren bei der Produktion von sozialpolitischen Optionen, der Schaffung von Räumen für politische Kompromisse und trugen das ihre zum erfolgreichen Aufbau eines demokratischen Staates bei. Mit anderen Worten, es waren keineswegs nur taktische Gewinne zugunsten von „verfestigten“ wirtschaftlichen Interessengruppen, die Stürmer und anderen zufolge in den Jahren 1924 bis 1928 die Entscheidungen von Regierungen und Oppositionsparteien dominierten.30
Neben der parlamentarischen Kultur haben viele Historiker auch die vermeintliche „Politik der Enthaltung“ der Sozialdemokraten als problematisch ins Feld geführt. Diese habe sich angeblich nach 1923 auf Reichsebene offenbart, vor allem in ihrer „negativen“ Haltung bei den Koalitionsverhandlungen von Oktober bis Dezember 1924, Dezember 1925 bis Januar 1926 und sogar noch im Mai/Juni 1928, als die sozialdemokratischen Erfolge bei den Reichstagswahlen eine Regierungsbeteiligung so gut wie unvermeidbar gemacht hatten.31 Die Große Koalition ist in diesem Sinne manchmal dafür kritisiert worden, dass die Sozialdemokraten auch dann noch hartnäckig an ihrer Rolle als Hauptoppositionspartei festhielten, als sie schon längst einige der wichtigsten Ministerposten innehatten, nämlich das Reichskanzleramt sowie das Finanz-, Innen- und Arbeitsministerium. So stimmten 1928 auf Druck der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion die SPD-Minister im Reichstag sogar gegen den Bau des Panzerkreuzers A, ein wehrpolitisches Projekt, das sie im Kabinett bereits befürwortet hatten.32 Reichsarbeitsminister Wissell fühlte sich beständig hin- und hergerissen zwischen seinen persönlichen Sympathien für die von den Gewerkschaften und dem linken Flügel der SPD vertretenen radikaleren sozialpolitischen Positionen und den konservativen, unternehmerfreundlichen Ansichten, die nicht nur die bürgerlichen Minister im Kabinett Müller, sondern auch sein eigener sozialdemokratischer Kollege Finanzminister Rudolf Hilferding vertraten.33
Die „spezifische Aushandlungsstruktur des Reichstages“ trug Thomas Mergel zufolge außerdem zur „Unübersichtlichkeit“ parlamentarischer Verfahrensweisen bei. Dies – und keineswegs ein Mangel an Konsens unter den Abgeordneten im politischen Tagesgeschäft – führte zu einer kulturellen Entfremdung zwischen dem Parlament und den politischen Bewegungen und Trends außerhalb des Reichstags. Im Gesetzgebungsprozess mussten parteiprogrammatische Versprechungen und öffentlichkeitswirksame Rhetorik oft einer langwierigen Gremienarbeit weichen, juristische und technische Fachkenntnisse hatten Vorrang vor parteipolitischer Medienberichterstattung und politischer Zwist wurde durch Detailgenauigkeit und forensische Analyse gelöst. Die AVAVG ist dafür ein Paradebeispiel. Bereits der ursprüngliche Gesetzesentwurf der Regierung enthielt 175 Paragrafen; bei der Verabschiedung der veränderten Fassung am 16. Juli 1927 waren daraus 275 geworden.34 Im Juli 1928, kurz nachdem Wissell das Amt des Reichsarbeitsministers angetreten hatte, einigten sich Kabinett und Parlament auf die Bedingungen, unter denen das neue Arbeitslosengeld beantragt werden konnte, einschließlich einer in bestimmten Fällen zu gewährenden Verlängerung der 26-Wochen-Frist – gegen den Widerstand von Unternehmerschaft, Rechtsparteien und auch der Gewerkschaften, denen die neuen Maßnahmen nicht weit genug gingen.35 Angesichts dieser zusätzlichen Schwierigkeiten wird verständlich, warum der künftige Reichskanzler Müller im Juni 1928 anstatt seines Parteikollegen Wissell den amtierenden Reichsarbeitsminister Brauns vom Zentrum, der katholischer Priester und christlicher Gewerkschafter war, im Amt behalten wollte. Als jedoch der rechte Zentrumsflügel die Absetzung Brauns und den Verzicht auf eine uneingeschränkte Teilnahme an der Koalition forderte, war Müller zum Handeln gezwungen.36
Dass der mühsame Prozess der Koalitionsbildung wenig zur Beliebtheit der Politiker in der deutschen Öffentlichkeit beitrug, zeigt sich unter anderem in der rückläufigen Wahlbeteiligung. Im Januar 1919 gingen noch 83,0 Prozent zu den Urnen, im Mai 1924 waren es nur noch 77,4 Prozent, im Dezember 1924 78,7 Prozent und im Mai 1928 75,6 Prozent.37 Dennoch sollte dies nicht missverstanden werden als ein Zeichen für die Abkehr der Bevölkerung vom Prinzip der indirekten oder der parlamentarischen Demokratie als der besten Form politischer Repräsentation auf Reichs- und Landesebene. Die nicht parteigebundene, aber oft konservative lokale, regionale und überregionale Presse vertrat eine insgesamt skeptische, wenn auch nicht gänzlich ablehnende Haltung dem Reichstag gegenüber, nicht zuletzt um ihre eigene Bedeutung als außerparlamentarische Kraft und vermeintlich wahre, direkte und authentische Stimme des Volkes gegenüber den angeblich eigennützigen Politikern in Berlin (oder, wie die Bayern oft klagten, im „roten“ Preußen) zu betonen. Zwar gab es nur eine Handvoll einflussreicher, wenn auch kaum repräsentativer linksliberaler reichsweit erscheinender Zeitungen, welche die Republik rückhaltlos unterstützten, so zum Beispiel das „Berliner Tageblatt“, die „Vossische Zeitung“, die überregionale katholische „Kölner Volkszeitung“ und der täglich erscheinende sozialdemokratische „Vorwärts“. Doch dies bedeutete im Umkehrschluss nicht, dass alle übrigen Blätter der neuen Verfassungsordnung ungebrochen feindselig gegenüberstanden, selbst wenn sie angesichts ihrer überwiegend „bürgerlichen Leserschaft“ oft die „nationalistische und antisozialistische“ Karte zogen.38 Der deutsch-jüdische Publizist Edgar Stern-Rubarth, Chefredakteur von „Wolffs Telegraphischem Büro“, der offiziellen Presseagentur des Reiches, einflussreicher Befürworter der Stresemann'schen Außenpolitik und der deutsch-französischen Verständigung, fasste 1927 das Dilemma der verschiedenen, aufeinander folgenden republikanischen Regierungen folgendermaßen zusammen: „Zur Zeit Metternichs bezahlte man sich diesen Journalisten, zur Zeit Bismarcks ernannte man ihn, heute gewinnt man ihn für sich“.39
Inwieweit spiegelten sich diese Erfahrungen von Koalitionsbildung und politischer Kommunikation auch auf kommunaler und Länderebene wider? Zwischen 1924 und 1930 erprobten die Koalitionsregierungen mehrerer Länder verschiedene Variationen des Bürgerblocks (unter anderem Thüringen, Bayern, Braunschweig, Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz, Württemberg). Demgegenüber regierten etwa in demselben Zeitraum in Preußen, Baden, Hamburg, Hessen, Sachsen, Anhalt und anderswo sozialdemokratisch geführte Große Koalitionen. Die KPD hatte nach den Reichsexekutionen 1923 in Sachsen und Thüringen in keiner Landesregierung mehr nennenswerten Einfluss, so wie sie auch reichsweit kaum eine Bedrohung darstellte. Selbst in dem früher stramm „roten“ Stadtstaat Hamburg, wo die parlamentarische Arithmetik zwischen 1927 und 1931 in der Bürgerschaft eine SPD-KPD Koalition oder eine von der KPD tolerierte SPD-Minderheitsregierung erlaubt hätte, gaben die Sozialdemokraten einer Regierungsbeteiligung der bürgerlichen DVP und DDP den Vorzug.40 Die radikale Rechte – die NSDAP und Gleichgesinnte vom ultranationalistischen und ultrakonservativen Flügel der DNVP – entwickelte erst nach den Landtagswahlen in Thüringen im Dezember 1929 und den Reichstagswahlen im September 1930 ihr Störpotenzial.41
Landes- wie Reichsregierungen hatten die Möglichkeiten und die Verpflichtung, Gesetze zu verabschieden, Journalisten für sich zu gewinnen und die Zuversicht der Bevölkerung zu stärken. Preußen, der größte deutsche Einzelstaat, entwickelte sich schon in den Jahren 1918 bis 1925 zu einem „Fels der Demokratie entgegen allen Erwartungen“. Dies geschah hauptsächlich durch eine Machtallianz zwischen den Weimarer Parteien SPD, DDP, Zentrum und letzthin auch der DVP.42 Ein weiterer Grund war, dass der sozialdemokratische Innenminister Carl Severing bei konservativeren republikanischen Parteien Anerkennung fand durch seine Bereitschaft, auch höhere administrative Posten nicht mit Parteigenossen zu besetzen und, zusammen mit Ebert, Geßler und Seeckt, nicht vor autoritären Maßnahmen zur Eindämmung der Gefahr durch die Kommunisten zurückschreckte.43 Severing setzte diese Rolle fort, als die Weimarer Koalition aus SPD, DDP und Zentrum nach einem äußerst kurzen Intermezzo einer bürgerlichen Minderheitsregierung im April 1925 in Preußen wieder an die Regierung kam. Für viele Beobachter verkörperte Severing das „neue“ Preußen: ein auf Erfahrung beruhender, pragmatischer, wenn auch noch immer quasi autoritärer Staat, der gleichzeitig diktatorische und liberale Herrschaftsformen ausprägte. Eine Aktennotiz des britischen Auswärtigen Amtes hielt im März 1927 fest:
Allgemein formuliert ist Preußen noch immer ein Beamtenstaat, verwaltet von preußischen Staatsbeamten in Zusammenarbeit mit kommunalen öffentlichen Bediensteten, die von ordnungsgemäß gewählten Volksvertretern ernannt und eingesetzt werden. Man kann mit Sicherheit sagen, dass die Mehrheit dieser Ernennungen heute in den Händen der Weimarer Parteien – Zentrum, Demokraten und Sozialdemokraten – liegt […] [obwohl] die meisten Berufsbeamte sind, ist nur ein schrittweiser Wandel möglich […] Oberregierungspräsidenten, Regierungspräsidenten und Landräte werden sämtlich vom Innenministerium ernannt. Was die interne Verwaltung in Preußen angeht, hat die [November-]Revolution so gut wie nichts verändert.44
Negativ für das Land Preußen fiel ins Gewicht, dass sein Ministerpräsident nun nicht mehr, wie fast während des gesamten Kaiserreichs, in Personalunion auch das Amt des Reichskanzlers bekleidete. Er war auch nicht mehr länger ex officio Mitglied des Reichskabinetts, was den Einfluss Preußens auf die Weimarer Reichspolitik in Fragen der äußeren Sicherheit, der Medien-, Gesundheits- und Bildungspolitik, Polizei, Notstandsgesetzgebung und allgemeiner Regierungsangelegenheiten deutlich schmälerte.45 Hoffnungen auf eine gegenläufige Entwicklung zerschlugen sich, so zum Beispiel als der SPD-Vorstand nach den Reichstagswahlen 1928 Hermann Müller anstatt des amtierenden preußischen Ministerpräsidenten Otto Braun für das Amt des Reichskanzlers vorschlug.46 Das zwischen 1924 und 1933 von einer klerikal-konservativen Koalition regierte Bayern unter Leitung des BVP-Vorsitzenden Heinrich Held hätte darüber hinaus mit großer Wahrscheinlichkeit ohnehin Einspruch gegen eine „Wiedervereinigung“ der Ämter des Reichskanzlers und des preußischen Ministerpräsidenten erhoben, vor allem unter einem zwar beliebten, aber letztlich zentralistischen, bürokratie- und rationalisierungsfreundlichen Sozialdemokraten wie Braun.47
Trotz wachsender Fachkompetenz in dem Bereich der Massenkommunikation standen die Landesregierungen bei der Vermittlung ihrer politischen Botschaft vor immensen Schwierigkeiten. Wie Matthias Lau gezeigt hat, stießen ihre Bemühungen, die regionale und die Provinzpresse durch ihre eigenen Pressebüros in eine bestimmte Richtung zu lenken, auf herbe Kritik. Man warf ihnen vor, es sei die Pflicht des Staates, seine Bürger objektiv und unparteiisch über verschiedene Politikoptionen zu informieren, anstatt Methoden anzuwenden, die einer ungerechtfertigten Politisierung des Staates gleichkämen oder die gar einen vorsätzlichen Versuch der „Liberalen“ darstellten, das Recht auf freie Meinungsäußerung einzuschränken.48 Auf diese Weise entstand in manchen Fällen eine falsche Gleichsetzung von republikanischen und extrem antirepublikanischen Formen politischer Kommunikation. Die konservative und klerikale Rechte in den Ländern behauptete in diesem Sinne, die „modernisierenden“, „säkularen“ Republikaner hätten sie zuerst angegriffen und „ihre“ politische Ordnung durch die Einführung „ausländischer“ oder westlicher parlamentarisch-demokratischer Methoden destabilisiert, ohne zuvor „das Volk“ zu konsultieren.49
In Bayern entwickelte der populistische BVP-Ministerpräsident Held seine eigene Version dieses Narrativs, indem er unverwandt den Kriegshelden Hindenburg unterstützte, Stresemanns Außenpolitik als „alliiertenfreundlich“ bekämpfte und regelmäßig süddeutsche Partikularinteressen gegen die Reichsregierung in Berlin ausspielte.50 Doch es gab auch gegenläufige Tendenzen und alternative Konstellationen. Im Hamburg der Jahre nach 1923 hatten die Koalitionsregierung aus SPD, DDP und DVP, Berufsbeamte und Vertreter der Lokalpresse gleichermaßen Interesse daran, die wirtschaftliche Bedeutung des Stadtstaates, seine Abhängigkeit vom Freihandel und von stabilen Beziehungen sowohl zum westlichen Ausland als auch zum benachbarten Preußen wie zum Rest Deutschlands zu betonen. Wegen der „kooperativen Atmosphäre“ zwischen Staat und Journalisten war in Hamburg kaum etwas von den asymmetrischen Kulturkriegen zu spüren, die anderswo zwischen aggressiven Antirepublikanern und zwar weniger aggressiven, aber gelegentlich ebenso polarisierten „Weimarer Parteien“ in der öffentlichen Arena tobten.51 Einige Vertreter der Hamburger DNVP machten darüber hinaus ihrem Unbehagen über die offen feindselige Haltung ihrer Partei gegenüber den Locarno-Verträgen von 1925 Luft. Zu Recht befürchteten sie, dass dies ihre Chancen unterminiere, Hamburger Mittelschichtswählern eine glaubwürdige Alternative zur DVP bieten zu können, die ihre Bereitschaft zur Regierungsbeteiligung bereits signalisiert hatte.52