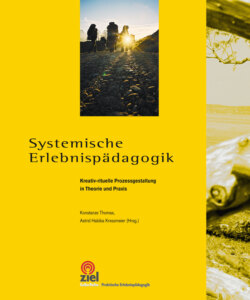Читать книгу Systemische Erlebnispädagogik - Группа авторов - Страница 9
ОглавлениеVon der Offenheit für das Geheimnis
Robert Hepp, Susanne Doebel
Robert: Wir hatten uns zu einem Trekking in der Wüste entschlossen. Am Morgen des zweiten Tages stellten wir der Gruppe die Aufgabe, die das Vertrauen zueinander und zur natürlichen Umgebung Wüste Sinai stärken sollte. Vor uns lag eine unbekannte und weglose Passage durch ein Wadi (Bergschlucht) hinauf auf eine Hochebene, zu einer kleinen Oase – circa drei Stunden Gehzeit. Die Gruppe hatte eine Stunde Vorbereitungszeit für die selbstverantwortliche Gestaltung dieses Abschnittes. Es sollte eine Leitungsperson installiert werden, ein vorbereitetes Kurzreferat zur dortigen Geologie platziert werden, Lunch und Trinkwasser organisiert sein, und sie sollten den Beduinenguide als Orientierungsressource einbeziehen. Der Titel dieser kleinen Reise hieß „Weg unseres Vertrauens“.
Alles verlief nach Plan: die Vorbereitungen, der Anstieg, der Vortrag, der Lunch, sogar das Erreichen des geografischen Ziels nach vier Stunden. Nur offensichtlich war das der Gruppe so nicht genug. Sie fühlten sich anscheinend unterfordert, vielleicht hielten sie den Auftrag für nicht erfüllt, war der Weg unseres Vertrauens noch nicht zu Ende oder stimmten die Vorstellungen und Bilder, die im Vorfeld entstanden waren, nicht mit dem Ergebnis überein.
„Wo stehen wir? Ich meine, was machen die da? Ich verstehe nicht, was hier passiert. Wo wollen sie hin? Ich habe den Eindruck, hier inszeniert sich etwas, was ich nicht kenne. Warum tun sie das?“, fragend schauten wir uns an, als wir, eine Zeit nach der Gruppe das Ziel erreichten und Folgendes beobachteten:
Sie gehen in einer Schlange hintereinander her, die Hände auf den Schultern des Vordermanns, alle bis auf den Ersten haben verbundene Augen und in einer eigentümlich wirkenden Rhythmik hört man Rufe wie „Stein links“, „großer Stein rechts“, „Steine rechts“ usw. Das alles geschieht mitten in der steinigen Hochgebirgswüste im Sinai. Sozialpädagogen, Jugendhelfer, Kommunikationstrainer, ein Matrose, deren Ziel es ist, als zukünftige Erlebnispädagogen mit anderen Menschen zu arbeiten. Wir werden der Reise dieses fast blinden und ängstlichen 22-Füsslers durch die Steinwüste mit unseren Blicken folgen. Man würde ihn noch weit hören können, Verlustängste kommen da nicht auf. Wie lange mag das wohl noch dauern? Die Sonne geht bald unter, das Abendessen wird gerade von den Beduinen vorbereitet und wir, das Leitungsteam dieser erlebnispädagogischen Zusatzausbildung, wollen eigentlich noch eine zusammenfassende Reflexion zu diesem Tag durchführen. „Vorsicht, großer Stein rechts!“ „Steine links“ …
„Mir reicht es jetzt! Ich finde das anstrengend und nervend!“
Das hört sich nach einer Erlösung für alle an.
„Ich denke, wir sollten das jetzt durchziehen, damit jeder mal vorne war.“
Vielleicht sollten wir doch intervenieren und dem Ganzen ein Ende bereiten, sonst passiert noch etwas. Es ist paradox, genau das wollen wir ja eigentlich, dass etwas passiert! Also lassen wir den Wurm weiterkriechen, auch wenn wir nicht verstehen.
Es dauerte noch eine Weile, bis sich die Rebellion durchsetzte und das „Tier“ zum Stehen kam. Der unbekannte Abschnitt bis zu dieser Oase lief für die Gruppe reibungslos, die vertraute und ohne unseren Auftrag angehängte Übung führte zu Chaos und Streit. Die selbst auferlegte Reflexionsrunde fand im direkten Anschluss statt und war eine Tortur für die Gruppe, aber sie konnten lange kein Ende finden.
„Ich fand diese Vertrauensübung total nervenaufreibend…“ „Jeder sollte vorne einmal in der Leitung sein und das auf seine Art und Weise machen. Dazu muss auch jeder mitmachen, auch wenn es lange dauert…“ „Wer kam überhaupt auf diese Idee?“
Sie waren in eine nicht endend wollende Auseinandersetzung geraten. Wir, die Leitung, saßen bewusst in Hörweite, denn sie sollten wissen, dass wir zuhörten und auf das Ende ihres Projektes warteten. Wir hatten unseren ursprünglichen Plan, eine Reflexionsrunde zu starten, endgültig aufgegeben. Wir warteten. Unwissend, aber mit wohlwollender Neugier, was uns dieser Prozess noch bringen würde, saßen wir im kühler werdenden Abendwind unter einem der seltenen Bäume. Wir hatten Fragen auf den Lippen, aber wir durften nicht fragen, noch nicht. Auf die selbst installierte Leitung konnten wir nicht mehr hoffen, sie hatte sich längst verabschiedet. Es war lange kein Ende abzusehen, aber glücklicherweise riss unser Geduldsfaden nicht. Irgendwann wurde das Schielen zu uns auffälliger, selbstironische Bemerkungen häuften sich und schließlich einigten sie sich darauf, dass der Auftrag erfüllt und damit die Aktion zu Ende sei. Wir waren als kompetente Leitung gewünscht und gefordert, jetzt unseren Beitrag zur Aufklärung ihres Mysteriums „Weg unseres Vertrauens“ zu leisten.
Gerne, aber wie? Was hätten wir sagen können, ohne alles kaputt zu machen, was sie sich hart erarbeitet hatten. Das Ziel für diesen Tag war erreicht. Die Teilnehmer hatten sich in dieser selbst gewählten Übung aneinander gerieben, auch unfreundliche Seiten an sich und den anderen erlebt, was zu tieferem Kennen und damit zu mehr Vertrauen in die Gruppe geführt hatte. Die Wüste ist groß und geduldig, wir waren gemeinsam angekommen. Wenn auch auf anderen Wegen, als wir es in der Leitung „geplant“ hatten.
Susanne: Dieses Beispiel gefällt mir gut. Es verdeutlicht, unter anderem, dass es viel Vertrauen braucht, wenn man in prozessorientierter Haltung leiten will. Es ist fast so, als wäre dieser Prozess ein Wesen, das seinen eigenen Gesetzen folgt. Man bietet ihm einen Rahmen und eine Richtung, und dann macht es, was es will. Man muss aushalten und geschehen lassen können, was man durch den Auftrag oder das momentane Ziel gerufen hat. Letztlich ist der Weg das Ziel. Falls man konkrete Bilder im Sinn hat, wie der Prozess genau vonstattengehen sollte, damit er als erfolgreich gelten kann, gerät man leicht ins Schwitzen, wenn es dann ganz anders läuft. Mir kommt dazu gerade die Metapher des Flusses in den Sinn: Will ich mich auf einem Fluss bewegen, den ich noch nicht kenne, schaue ich vorher auf der Karte, wohin er fließt und wo ich aussteigen will. Später ist es dann aber der Fluss, der meine Bewegung bestimmt und seine Stromschnellen, Hindernisse, Biegungen, Landschaften fordern mich zu Reaktionen und immer neuen Perspektiven heraus, sie verlangen meine Gegenwärtigkeit. Ich kann mich auch am Ufer festhalten, aber auf Dauer muss ich mich doch entscheiden, mich dem Wesen des Flusses hinzugeben oder lieber zurück ans Ufer zu gehen.
Ein weiterer Aspekt, der mir anhand deines Beispiels zur Prozessorientierung in den Sinn kommt, ist das Prinzip der Autopoiese. Dieser Begriff aus der Erkenntnistheorie wurde von der Systemtheorie adaptiert und beschreibt die selbstorganisatorischen Kräfte in Systemen. Ihr habt der Gruppe grundsätzlich einmal Vertrauen entgegengebracht und sie machen lassen. Dadurch, dass ihr nicht interveniert habt, konnten sie sich als Wüsten-Tausendfüßler so lange aushalten, bis sich so etwas durchgesetzt hat wie ein „Sinn für Sinnhaftigkeit“. Dennoch kann man diese Erfahrung ja nicht als sinnlos bezeichnen, denn sie hat – wie du ja auch schreibst – die Begegnung mit Schattenaspekten ermöglicht. Das war offenbar ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Ziel. Würde man sich in der Leitung nur auf drei oder vier Wege beschränken, die man in Bezug auf diese Aufgabe für richtig hält, dann könnte es sein, dass man ihren Sinn nicht erfasst. So gesehen öffnet Prozessorientierung immer wieder Räume für Unerwartetes und vor allem für Lernen – sowohl für die Leitung als auch für die Teilnehmer.
Robert: Für mich ist Prozessorientierung im Grunde ein Anteil der Haltung und setzt eine für Phänomene offene Wahrnehmung voraus. Das gelingt nur, wenn in mir ein neugieriges Fragezeichen angeschaltet ist, manchmal sogar vom Kontext unabhängig. So als ob die Vergangenheit und die Zukunft des „prozessierenden“ Systems undeutlich verschwimmen. In diesen Momenten der Gegenwart nehme ich Auffälligkeiten im besten Fall erst einmal wertneutral wahr, soweit das überhaupt möglich ist. Glücklicherweise gibt es einen Auftrag und damit auch mindestens ein Ziel, die dem System, inklusive der Leitung, Orientierung bieten. An diesem roten Faden spielt sich der differenzierte Umgang mit neuen Informationen ab. „Was nehme ich wahr?“ und dann „Was hat das mit dem Auftrag bzw. Ziel zu tun?“. „Welche Hypothese war entscheidend für die Methodenwahl?“ und „Was verändert es jetzt im System?“. „Welche Lösung liegt in der Luft?“ und „Interveniere ich aktiv oder passiv?“.
Im Krpg-Globo steht die Prozessorientierung ja im Feld der „weichen Wirklichkeiten“, zwischen Menschenbild und Haltung einerseits und Handlungs- und Lösungsorientierung andererseits. Die Interventionsformen sinnvoll anzuwenden, setzt die Fähigkeit voraus, sich am Prozess zu orientieren. Diese nährt sich unter anderem aus einer klaren Haltung und einer geschulten Wahrnehmung. Darin liegt für mich der Unterschied zwischen Methoden „kennen“ und „können“. Wie schnell ist der Wüstenstaub nur aufgewirbelt …
Susanne: Aus deinen Ausführungen ergeben sich für mich zwei weitere Ansatzpunkte zur Prozessorientierung. Du sprichst die Phänomene an, die für die Prozessgestaltung entscheidend sind. Gab es in der Geschichte, die du erzählt hast, solche Phänomene? Oder anders gefragt: Hat die Natur mit einer ihrer Interventionen auf das Geschehen reagiert? Vielleicht fällt dir ja auch noch ein Beispiel ein, in dem Phänomene den weiteren Prozessverlauf bestimmt haben.
Und dann sprichst du von aktiven und passiven Interventionen. Um zu verstehen, wie man passiv intervenieren kann, braucht es sicher systemisches Grundverständnis. Vielleicht kann man sich aber auch an deinem Beispiel orientieren. Die bloße Präsenz der beiden Leitungspersonen in der Nähe des Gruppengeschehens und auch das, was sie nicht aussprechen oder tun, wirkt sich auf den Prozess aus. Ist es das, was du damit meinst?
Robert: Als Zuschauer und Zuhörer danebenzusitzen, war in gewisser Weise eine Intervention. Wir hatten eine Absicht und waren bei der Sache. Also waren wir auch aktiv, aber eben nicht im gewohnten Sinne einer Intervention. Damit wird meistens ein direktes Eingreifen in den Prozess verbunden. Wir hingegen wirkten für die Außenwelt recht passiv – deshalb die von mir vorgenommene Unterscheidung zwischen aktiv und passiv, was auch einen Link zur systemischen Haltung herstellen soll. Die Leitung ist in diesem Verständnis immer Teil des Systems und beeinflusst allein schon durch ihre Zeugenschaft und Beobachtung.
Deine Frage nach einem prozessbestimmenden Phänomen löst in mir Ungläubigkeit und Verunsicherung aus. Es fällt mir nicht ein einziges Beispiel ein. Natürlich haben die Teilnehmer nach ihrem später folgenden Solo so einiges erzählt, was ich dem Feld der Phänomene zuschreiben würde: wenn Felsformationen zu Gestalten und Gesichtern werden oder merkwürdige Tierbegegnungen geschehen, die dann vom Protagonisten in seine Geschichte und sein Thema metaphorisch eingebaut werden, dann beeinflusst dies zumindest den persönlichen Prozess der Teilnehmer. Aber eine Situation, in der wir als Leitung uns von Phänomenen führen ließen?
Vielleicht rührt meine Beispiellosigkeit daher, dass der Begriff Phänomen so ein großes Wort ist und ich die kleinen Hinweise an unserem „Wegrand“ zwar als nützlich angenommen habe, aber nicht den Begriff Phänomen verwenden will, weil es im Allgemeinen zu spektakulär klingen könnte. Vielleicht kann man in diesem Kontext „Auffälligkeiten“ im weitesten Sinn auch dem Begriff Phänomen zuordnen, aber darüber gibt es ja einen anderen Beitrag in diesem Buch.
Tatsächlich erlebten wir eine partielle Sonnenfinsternis gleich zu Beginn unseres Wüstentrekkings. Wir wussten vorher davon, aber nicht, dass der Moment unseres Aufbruchs der gleiche wie jener der Finsternis sein würde. Dieses scheinbar „klassische“ Phänomen hatte aber mit unserem Prozess nichts zu tun. Auf dieser Ebene ist einfach nichts in Resonanz getreten und so haben wir auch nicht versucht, irgendetwas hineinzuinterpretieren. Es war einfach ein beeindruckendes Naturschauspiel, welches die Teilnehmer allenfalls für eine phänomenologisch achtsame Wahrnehmung (im oben erwähnten Sinne) sensibilisierte.
Da fällt mir ein, dass du mir einmal vom Leben und den Überlebensstrategien der noch heute existierenden Naskapi-Indianer erzählt hast. Ich habe in Erinnerung, dass sich diese Menschen an ihren Träumen orientieren, um an ausreichend Lebensmittel zu gelangen. Wie dogmatisch übersetzen sie die geträumten Bilder in ihre Tagesrealität? Was glaubst du, würde ein Naskapi unter Prozessorientierung verstehen?
Susanne: Schön, dass du dieses Beispiel ansprichst. Ich habe tatsächlich gerade heute an die Naskapi gedacht, weil ich in einem Seminar über Traumdeutung von ihnen erzählen möchte. Es handelt sich um einen Indianerstamm im Nordosten Kanadas, der über viele Jahrhunderte unter sehr unwirtlichen Bedingungen auf der Labrador-Halbinsel überlebt hat. Ihre Überlebensstrategie war – und das könnte man vermutlich von vielen Naturvölkern behaupten – völlige Prozessorientierung.
Sie pflegten eine innige Beziehung zu ihrem Mista‘peo, was man mit „großer innerer Mensch“ übersetzen könnte. Er sprach durch Träume oder Ereignisse in der Natur und konnte durch die Trommel, durch Lieder oder Tanz gerufen werden. Mista‘peo war nicht irgendeine abstrakte Idee, sondern eine vitale innere Instanz, die für ihr Überleben von größter Bedeutung war. Im Winter waren die Lebensumstände der Naskapi besonders hart. Die Temperaturen waren extrem streng, die Landschaft unwegsam und die
Karibu-Herden nicht immer in der Nähe. Wenn sie nicht mehr weiterwussten, riefen sie Mista‘peo mit der Trommel oder baten um einen Traum. Tatsächlich gibt es viele eindrückliche Beispiele dafür, wie wirksam dieser Dialog mit dem großen inneren Menschen sein kann und wie konkret und unmittelbar sie die Hinweise befolgten, die ihnen durch Zeichen oder Bilder übermittelt wurden. Eines davon will ich hier erzählen:
Der Schwiegervater von Cimon, ein Jäger von Lake St. John, hatte einen mächtigen Mista‘peo. Einst hielt er sich zusammen mit seiner Familie am nördlichen Ufer des Aschuapmouchouan-Flusses auf, zu einem Zeitpunkt im Frühling, als eben das Eis zu brechen begann. Sie kamen zu spät und konnten den Fluss nicht mehr zu Fuß überqueren. Sie hatten auch kein Kanu. Nachdem sie ihr Lager aufgeschlagen hatten, gab er sich in der Nacht ganz dem Singen und Wünschen hin. Nach kurzer Zeit blieb das Eis an einer bestimmten Stelle des Ufers hängen und türmte sich zu einer Brücke von einem Ufer zum anderen auf, die sechs bis acht Fuß breit war. Sie war gerade breit genug, um ans andere Ufer zu gelangen. Ober- und unterhalb schäumte das angestaute Wasser. Nachdem sie am anderen Ufer angelangt waren, brach die Eisbrücke ein. (Speck)
Naturvölker, wie die Naskapi, sind der Natur und ihren Gesetzmäßigkeiten hautnah ausgesetzt. Ihr Überleben war und ist davon abhängig, dass sie in einen vitalen Dialog mit Bäumen, Tieren, Steinen, Himmelskörpern eintreten und in Harmonie mit ihnen leben. Sie haben komplexe Formen der Anrufung entwickelt, um mit den geistigen Kräften der Natur in Kontakt zu treten und günstige Bedingungen zu erbitten; und sie wissen, dass sie die Zeichen, die sie erkennen, ernst nehmen müssen.
In unserem Kulturkreis haben wir gelernt, uns von der Natur abzugrenzen und uns vor ihren Bedingungen zu schützen. Wir haben sie entmystifiziert, indem wir ihre Gesetze erklären und sie uns zunutze machen können. Auch ist der rein physische Erhalt unseres Lebens nicht tagtäglich gegenwärtig und so haben wir uns an die Freiheit gewöhnt, unser Leben nach unseren Ideen und Wünschen zu planen und uns Ziele zu setzen, die über den existenziellen Erhalt hinausgehen. Dazu dienen uns Erfahrungswerte, vor allem aber auch ein kausaler Zugang zum Leben, der besagt: „Wenn ich A mache, dann kommt B dabei heraus.“
Prozessorientierung hingegen erfordert, neben dem rationalen Denken auch ein feinstoffliches Bewusstsein und neben dem kausalen auch ein synchronistisches Weltbild zuzulassen. Und schon ist‘s vorbei mit so mancher Planerei – man begibt sich sozusagen bewusst und freiwillig auf unbekanntes Terrain. Wenn ich so arbeiten will, muss ich akzeptieren können, dass unser Sein mehr ist als eine logische Kette von Ereignissen und dass es Brücken gibt zwischen der materiellen und der geistigen Welt, die uns Phänomene bescheren und Hinweise geben, die wir nicht planen oder vorausahnen können, die aber für den Prozess, in dem wir uns bewegen, von großer Bedeutung sind. Prozessorientierung heißt auch, sich innerhalb eines festgelegten Zeitraums im Kontext unseres linearen Zeiterlebens auf Momente einzulassen, die neben der Zeit zu liegen scheinen. Momente, die mit der Uhr als kurz zu messen sind, dehnen sich beispielsweise aus und füllen sich mit Informationen. Ebenso kann es passieren, dass plötzlich Dinge in der Umgebung, die wir sonst allenfalls wahrnehmen, auf einmal zu bedeutungsvollen Symbolträgern werden. Das ist immer auch eine Art Spurensuche auf dem Weg entlang der größten Energie innerhalb einer durch den Auftrag definierten Passage. Vor diesem Hintergrund, und nachdem mir wieder in den Sinn gekommen ist, dass das Wort Methode von dem griechischen methodos abstammt, was übersetzt nachgehen heißt, wird mir noch klarer, warum die Prozessorientierung im Feld des methodischen Könnens angesiedelt ist.
Robert: Die Erzählung über das Geschehen am Fluss ist wirklich spannend.
Mit einem Ziel unterwegs zu sein, an einer Stelle nicht mehr weiterzukönnen und auch keine Lösung in Aussicht zu haben, kommt mir natürlich sehr bekannt vor. In solchen Momenten sich nicht panisch und aktionistisch zu verhalten, sondern zuerst etwas aufzugeben, eine Idee, ein mitgebrachtes Lösungsbild oder den Anspruch an sich selbst, es sogleich wissen zu müssen, ist manchmal eine Herausforderung. Diesen damit einhergehenden Gefühlszustand aushalten und dabei weiter in die Sache vertrauen ist jedoch eine wichtige Voraussetzung, um für hilfreiche Impulse oder gegebenenfalls Phänomene offen zu sein. Ist das die kompetente Inkompetenz? Zumindest ist es eine Kernkompetenz für prozessorientiertes Führen und Leiten von Menschen. Manchmal hilft eben nur das Warten auf den richtigen Zeitpunkt, auf diesen Moment, wenn sich etwas verdichtet und, wie in deinem Beispiel von den Naskapi, einem sogar Brücken gebaut werden.
Susanne: Ich denke spontan an Wu wei aus dem Taoismus. Das ist der Weg, der zum Tao führt, und er wird definiert als Handeln durch Nichthandeln bzw. als Enthaltung eines gegen die Natur gerichteten Handelns. In dieser fernöstlichen Lehre des Weges ist das Tao das ursprüngliche Wirkungsprinzip, das die Wandlung und Ordnung der Dinge bewirkt. Wu wei soll allerdings nicht zu Faulheit verleiten, sondern eher zu einem absichtslosen Handeln einladen, in dem sich Raum für spontane Eingebungen öffnet.
Dazu passt abschließend noch ein Zitat von Heidegger: „Die Gelassenheit zu den Dingen und die Offenheit für das Geheimnis gehören zusammen. Sie gewähren uns die Möglichkeit, uns auf eine ganz andere Weise in der Welt aufzuhalten.“
Literatur
Heidegger, M. (1959): Gelassenheit. Pfullingen (Neske)
Speck, F. G. (1935): Naskapi. The Savage Hunters of the Labrador Peninsula. Oklahoma (University Press)
Susanne Doebel
Jahrgang 1966, lebt in Landsberg / Lech (Deutschland)
Aus- und Weiterbildungen: Fremdsprachenkorrespondentin Englisch, Französisch, Spanisch (IHK-Diplom), Systemische Gesprächsführung, Systemische Naturtherapie, Studium am Zentrum für Tiefenpsychologie (C. G. Jung), Schweiz
Derzeitig: Geschäftsführerin spektrum-Institut für systemische Prozessbegleitung; Systemisches Coaching, Beratung, Naturtherapie, Referentin
Robert Hepp
Jahrgang 1962, lebt in Landsberg / Lech (Deutschland)
Aus- und Weiterbildungen: Systemische Gesprächsführung, Naturtherapie, Krpg, Outdoor-Guide, Reiseverkehrskaufmann
Derzeit: Roadmovie-Begleiter, Outwardbound-Lehrtrainer, Projektleiter für Reise-Incentive und -Event, Gesellschafter spektrum-Institut für systemische Prozessbegleitung
Homepage: www.spektrum-institut.de
E-Mail: kontakt@spektrum-institut.de