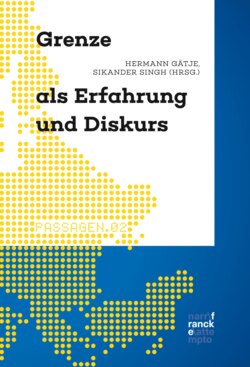Читать книгу Grenze als Erfahrung und Diskurs - Группа авторов - Страница 10
IV. Grenzüberschreitende Briefe
ОглавлениеWahr ist, dass der Flüchtende Geld braucht und sich nun in der Fremde neue Einkommensquellen schaffen muss. Dementsprechend steht die von Exilanten geführte Korrespondenz in nicht unerheblichem Maße im Zeichen der finanziellen Not und zeigt die Entstehung und Pflege eines regen, länderübergreifenden schriftlichen Verkehrs, in dessen Mittelpunkt immer wieder die Erkundung potentieller Arbeitsmöglichkeiten rückt. Das Grenzschicksal des Exils wird auch hier erwartungsgemäß zum Thema, wie Brechts Briefwechsel im Frühjahr 1939 mit dem schwedischen Schriftsteller und Übersetzer Henry Peter Matthis zeigt. Der seit 1933 im dänischen Exil lebende Brecht, den Matthis zu einer Vortragsreise durch Schweden eingeladen hat, weist auf das Faktum Grenze hin – dessen Aktualität aufgrund drohender Kriegsgefahr ständig wächst – und erhofft sich von Matthis die benötigte Hilfe bei der behördlichen Abhandlung seiner Überquerung der dänisch-schwedischen Staatsgrenze. Datiert 4. März 1939 schreibt er aus Svendborg, unter seinem „dänischen Dach“, an Matthis:
Wenn wir auch den Zeitpunkt für den Beginn der Vorträge im Augenblick noch nicht bestimmen wollen, so wäre es doch richtig, meiner Frau und mir die Möglichkeit, die Grenze zu übertreten, sogleich zu verschaffen, so daß dann nicht daran alles scheitern kann. Wie ich höre, benötigen wir dazu Grenzempfehlungen, am besten von im öffentlichen Leben stehenden Persönlichkeiten. Ich glaube, wir bekämen die Erlaubnis, wenn Sie dem schwedischen Konsulat in Kopenhagen mitteilen könnten, welche Leute mich in Schweden haben wollen.1
Mag ihm an der Vortragsreise viel gelegen sein, Brechts Hauptanliegen ist ohne Zweifel die gesicherte Fahrt nach Schweden, die Matthis mittels seiner „Grenzempfehlungen“ in die Wege leiten soll. Auch nach sechsjährigem Aufenthalt im benachbarten Dänemark und trotz seines Rufs in Schweden ist Brecht auf die Hilfe Wohlgesinnter angewiesen.
In seinem Brief bezieht er sich auf das Vorhaben prominenter Schweden, ein „Nationalkomitee Freies Deutschland“ zu gründen, das jedoch am Beharren der schwedischen Regierung auf ihrer politischen Neutralität im Zweiten Weltkrieg scheitern sollte. Brecht betont das grenzübersteigende Potenzial einer solchen Hilfsorganisation in einer Zeit, die von immer größer werdenden Einschränkungen der Bewegungs- und Gedankenfreiheit gekennzeichnet ist: „Darf ich Ihnen sagen, daß ich Ihre und Herrn Brantings Idee, dieses Komitee zu gründen, jetzt in dieser Zeit, wo jedem freien geistigen Austausch immer mehr ganz mittelalterliche Schranken gesetzt werden, außerordentlich finde?“2 Diesen unzeitgemäßen Einschränkungen, dem Aufwerfen von Grenzen müsse man entschlossen entgegentreten, so Brecht: die Grenze fordert den Menschen heraus und gebietet praktisches Handeln, damit sie überwindbar bleibt. Die Zeit wird kommen, schreibt Brecht in Gedanken über die Dauer des Exils, dann „Wird der Zaun der Gewalt zermorschen / Der an der Grenze aufgerichtet ist / Gegen die Gerechtigkeit“.3
Gegen die Tyrannei der Grenze, die den Ausgestoßenen von Land und Leuten abtrennt, stemmt sich das Briefeschreiben, das im Exil eine Hochkonjunktur erfährt. Brecht selber ist unermüdlicher Briefeschreiber, dessen Briefe in der Regel mit einer Bitte um schnelle Rückmeldung enden. Im Gedicht Zufluchtsstätte, das sein Haus am Skovsbostrand beschreibt, heißt es: „Die Post kommt zweimal hin / Wo die Briefe willkommen wären“.4 Auf über 2000 Seiten erschließen Hermann Haarmann und Christoph Hesse in Briefe an Bertolt Brecht im Exil, 1933–1949 die Korrespondenzflut, die in den Exiljahren auf Brecht zukam und insgesamt etwa 1600 Briefe betrug.5 Durch die häufig undurchsichtige Lage im Exil, die sich auf der Flucht ständig ändernden Postadressen, Störungen im internationalen Postverkehr und die daraus resultierende Drohung der Unzustellbarkeit von Briefen gewinnt das Briefeschreiben im Exil an Bedeutung. Briefe sind außerdem handfest, mitunter sogar intim, in der Handschrift des Senders und gedanklich auf den Empfänger hin verfasst. Somit wohnt Briefen nicht selten eine stellvertretende Kraft inne: Im Briefwechsel sind Schreiber und Empfänger präsent. Bei seiner Ankunft im finnischen Helsinki Anfang Mai 1940 erwarten Brecht zwei Briefe seines Freundes Hans Tombrock, wofür Brecht sich umgehend bedankt und gleichzeitig den hohen Stellenwert des freien Briefverkehrs betont, den er kausal zwingend als gefährdet sieht:
Lieber Tombrock,
besten Dank für die Briefe und Fotos. Deine Briefe waren die ersten und einzigen, die wir hier erhielten, und das gab ihnen etwas Festliches. Ich fürchte, etwas, was bei der ‚Neuordnung Europas‘ abgeschafft werden wird, ist die Post. Ohne ihre Abschaffung bleiben alle Versuche, die Kultur endgültig zu beseitigen, nur halbe Maßnahmen.6
Solange die Möglichkeit zur Korrespondenz besteht, bleiben auch die Grenzen der Barbarei porös, denn im schriftlichen Austausch tauscht sich die Kultur selbst aus. Die „ganz mittelalterlichen Schranken“ zeigen sich somit nicht zuletzt in der modernen Postüberwachung, die mit der europäischen Machtausdehnung des Dritten Reiches einhergeht: die Dichte seiner Außengrenzen manifestiert sich im Abreißen des Briefverkehrs bis hin zur vollständigen Briefstille.