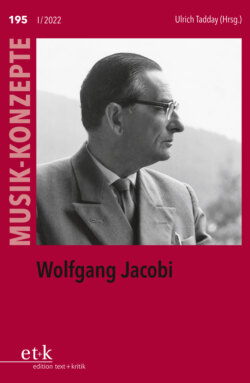Читать книгу MUSIK-KONZEPTE 195: Wolfgang Jacobi - Группа авторов - Страница 12
V Kontinuität auf verschiedenen Ebenen
ОглавлениеMit Sigurd Rascher blieb Jacobi in Verbindung. Dieser machte nach seiner Emigration in die USA nun jenseits des Atlantiks Karriere. Er fand einen großen Kreis von Anhängern und Schülern und sorgte dank seiner Aufführungen von Jacobi-Werken nun auch auf diesem Kontinent für einen gewissen Bekanntheitsgrad des Komponisten.56 Zwar war der Kontakt der beiden in den Kriegsjahren bis in die 1950er Jahre hinein eingeschlafen, doch wurden die freundschaftlichen Bande dann wieder neu geknüpft, und Jacobi schuf 1961 auf Wunsch des Saxophonisten ein virtuoses, Rascher gewidmetes Konzert, indem er sein Concertino für Akkordeon und Orchester, Serenade und Allegro (1958), bearbeitete und uminstrumentierte. Neben diesem Konzert für Altsaxophon und Orchester57 entstand außerdem noch für Rascher und seine Tochter Carina die Barcarole für zwei Altsaxophone und Klavier (1964).
So wie sich Jacobi Anfang der 1930er Jahre als einer der ersten deutschen Komponisten für die neue Ästhetik des Saxophons begeistert und diesem den Weg in den klassischen Konzertbetrieb mit geebnet hatte, machte er sich in den 1950er/60er Jahren für die Anerkennung des als »Schifferklavier« missachteten Akkordeons verdient. Auch im Akkordeon erkannte er das Potenzial eines vollwertigen Konzertinstruments und avancierte zu einem Pionier für das klassische Akkordeon. Zeigte er sich hier experimentierfreudig und offen für Neues, blieb er hinsichtlich seiner Kompositionstechnik und der Verwendung von Formen und Gattungen traditionsgebunden. Auffällig in seinem Frühwerk sind die vielen Suiten und Tänze, seine Anlehnungen an barocke Meister sowie seine Nähe zum Impressionismus. Jacobi legte großen Wert auf eine »einprägsame Melodik, fesselnde Rhythmik und farbige Harmonik«58 – wobei letztere noch tonal, jedoch sehr geweitet erscheint. Er sah sich selbst als Neoklassizist und erarbeitete sich in den Berliner Jahren, seiner produktivsten Schaffenszeit, einen eigenen kompositorischen Stil.
Diesem Stil blieb er treu, auch als in den Nachkriegsjahren die künstlerisch-avantgardistischen Strömungen in eine gänzlich andere Richtung gingen. Überhaupt hielt er an vielem, was in früher Zeit sein Wirken kennzeichnete, auch später fest. So war ihm die Vermittlung von Musik im Laienbereich – nun speziell bezogen auf die Akkordeonszene – weiterhin wichtig, das Komponieren nicht allein um seiner selbst willen, sondern unter Berücksichtigung einer »ethischen« Dimension.59 Auch sein sozial- und kulturpolitisches Interesse sowie sein ehrenamtliches Engagement, das mit dem Vorsitz des Vereins ehemaliger Hochschüler der Hochschule für Musik Berlin begonnen hatte, fand seine Fortsetzung in den Münchner Jahren. Für alles erntete Wolfgang Jacobi Anerkennung und Auszeichnungen. Dennoch verblieb er im Schatten namhafterer Komponistenkollegen, und nach seinem Tod drohte er immer mehr an Beachtung zu verlieren. Dabei hatte Sigurd Rascher in einem würdigenden Beileidsschreiben an Jacobis Ehefrau über seinen verehrten Freund noch betont: »Es wird schon nicht gehen, seinen Namen zu vergessen – zu wichtig sind seine Beitraege zu unserer Literatur!«60
1 Die Familie lebte zu diesem Zeitpunkt bereits in München. — 2 Die Auflistung bezieht sich auf Aufführungen der Jahre 1927 bis 1933. Im Werkverzeichnis selbst finden sich darüber hinaus Angaben zu Uraufführungen auch bei einigen früheren Werken. – Abgesehen von diesem ersten Werkverzeichnis (im Folgenden kurz WV1) sind im Jacobi-Nachlass noch zwei weitere handschriftliche Werkverzeichnisse erhalten, die in späterer Zeit entstanden und einmal Werke bis 1958 umfassen (= WV2), einmal bis 1972 (= WV3). — 3 Die umfangreiche Sammlung an Presseberichten und Rezensionen erklärt sich aus dem Umstand, dass Jacobi mit dem »Argus Nachrichten-Bureau« einen Zeitungsausschnittdienst beauftragt hatte. Eine Erschließung der zahlreichen Presse-Dokumente im Familienarchiv Wolfgang Jacobi (im Folgenden kurz FamWJ) steht noch aus. — 4 Wolfgang Jacobi, Biographische Notizen, Manuskript, 1972, S. 1–5, hier S. 2 (in englischer Übersetzung erschienen in: Music Accord [1972], H. 5–7, jeweils S. 10 f.). – Neben diesem maschinenschriftlichen Manuskript existiert noch ein handschriftlicher Lebenslauf von Jacobi, verfasst ca. 1940, in seinem Nachlass. — 5 Musikalische Vorkenntnisse hatte Jacobi in seinem Elternhaus erworben, in dem regelmäßig musiziert wurde. Er selbst spielte Klavier, vorzugsweise Bach und Mozart, aber auch schon frühe Werke von Debussy und Reger. Mit Fragen der Musiktheorie hatte er sich außerdem in der Gefangenschaft beschäftigt. – Vgl. Jacobi, Biographische Notizen (Anm. 4), S. 1. — 6 Vgl. Staatl. akad. Hochschule für Musik in Berlin zu Charlottenburg, Jahresbericht für den Zeitraum vom 1. Oktober 1920 bis zum 30. September 1921, S. 21 und 23. — 7 In Jacobis WV1 finden sich Kompositionen mit und ohne Opuszahl. Die Zählung beginnt mit seinen 6 Präludien und Fugen für Klavier op. 1a (1920/22) und endet mit dem Konzert für zwei Klaviere und Blasorchester op. 45 (1932). In der Folge verzichtete Jacobi auf die Vergabe von Opuszahlen. — 8 Vgl. WV1 sowie Konzertführer Berlin-Brandenburg 1920–2012, 3 (1922/23), H. 11, 20.11.–3.12.1922, S. 9 f. Online einsehbar in: Digitale Sammlungen des Staatlichen Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz, URL: https://digital.sim.spk-berlin.de/viewer/image/775084921-03/73/ [letzter Zugriff: 23.11.2021]. — 9 Die Werke wurden 2004 von Ries & Erler als Neuauflagen herausgebracht. – Anfang der 1930er Jahre hatte der Verlag auch Jacobis Schuloper Die Jobsiade veröffentlicht. — 10 Wolfgang Jacobi, Werkbeschreibung, Konzert für Cembalo und Orchester, Manuskript, 1969 (FamWJ). — 11 p. s. [Poldi Schmidt], »Filmmusik und Kammermusik. Der Vormarsch in Neuland«, in: Lichtbild-Bühne, 22.10.1928, und Fritz Brust, [Bericht], in: Allgemeine Musikzeitung, 2.11.1928. – »Man bemerkte« im Publikum auch Kurt Weill; vgl. Klaus Pringsheim, [Bericht], in: Der Abend (Spätausgabe des Vorwärts), 25.10.1928. — 12 Vgl. Eugen Schmitz, »Tonkünstlertagung in Dresden. Sinfoniekonzert der Philharmonie«, in: Dresdener Nachrichten, 7.10.1930. — 13 Jacobi widmete die 2. Fassung seines Konzerts der Cembalistin Li Stadelmann, die es mehrfach aufführte, so mit den Münchner Philharmonikern 1949 und dem Orchester des Bayerischen Rundfunks 1951. — 14 Ausführlich in Friedrich Spangemacher, »Wolfgang Jacobi und der frühe Berliner Rundfunk«, im vorliegenden Band, S. 25. — 15 Jacobi, Biographische Notizen (Anm. 4), S. 2. — 16 Brief von Wolfgang Jacobi an Ursula Stürzbecher, 30.9.1967 (FamWJ). — 17 Ebd. — 18 Vgl. dazu Stefanie Acquavella-Rauch, »›Rein sachlich finde ich, dass zu wenig brauchbare gute Akkordeonmusik existiert‹. Einblicke in Jacobis Zusammenarbeit mit dem Hohner-Verlag«, im vorliegenden Band, S. 87. — 19 Brief von Paul Pachaly an Wolfgang Jacobi, 4.4.1933 (FamWJ). — 20 Vgl. Lexikon der Juden in der Musik. Mit einem Titelverzeichnis jüdischer Werke. Zusammengestellt im Auftrag der Reichsleitung der NSDAP auf Grund behördlicher, parteiamtlich geprüfter Unterlagen, bearb. von Theo Stengel und Herbert Gerigk, Berlin 1941, Sp. 120. — 21 Vgl. Friedrich Geiger, »Die ›Goebbels-Liste‹ vom 1. September 1935. Eine Quelle zur Komponistenverfolgung im NS-Staat«, in: Archiv für Musikwissenschaft 59 (2002), H. 2, S. 104–112. — 22 Brief von Gertrud Weil an Wolfgang Jacobi, 2.11.1935 (FamWJ). — 23 Vgl. Staatl. akad. Hochschule für Musik in Berlin zu Charlottenburg, Jahresbericht für den Zeitraum vom 1. Oktober 1924 bis zum 30. September 1925, S. 23. Außerdem: Herbert Henck, Heinz Fischer (1903–1942). Ein jüdischer Pianist in Berlin, Internettext, 2012–19, Teil 2, URL: http://www.herbert-henck.de/Internettexte/Fischer_II/fischer_ii.html [letzter Zugriff: 23.11.2021]. — 24 Ebd., Teil 1, URL: http://www.herbert-henck.de/Internettexte/Fischer_I/fischer_i.html [letzter Zugriff: 23.11.2021]. — 25 Diese erfolgten nicht nur in der Berliner Funk-Stunde, sondern auch in anderen Sendern der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft wie im Sender Königsberg, Frankfurt/M., Breslau, Leipzig, Stuttgart und München. Zudem war Jacobi im Programm der Deutschen Welle (ab 1.1.1933 = Deutschlandsender) vertreten sowie in Sendern der ersten österreichischen Rundfunkgesellschaft, der Radio-Verkehrs-AG (z. B. in Radio Wien). — 26 Werbefaltblatt Wolfgang Jacobi, vermutlich 1929 (FamWJ). – S. auch Raika Simone Maier, »Lernen, Singen und Lehren«. Lula Mysz-Gmeiner (1876–1948), Mezzosopranistin und Gesangspädagogin, Neumünster 2017. — 27 Vgl. auch die Ankündigungen im Konzertführer Berlin-Brandenburg 1920–2012, 9 (1928/29), H. 15, 1.1.–13.1.1929, S. 5 und H. 18, 21.1.–3.2.1929, S. 3, URL: https://digital.sim.spk-berlin.de:443/viewer/image/775084921-09/141/ [letzter Zugriff: 23.11.2021]. — 28 Frenkel unterrichtete auch am Klindworth-Scharwenka-Konservatorium (Violinabteilung). Als Komponist wurde er, wie Jacobi, auf die »Goebbels-Liste« gesetzt (Anm. 21). Er emigrierte 1935 in die Schweiz, ein Jahr später in die USA; vgl. Agata Schindler, »Stefan Frenkel«, in: Lexikon verfolgter Musiker und Musikerinnen der NS-Zeit, hrsg. von Claudia Maurer Zenck und Peter Petersen, Hamburg 2006, Online-Publikation, URL: https://www.lexm.uni-hamburg.de/object/lexm_lexmperson_00001195 [letzter Zugriff: 23.11.2021]. — 29 Fritz Brust, [Bericht], in: Allgemeine Musikzeitung, 2.12.1927. — 30 Alfred Einstein, »›Neue Musik‹«, in: Berliner Tageblatt, 2.12.1927. — 31 Karl Westermeyer, »Berliner Konzerte. Neue Kammermusik«, in: Berliner Tageblatt, 31.1.1929. — 32 Ein Streifzug durch frühe Presse-Rezensionen findet sich in: Ekkehard Ochs, »Wolfgang Jacobi – Leben und Werk als Gegenstand von Musikwissenschaft und Musikpublizistik. Eine Bestandsaufnahme«, in: Wolfgang Jacobi – eine neue »Münchner Schule« aus Vorpommern?, hrsg. von Birger Petersen, München 2020 (= Musikwissenschaftliche Schriften der Hochschule für Musik und Theater München, Bd. 15), S. 179–189. — 33 Ebd., S. 182 f. — 34 Ebd., S. 183. — 35 Wolfgang Jacobi und Ursula Stürzbecher, Manuskript zu einem Werkstattgespräch, 1967, S. 1–6, hier S. 2 (FamWJ). – Viel mehr ist über die Verbindung Jacobi-Hindemith in der Berliner Zeit nicht bekannt. Jacobi ist aber in Hindemiths Adressbuch von 1927 bis 1938 verzeichnet, was für einen häufigeren Kontakt spricht. Zudem geht aus einem Brief von Gertrud Hindemith an den Schott-Verlag vom 7.3.1928 hervor, dass Jacobi als Vorsitzender des Vereins ehemaliger Hochschüler im März 1928 einen Hindemith-Abend plante, bei dem dieser selbst als Interpret mitwirkte. Ferner belegt ein Kalendereintrag Hindemiths eine private Zusammenkunft der beiden Komponisten am 1.8.1936. – Nach Informationen von Susanne Schaal-Gotthardt, Hindemith Institut Frankfurt, vom März 2017. — 36 Barbara Kienscherf, Art. »Rascher, Sigurd Manfred«, in: MGG Online, hrsg. von Laurenz Lütteken, Kassel – Stuttgart – New York 2016 ff., zuerst veröffentlicht 2005, online veröffentlicht 2016, URL: https://www.mgg-online.com/mgg/stable/27387 [letzter Zugriff: 27.8.2021] – Rascher wandelte später die Schreibweise seines Namens um in Raschèr, wohl um sich von seinem Bruder Sigmund Rascher, der im Dritten Reich als KZ-Arzt zu einem NS-Medizinverbrecher wurde, abzugrenzen. — 37 Vgl. Henning Schröder, »Das postmoderne Saxophon und sein Weg ins dritte Millennium«, in: Saxophone. Ein Instrument und sein Erfinder, hrsg. von Frank Lunte und Claudia Müller-Elschner, Berlin 2014, S. 126–127 und 133–143, hier S. 137. — 38 Für diese Auskunft danke ich Rascher-Experte Wildy Zumwalt, Fredonia State University of New York, Juli 2021. — 39 Veröffentlicht 1965 als Sonata for Eb Alto Saxophone and Piano im Verlag Bourne Co., New York. — 40 Vgl. WV1, WV2 und WV3 (Anm. 2). – Jacobi gab in späteren Jahren auch an anderer Stelle 1930 als Kompositionsjahr an, sodass in der Literatur und sonstigen Publikationen meist dieses Entstehungsdatum genannt wird, z. B. von Mehren in seiner Dissertation: Jörg Mehren, Wolfgang Jacobi. Studien zu Leben und Werk, Trossingen 1997, S. 122. — 41 So existiert von der Saxophonsonate auch eine Fassung für Elektronium und Klavier aus dem Jahr 1955. — 42 Das berühmte, heute noch konzertierende Raschèr Saxophone Quartet wurde erst 1969 gegründet. — 43 In der Sigurd M. Raschèr Collection an der State University of New York at Fredonia sind auch noch weitere, im Folgenden noch zu benennende Kompositionen Jacobis erhalten. — 44 Brief von Sigurd M. Rascher an Wolfgang Jacobi, 23.12.1937 (FamWJ). — 45 Brief von Rascher an Jacobi, 1.12.1938 (FamWJ). — 46 Vgl. Albrecht Dümling, »Symbol für Dekadenz oder Modernität? Auseinandersetzungen über das Saxophon im nationalsozialistischen Deutschland«, in: Saxophone. Ein Instrument und sein Erfinder, hrsg. von Frank Lunte und Claudia Müller-Elschner, Berlin 2014, S. 107–109, 112–113 und 116–125, hier S. 112. — 47 Brief von der STAGMA an Wolfgang Jacobi, 22.2.1938 (FamWJ). — 48 Wann der Ausschluss aus der Reichsmusikkammer genau erfolgte, konnte aus den Quellen im Jacobi-Nachlass nicht eruiert werden. Geiger weist darauf hin, dass Jacobi 1936 von der »Reichsfachschaft Komponisten« noch als »nichtarisches« Mitglied geführt wurde, nimmt aber an, dass der Ausschluss bis 1939 sicher vollzogen wurde. Vgl. Geiger, »Die ›Goebbels-Liste‹ vom 1. September 1935. Eine Quelle zur Komponistenverfolgung im NS-Staat« (Anm. 21), S. 108. — 49 Vgl. hierzu Gesa zur Nieden, »›Zwischen zwei Feinden‹. Wolfgang Jacobis Petrarca-Vertonungen der 1960er Jahre«, im vorliegenden Band, S. 68. — 50 S. Anm. 43. — 51 Cantata für Sopran, Altsaxophon und Klavier, erschienen bei Ries & Erler 2004/2012. — 52 Eine im Raschèr-Archiv in Fredonia vorliegende, Jacobi zugeschriebene Pastorale für Sopran, Saxophon und Klavier konnte jetzt als um den ersten Teil gekürzte und bearbeitete Fassung der Cantata identifiziert werden. Diese Kürzung stammte nicht von Jacobi. Er erhielt in den 1960er Jahren Anfragen aus den USA nach seiner Pastorale, die er dahingehend beantwortete, dass er kein Werk mit diesem Titel komponiert habe. Offenbar hatte Rascher selbst die Cantata-Bearbeitung vorgenommen, ohne Jacobi darüber in Kenntnis zu setzen. — 53 Briefe von Rascher an Jacobi, 30.11.1936 und 18.2.1937 (FamWJ). — 54 S. Matthias Michael Janze, Täter, Netzwerker, Forscher: Die Medizinverbrechen von Dr. med. Sigmund Rascher und sein personelles Umfeld, Dissertation, Tübingen 2020, online zugänglich, URL: https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/handle/10900/109676/ [letzter Zugriff: 29.12.2021]. – S. auch Anm. 36. — 55 Vgl. Andreas Ullrich, »Wolfgang Jacobi: Ein Komponistenleben in Deutschland«, in: Wolfgang Jacobi – eine neue »Münchner Schule« aus Vorpommern?, hrsg. von Birger Petersen, München 2020 (= Musikwissenschaftliche Schriften der Hochschule für Musik und Theater München, Bd. 15), S. 11–17, hier S. 13. — 56 Zur Bedeutung der sogenannten Raschèr-Schule vgl.: Schröder, »Das postmoderne Saxophon und sein Weg ins dritte Millennium« (Anm. 37), S. 137 ff. — 57 Das lange vergriffene Aufführungsmaterial des Konzerts wurde 2020 vom Verlag Hohner/Schott neu hergestellt und ist nun wieder verfügbar. — 58 Jacobi und Stürzbecher, Manuskript zu einem Werkstattgespräch (Anm. 35), S. 4 f. — 59 S. Anm. 16 und 17. — 60 Brief von Sigurd M. Raschèr an Eveline Jacobi, 11.1.1973 (FamWJ).