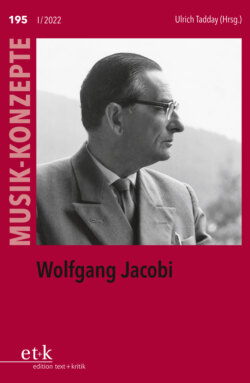Читать книгу MUSIK-KONZEPTE 195: Wolfgang Jacobi - Группа авторов - Страница 7
Spurensuche und Rekonstruktion
ОглавлениеZu den kompositorischen Anfängen Wolfgang Jacobis und seinen Werken für Saxophon
Es gibt nicht viele autobiografische oder werkbezogene Äußerungen Wolfgang Jacobis. Vor allem im Hinblick auf seine erste Schaffensperiode im Berlin der 1920er/30er Jahre sind die Überlieferungen rar gesät und diverse Fragen offen. Sehr vieles aus dieser Zeit ist verloren – auch die meisten seiner Kompositionen und damit fast die Hälfte seines gesamten Œuvres. Eine Brandbombe zerstörte während des Zweiten Weltkriegs das Haus der Familie Jacobi in Berlin, und sämtliche dort verwahrte Notenmanuskripte und Unterlagen wurden vernichtet.1 Jedoch gibt ein frühes handschriftliches Werkverzeichnis Jacobis, das erhalten blieb, Auskunft über die damals entstandenen Werke, zusammen mit einer Auflistung von deren Aufführungen im Anhang.2 Außerdem sind ein paar persönliche Dokumente, Briefe und Konzertprogramme sowie eine beachtliche Anzahl von Presseartikeln und -ausschnitten aus dieser Zeit in seinem Nachlass erhalten, die für diesen Beitrag teilweise erstmals gesichtet und ausgewertet wurden.3 Auch konnten weitere, bisher unbekannte Quellen ausfindig gemacht werden, sodass sich ein facettenreiches Bild zeichnen lässt vom Leben und Wirken des damals aufstrebenden, anerkannten Komponisten.
»Die zwanziger Jahre in Berlin sind mir unvergesslich. Berlin war damals das musikalische Zentrum Europas; Bartók und Stravinsky spielten ihre Werke, und Klemperer führte die Ballette Stravinskys und die Opern Hindemiths auf. Die berühmtesten Kammermusikvereinigungen, die grossen internationalen Solisten gaben regelmässig ihre Konzerte«,
schwärmte Wolfgang Jacobi rückblickend in einer seiner wenigen Aussagen über diese Zeit.4 Er war 1919 in die Kulturmetropole gekommen, um an der Staatlichen Hochschule für Musik Berlin Komposition zu studieren. Zuvor hatte er Kindheit und Schulzeit in seiner Geburtsstadt Bergen auf Rügen sowie in Stralsund verbracht und war nach dem Abitur als Soldat in den Ersten Weltkrieg gezogen. Während der Somme-Schlacht in französische Kriegsgefangenschaft geraten und schwer an Lungentuberkulose erkrankt, war er 1917 nach Davos ausgetauscht worden, wo sein Wunsch, sich beruflich einmal ganz der Musik zu widmen, konkrete Formen annahm. Ausschlaggebend dafür war die Bekanntschaft mit dem belgischen Musiker und Musikwissenschaftler Paul Collaer, der sich ebenfalls in Davos aufhielt und ihm die Welt des französischen musikalischen Impressionismus erschloss. Begeistert von der Farbigkeit, Rhythmik und plastischen Thematik der Werke, insbesondere von Debussy und Ravel, begann Jacobi mit den ersten eigenen Kompositionsversuchen.5
Sein Studium in Berlin nahm er bei Friedrich Ernst Koch auf und erhielt bis 1922 eine fundierte Ausbildung, die vielversprechend verlief. Jacobi bewarb sich um ein Stipendium der Georg Krakau-Stiftung, das ihm von der Akademie der Künste zu Berlin bewilligt wurde (Abb. 1). Er schrieb Werke verschiedener Gattungen, hauptsächlich Klavier- und Kammermusik, aber auch erste Orchesterwerke, die in Konzerten der Hochschule zur Aufführung kamen. So wurden bei Vortragsabenden mit Arbeiten der Kompositionsklassen im Juni 1921 Jacobis Vier Lieder für Sopran und Klavier, seine Drei Klavierstücke und ein Satz der Sinfonietta für kleines Orchester aufgeführt.6 Im Juli 1922 waren fünf seiner Sechs Gesänge für tiefe Stimme und Klavierquintett op. 87 zunächst bei einem Hochschulkonzert zu hören, wenig später, im November des Jahres, dann in einem Konzert des Verbandes der konzertierenden Künstler Deutschlands. Bei diesem ersten öffentlichen Kompositionsabend Wolfgang Jacobis im Prunksaal der Gesellschaft der Freunde standen außerdem Klavier- und weitere Kammermusiken von ihm auf dem Programm, darunter sein Streichquartett A-Dur op. 7 und als Uraufführung die Sonatine g-Moll für Violine und Klavier op. 11.8 Seine erste Symphonie für großes Orchester op. 2 (1921) war zum Abschluss seines Studiums in der Hochschule aufgeführt worden.
Abbildung 1: Bewilligungsschreiben für ein Stipendium der Georg Krakau-Stiftung vom 21. April 1921