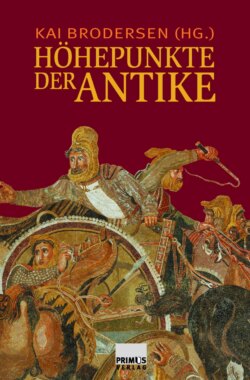Читать книгу Höhepunkte der Antike - Группа авторов - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die hoch gebaute Stadt: Troia und der Troianische Krieg
ОглавлениеJÖRG FÜNDLING
Troias Mauern sind unzerstörbar. Die Steine, die Helena trugen, als sie dem besorgten König Priamos die Helden Griechenlands zeigte, die Steine, um die Hektor siebenmal floh und dann zum Grauen der Stadt geschleift wurde – sie konnten nur in der Sage untergehen, in der allein sie begründet sind. Und immer höher ragen sie, denn die Jahre selbst scheinen an ihnen zu bauen.
Den Grundstein legten die Götter oder Homer, was beinahe aufs selbe hinausläuft. Homer nämlich schuf etwas Transzendentes, eine Stadt, die zwischen allen Welten lag. Das Troia der 24 Ilias-Gesänge ist noch nicht zerstört und doch schon unrettbar dem Untergang verfallen. So setzt es der Wille der Götter fest, auf der Grenze zwischen Erhabenheit und Grausamkeit. Es ist ein göttlich gebotener Frevel, diese Stadt vernichten zu wollen, die immer wieder „die heilige“ heißt. Ja, die Götter selbst sind festgehalten, indem sie hinter einen Horizont zurückweichen. Noch sind sie in besonderen Augenblicken sichtbar. Aber es besingt sie ein Dichter, dessen Zeit den letzten noch zu erwartenden Einbruch des Göttlichen schon ins Innere des Menschen verlegt – des Helden, des Dichters selber. Und um das Maß voll zu machen, sind die menschlichen Figuren von der Gefahr verfolgt, nicht allein den Zuhörern, sondern sogar sich selbst historisch zu werden.
Die Verwirrung über soviel Gegensätzliches ist nie stumm gewesen, doch während der ganzen griechischen Antike war die Ehrfurcht lauter: Homer selbst wurde der Nachwelt heilig. Hesiods systematische, bemüht fromme Theogonie entfaltete die Götterwelt in aller Ausführlichkeit; man zollte ihm Respekt, aber konzentrierte sich auf die rauf lustigen Olympier der um Systematik unbekümmerten Ilias. Troia, von dem die zerstrittenen, dezimierten Eroberer der Sage wie Fremde heimkehrten, wird aus der Rückschau zu dem Ort, der die Griechen zu einer Nation zusammenschmiedete.
Ein antikes Reiseziel
Als nun Rom sich die griechische Welt untertan zu machen begann, fanden sich Autoren, die – nicht ohne Bosheit – die dynamische Stadt am Tiber auf die besiegten Troer zurückführten. Die Römer, ohnehin von Minderwertigkeitsgefühlen geplagt, hätten zur Abhilfe einige Heroen aus Griechenland adoptieren können – nichts davon; ausgerechnet Troia als Ort einer wahrhaft epischen Niederlage wurde zum Fundament trotzigen Nationalstolzes. Zehn Jahre Belagerung hatten nur stattgefunden, damit Rom gegründet wurde, und Rom hatte den Troianischen Krieg in der Revanchepartie gewonnen. Den Osten und überhaupt die ganze Welt unterworfen hatte es übrigens am Ende auch; nicht schlecht für Verlierer.
All dies Weltbewegende, erbaut in den Sphären von Geist und (nicht ganz geistloser) Macht, suchte einen Anhaltspunkt in der physischen Welt. Er fand sich in Gestalt eines Städtchens im Nordwesten Kleinasiens, bekannt als Ilion und inmitten der „Troas“ genannten Ebene gelegen. Man hatte dort keine Zweifel, Troia zu sein. Der örtliche Athenatempel auf dem Burgberg, unter dem sich die Stadt ausdehnte, zeigte ein uraltes Standbild der Göttin, das man den Tagen des Priamos zuschrieb, und war von riesigen Mauerresten umgeben. Die Stadt war formal unabhängig, beugte sich der Herrschaft mächtiger Nachbarn beizeiten, lebte von Ackerbau und Viehzucht und hatte jahrelang wenig von ihrer berühmten Vergangenheit. Dann beging man den Fehler, sich gegen das Perserreich zu erheben, und bezahlte ihn teuer. 480 v. Chr. opferte König Xerxes auf seiner Strafexpedition nach Griechenland der Athena von Ilion tausend Rinder; der frisch bestrafte, teils wohl zerstörte Ort lieferte einen zusätzlichen Kriegsgrund, weil ihn „die Griechen“ eben auch einmal niedergebrannt hatten. Nun brannte Athen, Xerxes verlor trotzdem, das „gerächte“ Ilion aber blieb über hundert Jahre lang verarmt – und die meiste Zeit persisch; Autoren wie Herodot machten sich ihre Gedanken über Troias Rolle im scheinbar uralten Konflikt von „Griechen und Barbaren“, aber am Leben des verschlafenen Städtchens ging alles vorbei.
334 v. Chr. bewegte sich etwas. Ein Held besuchte die Reste der Heroenzeit. Auf dem Weg, Rache für die persische Rache zu nehmen, versprach Alexander, König der Makedonen und Feldherr Griechenlands, Ilion wunderbar zu verwandeln. Alexander zog großen Taten entgegen, und nie kehrte er wieder. Doch sein eigener Mythos trieb seine Erben, eigenen Glanz aus ihm zu gewinnen. 301 v. Chr. gewann Lysimachos, Herrscher von Thrakien, die Troas für sich, und nun wurden die Ankündigungen wahr.
Heilig war die Vergangenheit Troias, nicht deren Bausubstanz. Ein kapitaler Tempel entstand auf der Osthälfte des Berges, dessen Planierung jede denkbare Spur der Stelle, wo Priamos’ Palast gestanden haben mochte, hoffnungslos vertilgte. Ringsum brach man die Burgmauern, die die Sage für das Werk Apollons und Poseidons hielt, teilweise ab. Einige Stücke allerdings wurden sorgsam in Szene gesetzt: Ilion hatte viel Sinn für Geschichte. Die Stadt selbst wurde neu angelegt und konnte sich nun beinahe mittelgroß nennen; man war bereit für ein Goldenes Zeitalter.
Es kam in Gestalt zahlreicher Touristen, die sich vom Auf und Ab der hellenistischen Zeit nicht abhalten ließen. Ilion gehörte zum Seleukidenreich, dann zu Pergamon, war dazwischen einmal sozusagen unabhängig, aber für die Reiseführer machte das wenig Unterschied. Seit 133 v. Chr. hieß die Obrigkeit Rom, und das erwies sich als angenehm, begegneten die neuen Herren doch ihrer offziell anerkannten Urheimat mit Wohlwollen. Ein bitterer Rückschlag traf Ilion, als die Römer in der Troas gleichzeitig Krieg und Bürgerkrieg führten; die Stadt verweigerte dem Feldherrn Fimbria den Einlass, wurde 85 v. Chr. erobert und geplündert. Die Nachricht, dass es einstweilen die letzte größere Heimsuchung bleiben sollte, hätte die Einwohner kaum getröstet.
Gleichwohl erwies sich das Unglück als profitabel. Fimbria zählte zu den Bürgerkriegsverlierern; der Sieger Sulla beschenkte Ilion mit dem Status als freie Stadt, und durch das Tourismusgeschäft überlebte man sogar die ruinösen Kriegssteuern. Gekämpft wurde hier dank glücklicher Zufälle nicht mehr. 48 v. Chr. erhielt Ilion kurz Besuch von Caesar, der seiner Familiengeschichte nachging – die Iulii führten sich auf I(u)lus, den Sohn des Aeneas, der wiederum von Venus selbst abstammte, zurück, waren also blaublütige Troianer göttlicher Herkunft – und auf den Spuren Alexanders wandelte. Roms böse Zungen sagten dem Diktator nach, er habe nach Ilion umziehen wollen. Wenn das stimmt, hatte Caesar gute Gründe: Seewege und wichtige Straßen kreuzten sich hier an der Meerenge, die den reichsten Provinzen nahe lag. Noch als der endgültige Sieger der Machtkämpfe sich anschickte, Augustus zu werden und seine Herrschaft auf die Grundlage des Aeneasmythos zu stellen, hielt Vergil es für angezeigt, in der Aeneis deutlich hervorzuheben, Troias Rolle sei ausgespielt und eine Rückkehr zum Ursprungsort nicht gottgewollt.
Ilion bekam keine historische Mission, wohl aber sein Neubauprogramm. Augustus (der 20 v. Chr. selbst vorbeisah) ließ den Tempel restaurieren und die Stadt zweckmäßig verschönern. Eine lange, abermals schläfrige Zeit der Blüte lag vor den Hütern eines großen Andenkens, die sich, wenn sie Anliegen an die Kaiser hatten, freundlicher Behandlung sicher sein konnten. Die Ausnahme bildete Augustus’ scharfzüngiger Nachfolger Tiberius, dem die Stadtväter lässigerweise etwas spät zum Tod seines Sohnes kondolierten. Der Kaiser ergriff die Gelegenheit, den Gesandten seinerseits sein tiefes Beileid auszusprechen – das arme Troia habe ja, ebenfalls „kürzlich“, seinen geliebten Helden Hektor verloren.
Als eine neue Epoche anbrach, gelang es Ilion abermals, der Geschichte zu entkommen. Konstantin, nach langen Kämpfen unangefochtener Herrscher im römischen Reich, sah sich nach einer Residenz an der Nahtstelle Europas und Asiens um. Sein Blick fiel auf Ilion – doch auserwählt wurde Byzanz auf der anderen Seite der Meerenge. Das gut heidnische Ilion war wohl dankbar, keine christliche Metropole zu werden; man opferte noch eine Zeit lang den Göttern, doch weder Götter noch Troia hatten ihre alte Anziehungskraft. Sehr langsam schrumpfte die Stadt zum Städtchen, dann zum Dorf, in dessen letzten Wohnhäusern etwa im 13. Jahrhundert das Licht erlosch. Der Geschichte war Ilion – zu dem es in der Antike eigene Reiseführer gegeben hatte – so gründlich abhanden gekommen, dass zur Zeit der Auf klärung in zahllosen Traktaten und Reisebeschreibungen um den Ort gezankt wurde. Das allgemeine Interesse war gering: Homer begeisterte, doch die Topographie seiner Dichtungen blieb ein Thema unter Professoren, Lehrern und gebildeten Dilettanten. Sie glaubten auch nicht allzu viel davon.
Rückruf in die Geschichte
Dann geschah wieder einmal Paradoxes. Dasselbe Deutschland, das an der Wende zum 19. Jahrhundert eine kecke Philologie hervorbrachte, die das Genie Homer beinahe zum Phantom erklärte, es schickte ausgleichshalber auch einen Romantiker aus, dem es vorbehalten war, Troia zum „modernen Mythos“ zu machen.
Selten hat jemand so an einen Dichter geglaubt. Heinrich Schliemann war kein großzügiger Mensch, doch für Homer warf der hart rechnende Kaufmann seinen Reichtum – er hatte am Krimkrieg gut verdient – mit beiden Händen in den Kampf. Zum Ausgleich wollte er allerdings Schätze und Wunder sehen, nicht nur Keramik und Knochen. Und wie vielen Autodidakten vor- und nachher waren ihm die Feinheiten im Streit um die Quellen egal: Homer war die Wahrheit, wozu die Ausleger! Hatte er Ilion, dann hatte er das goldene Seil, an dessen anderem Ende der ganze Troianische Krieg hing, und er würde ihn heraufziehen, auch wenn alle Professoren der Welt sich dagegenstemmten. Wie sie es natürlich taten. „Du kannst dir nicht vorstellen, daß jemand, der Tüten geklebt und Rosinen verkauft hat, den alten Priamus ausbuddelt“, ließ Theodor Fontane in Frau Jenny Treibel (Berlin 1893, Kap. 6) einen ketzerischen Gymnasiallehrer spotten. Glück und Besessenheit Schliemanns waren stärker und triumphierten, vor allem aber sein Geschick im Inszenieren.
Die Ironie begleitete die Geschichte dieses Triumphes von Anfang an. Schliemann brachte viel Gläubigkeit und wenig aktuelle Literaturkenntnis mit. So begann er 1868 an einer Stelle zu graben, die schon als zu jung erwiesen war. Frank Calvert, der örtliche Konsul der Vereinigten Staaten (der den richtigen Fleck halb aufgekauft und sondiert hatte, aber dem nun das Geld fehlte), führte ihn auf den Hisarlık genannten Hügel, erlaubte ihm das Graben und sah sich fortan fast vergessen. Der „Entdecker“ Schliemann strengte sich nicht an, den Irrtum zu korrigieren.
Der Begeisterte war hergekommen, um zu finden, und fand allzu viel. Ein glückliches Verhängnis wollte, dass Schliemann eine Stadt freilegte, die ihre nächsten Pendants erst im Orient hatte; sie war am äußersten Rand des Klimas gebaut, das den Bau mit luftgetrockneten Lehmziegeln zuließ, und wie in einem Korallenriff legte sich Schicht über Schicht, Troia auf Troia, wenn diese billigen, nur einmal brauchbaren Mauern Ersatz verlangten. Gegen solchen Überfluss hatte Schliemann nur seinen Instinkt, die Wahrheit stecke in der Tiefe. Er musste ihr auf den Grund gehen; nichts konnte so kostbar sein wie die Stadt des Priamos. Und so grub er sich gegen alle Warnungen ins Entdeckte hinein, registrierte kurz, dass er sich wirklich an der Stelle des verschollenen Ilion befand, warf weg und riss nieder, alles in der Sicherheit, dass er schon wissen würde, wann er am Ziel sei und also einhalten müsste. Mitten durch den Burgberg schlug er einen vierzig Meter breiten Graben und fand erst in einem Abgrund von 17 Metern die unterste Schicht, sein Troia – aber nicht sein Letztes.
Fast widerwillig tauchte er im dritten Jahr, 1873, ein wenig höher, zur „Verbrannten Stadt“, die monströse Schuttschichten und große Mauern näher ans Bild eines heroischen Kampfes rückten als das bescheidene Dorf am Boden seines Grabens, das später Troia I heißen sollte. Dann fand er Gold, Gold in Mengen, und fühlte sich als Sieger. Und als Sieger zog er vorerst nach Mykene und Tiryns weiter, heimlich geniert, soviel zerstört zu haben. Als er wiederkam, musste er sich überzeugen, dass er nicht einmal alle Schichten angeschnitten hatte. Ja, der „Schatz des Priamos“ erwies sich nach Schliemanns eigener Entdeckung der mykenischen Kultur als Relikt einer Zeit, in der es noch gar keine Mykener gab – aber ohne König Agamemnon aus Mykene kein Troianischer Krieg. Neun große Schichten unterschied der genaue (und behutsamere) Wilhelm Dörpfeld, der sich jahrelang ordnend auf Schliemanns Spuren mühte, und erst Troia VI konnte in die gewünschte Epoche fallen.
Ohne es zu ahnen, hatte Schliemann die Zeit bis hinunter nach 3000 v. Chr. durchmessen, in die Frühe der Bronzezeit. Heilsame Ratlosigkeit war die erste Folge, als die Wissenschaft verstanden hatte, was da zu Tage getreten war. Wäre der Troianische Krieg solideste Historie, er brächte uns vom spätantiken Ilion, gegen 500 n. Chr., um gerade 1700 Jahre zurück – noch einmal soviel bleiben bis zum Anfang von Troia I. Vor dem Hügel von Hisarlık hat die Altertumswissenschaft den Respekt vor den endlosen Zeiten gelernt, von denen sie einst so gut wie nichts wusste. Die „historische Zeit“ lag zwei Meter hoch, während das Schrift- und Namenlose das Siebenfache füllte.
Das Leid der einen war der Glücksfall der anderen, der jungen Vor- und Frühgeschichte, die sich an Troia und seinem Nimbus eigenständig machte. Sie hatte sich gleich noch mit der mykenischen Kultur zu befassen, deren Spuren Schliemanns Schicksalsberg streiften. Auch sie gab anfangs keine Dokumente preis. Als man sie aber endlich hatte und noch später lesen konnte, sprachen sie von Königen an der Spitze ausgetüftelter Verwaltungen, den homerischen Helden herzlich unähnlich. Deren Namen wiederum trugen die schlichtesten mykenischen Zeitgenossen.
Was die kurzerhand „Troia“ getauften Siedlungen unter Ilion mit diesem Griechenland oder dem mythischen Krieg zu tun gehabt hatten, blieb Gegenstand der Spekulation. Nur die Geographie gab einige Hinweise, dass Homer diesen Winkel der Troas im Auge gehabt haben musste, als er einer alten Sage ungeahntes Leben schenkte.
Die Tiefen der Zeit
Die Landschaft war einladend. Am Ostufer einer tiefen Bucht zwischen Hügeln und Vorbergen, die sich nordwärts in den Eingang der Dardanellen öffnete – ehe Sand und Schutt sie auffüllten –, wählten die ersten Siedler eine Anhöhe, anfangs nicht weit vom Meer. Quellen sprangen aus dem Hügel, zwei nahe Flusstäler boten Acker- und Weideland, und in Sichtweite der Siedlung lagen hier die Bergwälder des Ida, dort die ersten von vielen Inseln der Ägäis.
So entstand bald nach 3000 v. Chr. Troia I, ein Bauern-, Hirten- und Fischerdorf. Einem Brand folgte um 2600 v. Chr. der großzügige Neuauf bau zu Troia II, in dessen Ziegelmauern eine Reihe von Lokalfürsten residiert haben muss, unter denen die Stadt zu erstem Wohlstand kam. Bis 2450 v. Chr. zählt man acht Bauphasen; auf der Burg entstanden mehrere große Häuser, vielleicht auch ein Kultzentrum, die erste bekannte Keramik, die in der Ägäis auf der Töpferscheibe geformt wurde, fand sich hier, und Bronzefunde deuten auf größere Vorräte dieses in Krieg und Frieden wichtigen Materials. Noch glänzender sind in heutigen Augen die rund zwanzig Goldschätze, voran der „Schatz des Priamos“ aus Troia IIg, Schliemanns „Verbrannter Stadt“. Ein weiterer Brand beendete die Existenz auch der letzten Bauphase, der 2450 v. Chr. ein prompter Wiederauf bau folgte.
Ob die vier Phasen, in denen bis 2200 v. Chr. die Existenz von Troia III verlief, einen Niedergang bedeuten, ist umstritten. Die kleineren Häuser zwischen engen Gassen sind teils als Indiz einer Bevölkerungszunahme, teils als Verarmung gedeutet worden. Mit Troia IV und V, die bis 1700 v. Chr. hinaufführen, sind diese Jahrhunderte Stief kinder der Forschung geblieben. Allzu lockend sind die Chancen, in der Folgezeit die Spuren großer Ereignisse zu suchen.
Denn glänzend und einer Heroenzeit würdig erscheint die Burg von Troia VI, deren sechs Meter hohe Mauern aus Steinquadern, ziegelbekrönt, einen halben Kilometer lang, die größte bekannte Festung im westlichen Kleinasien jener Zeit bildeten. Sie war keineswegs das Werk von Göttern. Stück für Stück baute und verstärkte man sie mehrere hundert Jahre lang, wie der Reichtum es zuließ. Turmbewehrt erhob sie sich mit den Häusern des Herrschers und der Vornehmen über einer Unterstadt in der Ebene, deren Spuren erst die seit 1988 laufende Ausgrabung aufgedeckt hat. Wie groß diese Siedlung war, ist kaum zu beurteilen. Der erforschte Bruchteil des Gesamtareals hat die Vorstellung widerlegt, dort hätten Häuser dicht an dicht gestanden. Vom Innern der Zitadelle wiederum haben die Planierarbeiten der Griechen und Römer die Mitte mit den interessantesten Gebäuden zerstört, und nur ein schmaler Ring innerhalb der Mauern lässt sich dort noch erforschen.
Die Reste des Bildes sind in Maßen imposant. Hier wurde ein Kleinfürstentum regiert, das die Troas oder doch ein beträchtliches Stück ihres Nordteils einschloss. Mit den Städten im Hethiterreich und in Mesopotamien hält Troia VI keinen Vergleich aus; allzu schlicht ist das Gebiet der Unterstadt. Ihr Bild ist ausgiebig glorifiziert worden, voran in der viel beachteten Troia-Ausstellung von 2001, und zog nicht minder ausschweifende Kritik auf sich. Verwirrend sind die in diesem „Zweiten Troianischen Krieg“ umkämpften Funde. So haben sich in der Ebene gleich zwei Gräben gefunden, in denen Optimisten eine Verteidigungslinie sehen wollten – warum die ebenso postulierte Stadtmauer erst volle achtzig Meter dahinter liegen konnte, blieb ein missliches Rätsel. Ein anderes Problem sind Quelle und Umfang des Reichtums. Man hat Troia VI zum unumstrittenen Handelszentrum der nördlichen Ägäis und Westkleinasiens erklärt. Nur die Handelsgüter fehlen weithin; dergleichen erhält sich im Boden schlecht, Keramik ausgenommen, die zum Großteil aber wohl in der Stadt selbst hergestellt wurde.
Umstritten bleibt, wie lange die Glanzzeit anhielt. Zwischen etwa 1300 und der Zeit nach 1200 v. Chr. sind mehrere Daten genannt worden. Ein Erdbeben, das viele Häuser und Teile der Burgmauern niederwarf, brachte Troia VI das Ende, begleitet von einigen Feuern; die Suche nach Resten eines Krieges mit mykenischen Griechen blieb hier erfolglos.
Mit Reparaturen begann Troia VIIa, das für etwa hundert Jahre in den – wenig kunstvoll – geflickten Burgmauern lebte. Der Wohlstand war wohl gesunken, jedenfalls aber die Qualität der Keramik. Ein verheerender Brand, vielleicht um 1200 oder 1150 v. Chr., zerstörte die Stadt gründlich – doch wieder fehlen eindeutige Kriegsspuren, und seit etwa 1200 v. Chr. war die mykenische Kultur selbst in einer Krise. Der Wiederauf bau folgte prompt, aber Troia VIIb1, am Ende der Bronzezeit, war eine ganz andere Stadt. Man beherrschte das Mauern schlechter als zuvor, man formte seine Keramik plötzlich wieder von Hand und in aus dem Balkanraum bekannter Form. Man hat an einwandernde Dardaner gedacht, einen illyrischen Stamm, für den schon die Ilias passende Personen- und Ortsnamen belegt, darunter Aeneas – so dass die Römer sich eigentlich zu Illyrern erklärt hätten. Nach zwei Feuern wurde eine neue Siedlungsphase, VIIb2, durch das Auftauchen der typisch südosteuropäischen „Buckelkeramik“ geprägt – auch sie wurde teils als Einwanderungsspur gedeutet. Burg und Stadt endeten – um 1070 bis 1020 v. Chr.? – in einem Brand, der vielleicht mit einem Erdbeben zusammenfiel. Danach herrscht vorerst Konfusion. Ob vor dem griechischen Ilion (Troia VIII) weitere Bauphasen folgten und bis wann, ist umstritten. Neuerdings wird eine kurzlebige Folgesiedlung zu Beginn der Eisenzeit postuliert, Troia VIIb3, die – von weiteren Phasen gefolgt? – spätestens 950 v. Chr. ausgelaufen sei. Ein Brand habe Berg und Ebene bis kurz vor 700 v. Chr. wüst gelassen. Aber eine Gegenthese lässt unmittelbar anschließend an VIIb2 die griechische Besiedlung Troias beginnen, durch Zuwanderer, die mit der Zeit die dezimierten Überlebenden an Zahl übertroffen hätten. Und so verhält es sich mit der Stadt, die Homer gegen 750 v. Chr. höchstwahrscheinlich sah, wie mit Schrödingers Katze: Wir müssen sie uns gleichzeitig lebendig und tot denken. Ob nur noch Steine übrig waren oder das Leben die Stadt nie verlassen hatte, ob Ilion erst nach Homer oder Homer schon nach Ilion kam – es steht nicht fest.
Sicher ist eins: die Griechen kamen eines Tages. Was genau Homer herführte, ist nur zu vermuten. Sicher kam er nicht zur ,Recherche‘ her. Sänger reisten nicht freiwillig oder aus Neugier von Ort zu Ort. Es gab wohl Kundschaft in der Troas, Fürstenfamilien, die sich auf den Adel der Heroenzeit zurückführten. Homer kam im Lauf seines Lebens zu freier Zeit und materieller Sicherheit, sonst hätten wir keine einzige Zeile aus seiner Hand – man schreibt eine Ilias nicht in kleinen Bröckchen nach jedem Auftritt. Anders als seine Vorgänger war er gesegnet mit Ansehen und enormem organisatorischem Talent. Und der größte Segen war, genau zur rechten Zeit zu leben, in der die Schrift in die griechische Welt zurückkehrte. Nur so konnte sich Homer an etwas nie Dagewesenes machen, ein Epos von 16 000 eng ineinander verschränkten Versen. Zweifellos war der Troia-Stoff vom Ei, aus dem Helena kroch, bis zur Heimkehr des geplagten Odysseus schon Hunderte Male vorgesungen worden, nicht zuletzt von Homer selbst. Doch jetzt wurde er in einen Ausschnitt des Krieges konzentriert, umgeformt zu etwas überschaubar Großem, aber alle Grenzen Sprengendem.
Niemand weiß, welche berühmten Sänger es vor und neben Homer gab, wer zur gleichen Zeit an welchen Themen den Sprung zum schriftlichen Epos versuchte. Sein Meisterstück hat alles ausgelöscht. Die Späteren waren gut beraten, sich Stoffe abseits der Ilias zu suchen. Es hat ihnen wenig geholfen: nur Fragmente haben überlebt. Einzig die Odyssee war ihrerseits so hinreißend, dass es unmöglich war, sie zu übergehen und Homer nicht als ihren Dichter zu sehen. Doch sie entstand zwanzig, dreißig Jahre nach der längeren Ilias, die sicher nicht das Jugendwerk eines Frühreifen war, und entfaltet im vertrauten Kleid der homerischen Kunstsprache eine ganz andere Welt. Mindestens geistig war ihr Schöpfer ein Verwandter des großen Vorgängers, vielleicht auch wirklich sein Schüler und Erbe; das Troia der Ilias war beinahe schon eine Legende für ihn.
Mythos Troia
War Troia aber eigentlich mehr? War „Troia“, das zehn Jahre belagert wurde, einmal eine tatsächliche Stadt und lag wirklich auf jenem Hügel, auf dem die guten Bürger von Ilion Besucher empfingen? Hatte Homer die Wahrheit besungen oder „nur“ seine Wahrheit?
Schliemanns ganzes Finderglück konnte die letztendliche Ratlosigkeit nicht vertreiben. Doch man hörte seitdem wenig von ihr. Um Schliemanns Troia entwickelte sich ein klug geschürter Medienrummel, in Deutschland und darüber hinaus. Reportagen und prachtvolle Bildbände verbreiteten die Sensation. Noch schwerer hatten es alle Zweifel gegen das Gold in den Vitrinen; Gold glänzt hell. Und dieses war zudem mit Nationalgefühl aufpoliert worden. Es war nicht ganz richtig mit dem Erwerb dieses Schatzes, er war mehr oder weniger aus dem Osmanischen Reich geschmuggelt worden (ein üppiges Bußgeld beschwichtigte den Sultan). Aber er war und glänzte in Berlin, war seit 1881 „dem deutschen Volke zu ewigem Besitze“ vermacht und bewies, dass man eine Kulturnation mit gleich viel Zukunft wie Vergangenheitssinn sei. Natürlich auch, dass man die besten Archäologen habe und „die anderen“, vor allem Frankreich, längst nicht so schöne Schätze.
Bis heute hat der „Schatz des Priamos“ etwas an sich, das den Nationalismus hervorlockt und moralische Feinheiten vergessen lässt. Wäre Schliemanns Geschenk noch komplett in Berlin, zankte man sich mit der Türkei darum wie um den Pergamonaltar. Doch die kostbarsten Troia-Funde wanderten im Zweiten Weltkrieg an den sichersten Platz, der in Berlin zu haben war, den titanischen Flakturm am Zoo (die beengten Berliner hätten die gesammelten Kunstschätze am liebsten hinausgeworfen), dann – nach dem Untergang einer weiteren Stadt – in aller Stille nach Leningrad. Aber nur Museumskustoden freuten sich heimlich an den Stücken, die man dem „Brudervolk“ der DDR nicht wiedergeben mochte. Seit 1993 bekennt sich St. Petersburg dazu, das Gold aus Troia zu besitzen, und es hängt unendlich viel Stolz und Verzweif lung daran. Die Kriegsbeute ist eins der schwindenden Zeichen, dass die gescheiterte Supermacht wenigstens diesen einen Krieg gewann, der sie schuf, ein Ausgleich für zuviel Vernichtetes, Kunstwerke und zahllose Menschenleben, Opfer des Angreifers … und des Siegers. Das ist viel verlangt von ein wenig Metall.
Mit oder ohne Schatz, der Mythos Troia ist geblieben. Der Ort selbst hat es an sich, seine Erforscher zu begeistern. In der furiosen Öffentlichkeitsarbeit der internationalen Ausgräber unter Tübinger Ägide seit 1988, die sich in dem und auf den jüngst verstorbenen Manfred Korfmann konzentrierte, lebt einiges vom Schliemann-Talent fort, Sensationen zu inszenieren oder zu schaffen. Auch vom berechtigten Stolz auf das physisch Greif bare, das man vor Wissenschaft und Publikum stellen kann.
Ist Troia nicht einer der Geburtsorte der modernen Altertumsforschung und in seiner Auffindung selbst ein Vorzeigekapitel im „Roman der Archäologie“? Doch es ist viel Sonderbares an der Forscherangelegentlichkeit auf der Suche nach dem „historischen Kern“, die jede Generation neu befällt und an weltbewegende Funde, den endgültigen Beweis „der Wahrheit“, glauben lässt.
Hethiter in Troia?
Die aufregendsten Erkenntnisse wiederholen in ihrer Weise das Lehrstück der „geschichtslosen“ Stadt, die Schliemann unter Ilion fand. „Die Antike“ ist keine rein griechisch-römische Veranstaltung. Für Troia, das zur mykenischen Zeit am Rande der griechischen Sphäre lag und selber eine eindeutig fremde Stadt war, gilt das doppelt – sei es das homerische Troia oder die ergrabene Stadt. Und so sind Theorien, wonach hethitische Texte die Frühgeschichte des Burgberges auf klären, und Hoffnungen, sie könnten zugleich einen wahren Kern Homers andeuten, schon Jahrzehnte alt. Sie erhielten frische Nahrung.
Aus der Zitadelle von Troia VII wurde 1995 ein Siegel geborgen, das mit luwischen Schriftzeichen bedeckt war, wie im vielsprachigen Hethiterreich für solche Zwecke üblich; es gehörte einem Schreiber, wie sie die diplomatische Korrespondenz der Hethiter und ihrer Vasallenfürsten führten – der Rest der Inschrift ist ein Rätsel. Der glückliche Ausgräber Korfmann erklärte es für bewiesen, dass man sich in Troia VIIb2 (er datierte die Fundschicht auf etwa 1130 v. Chr.) noch Jahrzehnte über das Ende des Hethiterreiches gegen 1200 v. Chr. mit dessen Kultur verbunden gefühlt habe. Denn dies was das Problem: Der Fund war zu spät, war von keiner Spur eines Archivs begleitet und ob er „immer“ in Troia gewesen, geschweige denn offziell gebraucht worden war, verraten die Umstände nicht.
Die Ausgräber und zahlreiche Hethitologen sahen jedoch die These bestärkt, dass man längst Nachrichten über Troia besitze – und zumindest Troia VI und VIIa eigentlich in Wilus(iy)a umbenennen müsse. Homer gibt Troia nämlich zwei Namen, Trōiē und Ilios, was im noch älteren Griechisch einmal Wilios hieß. Nun findet sich in der hethitischen Überlieferung ein „Land Wilusa“ oder „Wilusiya“, ein kleinerer Staat, der höchstwahrscheinlich nach seiner Hauptstadt hieß. Der Sprung zu (W)Ilios respektive Troia war nicht weit, auch weil ein Vertrag von etwa 1280 v. Chr. es in der Nähe der Insel Lesbos einordnet. Derjenige, dem König Muwatalli II. damals Bündnispflichten diktierte, ist ein Herrscher namens Alaksandu(s) – elektrisiert sah man auf den Frauenräuber der Troia-Sage, Paris, der in der Ilias meist „Alexandros“ heißt. So entwarf man das Bild eines luwischsprachigen, hethitisch geprägten und dominierten Handelsreiches, das (wie die Hethiter selbst) mit der Zeit von den expansiven Mykenern bedrängt wurde, die auf den Inseln vor der Küste Kleinasiens saßen und auf dem Festland Fuß zu fassen suchten.
Je näher wir das Bild fixieren, desto verschwommener wird es. Das Palastarchiv könnte, wenn vorhanden, über Nacht die Frage klären, ob Ilion auf den Trümmern von Wilusa steht. Aber die Hügelkuppe ist abgetragen, und in den verbliebenen Teilen von Troia VI und VII fehlen hethitische Spuren ebenso wie Schriftzeugnisse. Die Sprache von Wilusa ist, von dessen Lage zu schweigen, ein Rätsel. Luwisch ist für die Troas eine gute Möglichkeit, doch ebenso Lydisch oder ein regionalspezifisches Idiom, in Troia VII angesichts der möglichen Dardaner auch Illyrisch. Ganz offen ist die ethnische Zusammensetzung der Einwohner; unklar sind auch die Grenzen von Wilusa, ebenso das Ausmaß des hethitischen Einflusses. So versichert Muwatalli II. seinem (gehorsamen) Freund Alaksandu, Wilusa sei mindestens seit 1600 v. Chr. nie mit den Hethitern im Krieg gewesen. Leider behauptet aber Tuthalija I. (etwa 1420–1400 v. Chr.), auf den Muwatalli sich namentlich bezieht, er habe das „Land Wilusa“ und das „Land T(a)ruisa“ besiegt – schlechte Aussichten für das behauptete Einvernehmen.
Hat diese Geschichte mit der zu tun, die Homer erzählt? Die Namen, die außer Alaksandu aus der Herrscherliste von Wilusa bekannt sind, passen nicht zur Dynastie, wie sie die Troia-Sage überliefert. Nur auf den ersten Blick ist das „Land T(a)ruisa“ eine Hilfe – wir müssten in der weiteren Umgebung „unseres“ Troia eine zweite Stadt suchen, die bis mindestens 1400 v. Chr. bestand. Aber welche von beiden wäre „Ilios“, welche „Troia“? Und selbst wenn es einen historischen griechischen Angriff gab – wo hätten sie angegriffen und wann? Wäre schließlich ein von Stadt 1 auf Stadt 2 übertragener Vorfall noch genug „historischer Kern“? Die eifrigsten Sucher, die regelmäßig nicht einen beliebigen, bis zur Unkenntlichkeit verformten Konflikt, sondern im Wesentlichen den Troianischen Krieg selber wieder finden wollen, haben es schwer … und machen es sich leicht. Skepsis liegt als Ort zwar stromaufwärts von Ilion, nämlich am Skamander, aber geht wohl nicht so bereitwillig ins Flusswasser über, dass auch alle Troia-Forscher das wertvolle Spurenelement in sich aufnähmen.
Der Wunsch nach Wahrheit
Die Suche nach den Spuren realer Vorgänge in der Ilias wird weitergehen. Sie ist ein undankbarer Prozess, eine frustrierende Reihe notwendiger Subtraktionen – mit den Göttern angefangen. Wer Einzelheiten als echte Erinnerungen retten will, steht die meiste Zeit über in der Defensive. Er mutet Homers Vorgängern auch übermäßig viel zu. Sie waren auf Variationen geradezu angewiesen, um ihr Publikum unterhalten zu können, und ergänzten Figuren, die Komplimente an ihre jeweiligen Gönner waren. Homer selbst war nur der Letzte, der in großem Stil verwandelte. Dass vor ihm über fünf Jahrhunderte seit der mykenischen Zeit irgend etwas im Zusammenhang blieb, ist völlig unwahrscheinlich. Die Sänger gaben einen Mythos wieder, wie sie ihn im Licht der eigenen Zeit verstanden, nicht wie man ein heiliges Buch rezitiert; das Göttliche war im Geist des Sängers, nicht im Wortlaut, und dass der Gott aus ihm sprach, verbürgte die Wahrheit.
Fortsetzen wird sich auch, was als moderner Troia-Mythos bezeichnet wird. Die Schichten des unsichtbaren Troia wachsen schnell und verdienen eine eigene Archäologie; „Troia (Westtürkei)“, das Unterpfand des türkischen Anspruchs auf ein europäisches Erbe, ist in der Geschichte von Macht und Geist nur einstweilen die jüngste. Die Begeisterung wird neue Formen, kühlere Geister werden neue Zwecke für die Begeisterung finden.
Die kritische Moderne hat ihre rührenden Punkte. Besessen sucht sie nach Entsprechungen zu dem, was uns ein Dichter zeigt. Sollte so etwas Überwirkliches nicht doch zuletzt Wurzeln im Wirklichen haben? Der beste Vorsatz zur Quellenkritik versagt vor diesem Gefühl der Wahrheit, der Suche nach einem verborgenen Tor in eine größere, glänzendere Welt. So denkt sich der 13-jährige, eigentlich ungeheuer desillusionierte Fantasy-Leser auf einem verhassten Sonntagsspaziergang, wenn er nur ein wenig hinter den anderen um jene Wegbiegung ginge, könnte er wider alle Hoffnung die Elben sehen. Aber man lässt ihn nicht allein.
Um Troia ist noch mehr am Werk als Wunschträume. Im Gedicht nur scheinen unnennbares Leid – beinahe Homers erste Worte – und fruchtlose, von keiner Einsicht zu vertreibende Unversöhnlichkeit ihren Schrecken zu verlieren. Hinter der Ästhetik des Untergangs eröffnet sich eine Hoffnung – hier wird sich der Untergang nie vollenden, denn die Verse halten ihn für immer auf. Ein Bild, in dem das Schwert im Schwung erstarrt ist, scheint kein Bild des Tötens mehr, denn der Tod ist nur in der Zeit; der Leser selbst wird, indem er liest und wieder liest, zum Hüter des Waffenstillstandes. Friedlich belagern die Achaier auf ewig die Mauern, während der Krieg in beiden Lagern wütet, friedlich drängen die Troer ihnen entgegen und friedlich, verhalten traurig, dass sich die schlimmen Wunder, die wir sehen, nicht mit Händen greifen lassen, blicken wir hinter das Skaiische Tor.