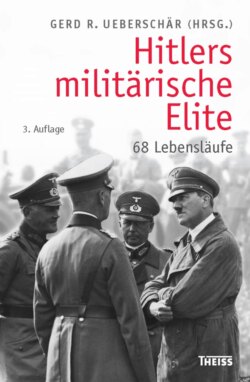Читать книгу Hitlers militärische Elite - Группа авторов - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
HORST MÜHLEISEN Generaloberst Werner Freiherr von Fritsch
ОглавлениеIn den Vormittagsstunden des 22. September 1939 fällt vor Praga, einer Vorstadt von Warschau, Generaloberst a.D. Freiherr von Fritsch, der ehemalige Oberbefehlshaber des Heeres. Immer noch, fast sechzig Jahre nach seinem Tode, wuchern die Legenden, die dieses Ende umgeben. War es Selbstmord? Suchte Fritsch in Polen den Tod, weil er die Schmach, die ihm im Frühjahr 1938 widerfahren war, nicht vergessen konnte?
Werner Freiherr von Fritsch wurde am 4. August 1880 im Schloß Benrath bei Düsseldorf geboren. Seine Eltern Georg von Fritsch, zuletzt preußischer Generalleutnant, und Adelheid, geborene von Bodelschwingh, erzogen ihren Sohn streng. Vaterlandsliebe und Pflichttreue, Zuverlässigkeit und Ehrenhaftigkeit gehörten ebenso zur Richtschnur für den künftigen Offizier wie eine strenge Dienstauffassung und gesellschaftliche Formen.
Im September 1898 trat Fritsch in das Großherzoglich Hessische Feldartillerie-Regiment 25 in Darmstadt ein und wurde am 27. Januar 1900 zum Leutnant ernannt. Zu seinen wenigen Freunden gehörte Georg von Küchler, sein Regimentskamerad und spätere Generalfeldmarschall.
Der junge Offizier bewährte sich außerordentlich. Das Heer bot indessen für einen Truppenoffizier kaum Aufstiegsmöglichkeiten. Fritsch war ehrgeizig und bestand die Aufnahmeprüfung für die Kriegsakademie, die er ab Herbst 1908 besuchte. Am 1. April 1910, nach Abschluß der Akademie, wurde Oberleutnant von Fritsch zum Großen Generalstab kommandiert und drei Jahre danach, im April 1913, in die Kriegsgeschichtliche Abteilung II versetzt, die die Kriege Friedrichs des Großen bearbeitete. Im März 1914 erfolgte seine Versetzung in die Aufmarsch-Abteilung des Generalstabes.
Im Weltkriege war er lange erster Generalstabsoffizier der 1. Garde-Division, die Prinz Eitel Friedrich von Preußen, der zweite Sohn des Kaisers, kommandierte und für die Fritsch „mit allen Fähigkeiten des Geistes und Herzens“ arbeitete, „der er wahrhaft diente in verstehender und belebender Fürsorge, mit der er aber auch jedes Schwere teilte“, wie Generaloberst von Brauchitsch am 26. September 1939 in seiner Trauerrede sagen wird.1
Im Dezember 1918 fand der polnische Aufstand in Posen statt. Die Oberste Heeresleitung begann, nachdem polnische Insurgenten ihre Überfälle verstärkt hatten, Freiwilligentruppen aufzustellen, um diese im Osten einzusetzen. Mitte Dezember bildete sie das Armeeoberkommando (AOK) Heimatschutz Ost, das im Januar 1919 in die Kommandos Nord und Süd aufgeteilt wurde. Das AOK Grenzschutz Nord befand sich in Bartenstein/Ostpreußen. Generalmajor von Seeckt war dort Chef des Generalstabes und Major von Fritsch erster Generalstabsoffizier. „Es war eine stürmische Zeit“, schrieb Fritsch rückblickend über diese Verwendung.2 Die Zusammenarbeit mit Seeckt prägte ihn entscheidend, und der spätere Chef der Heeresleitung (ab 1920) förderte Fritsch bis zu seinem Rücktritt im Herbst 1926. Damit erfüllte sich der Wunsch des Obersten Albrecht von Thaer, der im November 1918 notiert hatte, man müsse „Männer wie Bock, Beck und Fritsch auch für eine sehr kleine heruntergesetzte Armee sich reservieren. Alle 3 sind Männer 1. Klasse.“3
In den Jahren, die nach Fritschs Rückkehr aus Ostpreußen und dem Baltikum, wo er Chef des Generalstabes des VI. Reservekorps gewesen war, folgten, verlief seine Laufbahn in stetem Wechsel zwischen Stabs- und Truppendienst. Wie aber stand er zur Weimarer Republik? Mitte November 1924 schrieb Fritsch, Chef des Stabes der 1. Division in Königsberg, an Joachim von Stülpnagel, Oberstleutnant und Chef der Operationsabteilung im Truppenamt des Reichswehrministeriums, nach allgemeinen Betrachtungen zur politischen Lage: „Ich bitte mir es nicht übel zu nehmen, wenn ich vor zu großem Optimismus in Bezug auf Ebert u[nd] Marx warne. Ersteren halte ich für einen ganz einseitigen sozialdemokratischen Parteimann u[nd] großen Schweinehund (trotz Schleicher). Letzterer Marx ist vielleicht ehrlich, ist aber zu unbedeutend […].“ Er fuhr fort: „In letzterer Beziehung macht mich aber immer das Vertrauen auf einen Ebert stutzig. Denn letzten Endes sind Ebert, Pazifisten, Juden, Demokraten, Schwarzrotgold u[nd] Franzosen alles das Gleiche, nämlich die Leute, die die Vernichtung Deutschlands wollen.“4
Fritschs Ansichten sind bezeichnend für einen höheren Reichswehroffizier; es sind die eines Antidemokraten und Antisemiten, der die Republik verachtete, weil sie zu einem schwachen Staat führte. Nur die Armee war – wie in der Monarchie – der Garant der Stärke, nicht die parlamentarische Demokratie. Fritsch hatte sich sein Feindbild bewahrt, das im Kaiserreich verkündet worden war, und das mit dem nationalsozialistischen Gedankengut viele Gemeinsamkeiten besaß. Er vergaß indessen, daß es demokratische Kräfte waren, die sich 1919 zusammengeschlossen hatten, diese Republik zu bilden, mit Ebert, dem Präsidenten, der sich bereit erklärte, diesen Staat zu stabilisieren; auch vergaß Fritsch, daß Hindenburg und Groener am Ausgang des Jahres 1918 mit Scheidemann, Ebert und Noske zusammenarbeiten wollten, um das Reich zu retten.
Im Februar 1926 übernahm Fritsch die Heeresabteilung T1. Militärisch hochbegabt hatte er in allen Verwendungen vorzügliche Beurteilungen erhalten. Er besaß Autorität. Ein Jahr vor seinem Tode schrieb er: „Ich habe es mir zur Richtschnur gemacht, mich nur auf mein militärisches Gebiet zu beschränken und mich von jeder politischen Betätigung fern zu halten. Meine militärische Arbeit füllt mich mehr wie reichlich aus, und zur Politik fehlt mir alles.“5 Außenstehenden erschien Fritsch verschlossen und schroff, kühl und hochmütig, gehemmt und unpersönlich; er hatte nicht geheiratet. Er war indessen hilfsbereit und kameradschaftlich, gütig und liebenswürdig; er vereinte starke Gegensätze in sich, die seine Antriebskräfte waren, die aber auch seinen ambivalenten Charakter ausmachten. Er sei „eben ein stiller u. wortkarger Geselle, der selbst am Klatsch über seinen lieben Nächsten keine Freude hat, sondern dem der Klatsch in jeder Form aufs äußerste verhaßt ist“, teilte er Margot von Schutzbar-Milchling, seiner Vertrauten, mit.6 Derselben Empfängerin bekundete er: „Wenn Sie ferner schreiben, ich sei oft so schwer zu verstehen, so haben Sie damit zweifellos recht. Schon seit jeher habe ich niemals mit Jemand über mich selbst gesprochen. Das kann ich einfach nicht u. falls Jemand in dieser Beziehung in mich eindringen will, erreicht er nur das Gegenteil.“7
Dies ist das Psychogramm eines Offiziers, eines Nur-Soldaten, der selbst während des Urlaubs nur militärische Veröffentlichungen las und der am 1. Februar 1934 als Nachfolger von Generaloberst v. Hammerstein-Equord Chef der Heeresleitung wurde. „Schaffen Sie mir ein Heer in größtmöglicher Stärke u. innerer Geschlossenheit und Einheitlichkeit auf dem denkbar besten Ausbildungsstand“, sagte Hitler zu Fritsch bei der Amtsübernahme, und dieser fügte später stolz hinzu: „Nach diesem Auftrag habe ich seitdem gehandelt.“8 Die Generale von Blomberg, der Reichswehrminister, von Fritsch und von Reichenau, der Chef des Wehrmachtamtes, setzten auf Hitler. „Nationaler Umbruch“ lautete die Losung für die politische wie militärische Führung: Revision des Versailler Vertrages und Wiederaufrüstung.
Bei seinem Amtsantritt fand Fritsch bereits das zweite Rüstungsprogramm vor, das Anfang April 1933 angelaufen und bis Ende März 1938 geplant war. Dieses Programm umfaßte alle materiellen Rüstungsmaßnahmen des Heeres. Ende Februar 1934 fand eine Besprechung mit Hitler statt, an der u.a. Blomberg, Fritsch und Beck, der Chef des Truppenamtes, teilnahmen. Sie legten fest, das Verteidigungsheer innerhalb von fünf Jahren und die Angriffsarmee in acht Jahren aufzustellen. Bereits im Oktober 1933 hatte Hitler dem britischen Botschafter in Berlin, Sir Eric Phipps, angeboten, die deutsche Aufrüstung auf ein Friedensheer von dreihunderttausend Mann zu beschränken. Dieses Angebot war möglich geworden, weil die materielle Ausstattung des „A[ufstellungs]-Heeres“, für das eine Verdreifachung der sieben (Infanterie-)Divisionen vorgesehen war, rasch verwirklicht werden konnte. Nun war es möglich, das A-Heer (Kriegsheer) zum Friedensheer umzubilden.
Anfang Oktober 1934 umfaßte die Reichswehr noch nicht dreihunderttausend Mann. Doch Hitler kannte die Erwartungen und Stimmungen der Offiziere und verstand, sie zu motivieren. Er setzte auf ihren Ehrgeiz und Sinn für nationale Töne. Am 16. März 1935 führte er die allgemeine Wehrpflicht ein und befahl ein Friedensheer von zwölf Korpskommandos und sechsunddreißig Divisionen aufzustellen. Sorgenvoll beurteilten Fritsch und Beck die überstürzte Heeresvergrößerung, aber nicht aus politischen, sondern aus sachlichen Gründen. Auch nachdem Ende Mai desselben Jahres das Wehrgesetz erlassen und die Wehrhoheit wiederhergestellt worden war, protestierten die Westmächte England, Frankreich und Italien nur formell gegen den Bruch des Versailler Vertrages durch die Regierung Hitler.
Nun war das Heer, neben der Partei, zur zweiten Säule des nationalsozialistischen Staates geworden. Das Bündnis, das Hitler und Fritsch eingegangen waren, hatte sich bewährt. Und seit dem Mord an Röhm und an anderen SA-Führern war diese Organisation bedeutungslos geworden. Zu den Mordopfern zählten auch zwei ehemalige Generale, von Bredow und von Schleicher, der letzte Reichskanzler der Weimarer Republik. Indes hatte sich Fritsch während dieser Liquidierungen völlig passiv verhalten, obgleich Wehrkreisbefehlshaber und auch Vizekanzler von Papen ihn bedrängt hatten zu handeln. Fritsch, sich der Ungeheuerlichkeit der Morde bewußt, tat nichts und duldete diese Gewaltaktionen; so machte er sich mitschuldig.
Am 5. November 1937 fand jene durch das „Hoßbach-Protokoll“ bekannt gewordene Besprechung in Berlin statt, über die viel Falsches berichtet worden ist. Ausführlich erläuterte Hitler sein außenpolitisches Programm und kündete seine Kriegsabsichten an. Indes sagte er nichts Neues. Blomberg, Fritsch und Neurath widersprachen Hitlers Plänen nicht; sie waren ihnen schon bekannt. Ihre Einwände waren sachlich und gering. Fünf Tage danach, am 10. November, fuhr Fritsch nach Ägypten und kehrte Anfang Januar 1938 zurück.9 Nun aber bahnten sich wichtige personelle Umwälzungen an.
Am 12. Januar heiratete der Witwer Blomberg in zweiter Ehe Margarethe Gruhn. Nur Hitler und Göring, die beiden Trauzeugen, waren zuvor unterrichtet worden. Einige Tage nach der Eheschließung erfuhr die Kriminalpolizei, daß die Berliner Sittenpolizei Unterlagen über Blombergs Gattin besaß. Groß war das Entsetzen. Am 4. Februar trat der Reichskriegsminister zurück. Er selbst hatte seinen Sturz verursacht.
„Ich erlebe zur Zeit viel Schweres“, äußerte Fritsch Ende Januar 1938.10 Fünf Tage zuvor, am 26. Januar, hatte zwischen Hitler und Fritsch eine Unterredung stattgefunden, in der der Oberbefehlshaber des Heeres dem ‘Führer’ und Reichskanzler sein Ehrenwort gegeben hatte, nicht homosexuell zu sein. Auch war die Gegenüberstellung mit dem angeblichen Belastungszeugen, dem Erpresser Otto Schmidt, erfolgt. Fritsch war über die Vorwürfe fassungslos. Er hatte alles getan, um seinen Auftrag zu erfüllen: „Ganz unabhängig davon ist, daß die Grundlage unseres heutigen Heeres nationalsozialistisch ist und sein muß […]“, notierte er.11 Nie war er wankend geworden. Und fast ein Jahr nach seinem Sturz bekannte er: „Ich habe mir eingebildet, ein guter Nationalsozialist gewesen und noch zu sein.“12 Er blieb es bis zu seinem Tode.
Dennoch mußte Fritsch am selben Tage wie Blomberg aus seinem Amt ausscheiden. Was folgte, war sein Kampf, seine Ehre wiederzuerlangen, waren die Untersuchungen der Geheimen Staatspolizei, die für Fritsch sehr entwürdigend waren, und die des Reichskriegsgerichts. Dann stellte sein Rechtsanwalt Graf von der Goltz fest, daß eine Namenverwechslung vorlag: nicht Werner von Fritsch, sondern Achim von Frisch, Rittmeister a. D., war der Erpreßte. Der Urteilspruch des Reichskriegsgerichts vom 18. März 1938 lautete: „Die Hauptverhandlung hat die Unschuld des Generaloberst a. D. Freiherr von Fritsch in allen Punkten ergeben.“13
Was war nun der ‘Fall Fritsch’? Er bildete den Endpunkt einer Entwicklung, des Machtkampfes zwischen der Partei, der rivalisierenden SS und dem Heer, das diesen Kampf verlor.
Schwer haderte Fritsch mit seinem Schicksal, seiner Verabschiedung und der Schmach. Er fühlte sich nicht rehabilitiert, auch nicht nach seiner von seinem Nachfolger Brauchitsch betriebenen Ernennung zum Chef des Artillerie-Regiments 12 in Schwerin; denn dies war nur eine äußere Geste. Margot von Schutzbar-Milchling wollte ihn heiraten. Fritsch aber lehnte ab: „Ich bin durch die Ereignisse des letzten Jahres in meinem inneren Gleichgewicht gestört. Das gilt in rechter Linie für das persönliche Erleben, das ich durchgemacht habe. Aber auch die Entwicklung der innen- und außenpolitischen Lage hat mich nicht zur Ruhe kommen lassen. Wenn ich auch mit einem Fußtritt aus meiner Lebensarbeit entfernt bin, das Geschehen der letzten 4½ Jahre ist doch unlösbar innerlich mit mir verknüpft. Darum kann ich der weiteren Entwicklung nicht gleichgültig gegenüberstehen. Ich ringe darum, endlich zur Ruhe zu kommen.“14
Die Ruhe und die Einsamkeit, die er sich wünschte, fand er indessen nicht. „Ich komme immer noch nicht darüber hinweg, daß der Mann, für den ich auch persönlich 4 Jahre gearbeitet habe, und gerade dieser Mann mich verraten und im Stich gelassen hat“, schrieb er Ende November 1938 an seine Vertraute.15 Zutiefst hatte Fritsch resigniert und litt an Depressionen. Im selben Brief, den er nach dem Pogrom gegen die Juden schrieb, notierte er: „Der Kampf mit dem Weltjudentum hat allerdings jetzt schon offiziell begonnen. Folgerichtig muß das zum Krieg mit England u[nd] U.S.A., den politischen Hochburgen des Judentums, führen.“16 Indes ist diese Äußerung nur die Vorankündigung einer noch übleren Entgleisung. Wenige Wochen später, im Dezember, schrieb Fritsch: „Bald nach dem Kriege kam ich zur Ansicht, daß 3 Schlachten siegreich zu schlagen seien, wenn Deutschland wieder mächtig werden sollte. 1. die Schlacht gegen die Arbeiterschaft, sie hat Hitler siegreich geschlagen. 2. gegen die katholische Kirche, besser gesagt gegen den Ultramontanismus u. 3. gegen die Juden. In diesen Kämpfen stehen wir noch mitten drin. Und der Kampf gegen die Juden ist der schwerste. Hoffentlich ist man sich über die Schwere dieses Kampfes klar.“17 Der Antisemit Fritsch offenbarte, wieder einmal, sein diffuses und dumpfes Weltbild.
Dann aber, wenige Tage nach dieser Hetze, bekundete er: „Ich kann das Gefühl nicht loswerden, als ob die Dinge doch noch zu einem großen Kriege treiben, obwohl ich mir keinen rechten Vers daraus machen kann.“18 Dies war eine nüchterne Beurteilung der Lage, die er, der geschulte Generalstabsoffizier, gelernt hatte. Ahnte Fritsch, daß der Weg in den Krieg nun unaufhaltsam war? Er kannte Hitlers oft wiederholte Absicht, im Osten ‘Lebensraum’ zu gewinnen. Bereits Mitte Januar 1939 aber schrieb er: „Da ich den nächsten Krieg als Frontsoldat erleben will, muß man den Körper trainieren.“19 Hoffte er nun auf eine militärische Auseinandersetzung?
Anfang Februar 1939 zog Fritsch von Achterberg, seinem „Asyl“, wie er das Jagdhaus bei Soltau in der Lüneburger Heide bezeichnete, nach Berlin-Zehlendorf. Dort, in der Albertinenstraße, hatte ihm das Heer ein Haus geschenkt, „Haus Treue“. Brauchitsch hatte dazu den Anstoß gegeben.
Dennoch war Fritsch verbittert. Er hatte keine Aufgabe mehr, und je länger er über die Geschehnisse im Frühjahr 1938 nachdachte, desto mehr resignierte er. Er mied die Hauptstadt nicht nur, weil er keine Ruhe und Einsamkeit fand, sondern auch, weil Berlin und die Menschen, denen er begegnete, Erinnerungen in ihm wachriefen, die er verdrängen wollte. Erneut suchte Fritsch Achterberg auf. „Aber auch für mich persönlich ist es schwer zu sehen, wie jeder Soldat fieberhaft militärisch beschäftigt ist, für mich gibt es aber weder im Frieden noch im Krieg eine Tätigkeit in Deutschland des Herrn Hitler. Denn im Kriege begleite ich mein Regiment nur als Scheibe, da ich nicht zu Hause bleiben kann“, schrieb er im August an seine Vertraute.20 Mit „Scheibe“ meinte Fritsch, er wäre als Chef seines Regiments nur nutzlos.
Mitte August kehrte er in die Hauptstadt zurück. Wenig später teilte ihm Brauchitsch mit, Hitler betrachte den Krieg mit Polen als unvermeidlich. Fritsch beabsichtigte, wie er es im September 1938 während der Krise mit der Tschechoslowakei auch getan hatte, sich wieder seinem Artillerie-Regiment anzuschließen, das sich in Ostpreußen befand; dies war für ihn eine selbstverständliche Pflicht.
Am 21. August 1939 verließ Fritsch Berlin und erreichte am folgenden Tag sein Regiment in Ortelsburg. Leutnant der Reserve Werner Rosenhagen wurde sein Begleitoffizier. Launig notierte er Ende August: „Hier erwarten wir bei Schwüle, großer Hitze u. viel Staub die Dinge, die da kommen sollen. Ein klares Urteil über die Lage habe ich natürlich nicht. […] Hoffentlich werden uns die nächsten Tage eine Entscheidung bringen.“21
Die Entscheidung kam bald. Am 1. September überschritt die 12. Infanterie-Division, zu deren Verband das Artillerie-Regiment 12 gehörte und die dem Armeeoberkommando 3 unterstand, im Süden Ostpreußens die polnische Grenze. Der Zweite Weltkrieg begann.
Die 3. Armee mit ihrem Oberbefehlshaber, General der Artillerie von Küchler, trat am 14. September zum Angriff in Richtung Praga, einer Vorstadt von Warschau, an. Eine gewaltsame Erkundung war indessen noch notwendig, die für den 22. September befohlen wurde. Einen Tag zuvor schrieb Fritsch: „Zu tun habe ich hier nichts, absolut gar nichts. Dieser ganz unwürdige Zustand ist nicht nur schwer zu ertragen, sondern auch bodenlos langweilig, da wir nur wenig mit dem Feind in Berührung gekommen sind.“22 Es war daher Langeweile, die Fritsch veranlaßte, sich dem Unternehmen anzuschließen.
Fritsch bricht am 22. September 1939 gegen acht Uhr vom Gefechtsstand des Artillerie-Regiments 12 in Drewnica mit dem Kraftwagen auf. Rosenhagen begleitet ihn. Aufmerksam beobachtet er den Feuerüberfall seines Regiments auf Praga, der um neun Uhr einsetzt, und begibt sich mit Rosenhagen in die vorderste Linie. Nach neun Uhr vierzig, bereits auf dem Rückweg, trifft ihn am linken Oberschenkel ein Querschläger, der ihn schwer verletzt. Fritsch bricht sofort zusammen. Seine letzten Worte sind: „Lassen Sie nur.“ Sie sind an Rosenhagen gerichtet, der versucht, das Bein abzubinden. Nach einer Minute ist Fritsch tot.
Soldaten bergen seinen Leichnam unter erheblichen Mühen und bringen ihn in die Kirche von Struga. Dort nimmt Küchler Abschied von seinem Freund und Regimentskameraden. Am nächsten Tag, dem 23. September, bevor der Sarg in die Hauptstadt abtranportiert wird, hält er eine kurze Ansprache vor den in der Kirche versammelten Offizieren und Angehörigen des Artillerie-Regiments 12 und anderen Offizieren. Der von Hitler angeordnete Staatsakt findet am 26. September in Berlin, Unter den Linden, statt. Brauchitsch hält die Trauerrede. Danach wird der Sarg auf dem Invalidenfriedhof beigesetzt.
Ein Jahr danach, zum ersten Todestag, bat der Kommandeur des Artillerie-Regiments 12 einen Stabsoffizier, einen Kranz am Grabe niederzulegen. Der Kranz war bereits bestellt, als dieser Offizier einen Anruf des Amtes Ausland/Abwehr mit dem Hinweis erhielt, daß der ‘Führer’ solche Ehrungen verbiete. Es war derselbe ‘Führer’, der am 26. September 1939 einen Tagesbefehl an die Wehrmacht erlassen hatte: „Die Deutsche Wehrmacht senkt ehrend ihre Fahnen vor der Größe dieses Soldatentums.“23 Jetzt, im September 1940, nach dem siegreichen Feldzug gegen Frankreich, hatte nur der ‘Führer’ und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht das Heer aufgebaut – und kein anderer.