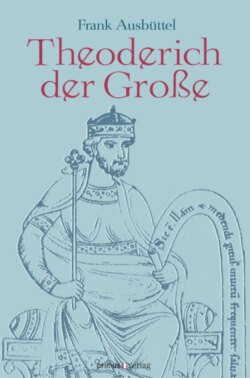Читать книгу Theoderich der Große - Группа авторов - Страница 7
Einleitung
ОглавлениеIm Frühjahr des Jahres 500 reiste der Gotenkönig Theoderich nach Rom, um dort sein dreißigjähriges Regierungsjubiläum zu feiern. Als er sich der Stadt näherte, eilten ihm Papst Symmachus, Vertreter des Senats und Bewohner der Stadt entgegen, um ihm einen ehrenvollen Empfang zu bereiten. Nachdem der Gote die Stadt betreten hatte, suchte er zunächst die Curie, den Sitz des Senats auf dem Forum Romanum, auf; dort hielt er eine programmatische Rede, auf die der Vorsitzende des Gremiums, der angesehene Senator Flavius Rufius Postumius Festus mit einer Lobrede antwortete. Dann wandte sich Theoderich auf der Palma, einem zwischen der Curie und dem Septimius-Severus-Bogen gelegenen Platz, an das Volk. Feierlich versprach er, die Anordnungen früherer Kaiser einzuhalten. Schließlich begab sich der König in den Kaiserpalast, den einst Constantin für seine Mutter Helena hatte errichten lassen. Insgesamt sechs Monate hielt sich Theoderich danach noch in Rom auf. Während dieser Zeit ließ er Zirkusspiele für die Bevölkerung veranstalten und ordnete an, dass jährlich 120.000 Scheffel Getreide an das Volk, insbesondere an die Armen, verteilt sowie ebenfalls jährlich 200 Pfund Gold für die Erneuerung des Kaiserpalastes, der Aurelianischen Stadtmauer, der Curie, des Colosseums und anderer Gebäude ausgegeben werden sollten.1
Das Besondere an diesem Ereignis war nicht der Besuch eines mächtigen Fürsten. Obwohl Rom in der späten Kaiserzeit seine zentrale Bedeutung für das Reich verloren hatte, war es immer noch dessen ideeller Mittelpunkt und als eine der größten Städte – wenn nicht gar als größte Stadt Italiens – durch die Anwesenheit des Senats und des Papstes nach wie vor ein Machtzentrum. Bemerkenswert ist vielmehr, dass die katholische Bevölkerung Roms einen germanischen König, der sich nicht zum katholischen, sondern zum arianischen Glauben bekannte, wie einen römischen Kaiser aufnahm. Der Empfang des Goten vor der Stadt sowie sein Auftreten in ihr entsprachen dem Zeremoniell, das in früheren Zeiten bei der Ankunft des Kaisers, dem adventus Caesaris stattfand. Ohne Vorbehalte und Ressentiments akzeptierten demnach die Römer, dass ein Germane über das ehemalige Kernland des Reiches herrschte. Der Rombesuch Theoderichs im Jahr 500 symbolisiert letztlich eine ‘Endstufe’ in dem Verhältnis zwischen Römern und Germanen.
Dabei hatten sich die Römer schon seit längerer Zeit daran gewöhnt, dass ‘Barbaren’, unter ihnen vor allem Germanen, führende und einflussreiche Positionen im Heerwesen und damit in der Leitung des Reiches wahrnahmen. Diese Entwicklung ist darauf zurückzuführen, dass die Kaiser seit dem frühen 4. Jahrhundert verstärkt dazu übergegangen waren, Barbaren außerhalb des Reichsgebietes für ihr Heer zu rekrutieren. Als Beispiel sei hier auf die Ansiedlung reichsfremder Krieger in Nordgallien verwiesen, die der Militärdienst zu neuen Stämmen, den Sal- und Rheinfranken zusammenschweißte. Einige der germanischen Soldaten stiegen sogar bis zum Heermeister auf, wie die Franken Merobaudes und Arbogast oder der Vandale Stilicho. Merobaudes verhalf Valentinian II. (375–392) auf den Thron, während Arbogast ihn wieder stürzte. Stilicho bestimmte nach dem Tod des Kaisers Theodosius 395 als Regent für dessen Sohn Honorius bis 408 die Politik des Westreiches. Unter den Offizieren bildeten die Barbaren jedoch eine Minderheit. Ihr Anteil lag höchstwahrscheinlich unter einem Drittel.2
Die Präsenz von Germanen nahm aber noch aus einem anderen Grund zu. Seit dem späten 4. Jahrhundert drangen in bis dahin unbekanntem Ausmaße Germanenstämme in das Römische Reich ein und erlangten nach schweren militärischen Kämpfen die Herrschaft über mehrere Gebiete. Zu nennen sind hier insbesondere die Goten, welche die Donau überquerten, um vor den Hunnen Schutz zu suchen. Als sich ihnen 378 bei Adrianopel ein römisches Heer entgegenstellte, brachten sie ihm eine vernichtende Niederlage bei; bald darauf unterstellten sie sich jedoch den römischen Kaisern. Ein großer Teil ihres Volkes, die Westgoten, zog einige Jahre später unter seinem König Alarich zunächst nach Italien und dann weiter nach Westen, wo ihm Kaiser Honorius Land in Aquitanien zuwies. Gegen Ende des Jahres 406 überschritten Vandalen, Sueben und nichtgermanische Alanen bei Mainz den zugefrorenen Rhein. Nach Raubzügen in Gallien ließen sich die Sueben in Galicien und die Alanen in den spanischen Provinzen Lusitania und Carthaginiensis nieder. Die Vandalen hielten sich indes nicht lange in Südspanien auf, sondern setzten 429 unter ihrem König Geiserich nach Nordafrika über. Nach der Eroberung Carthagos überließ ihm Kaiser Valentinian III. 442 in einem Vertrag offiziell seine nordafrikanischen Besitzungen. Die Burgunder vereinnahmten bald nach ihrem Rheinübergang 406 die Gebiete um Straßburg, Speyer und Worms. Der römische Feldherr Aëtius wies ihnen 443 die Gegend um Genf, die Sapaudia, als Wohnsitze zu.
Viele dieser Germanenreiche übernahmen militärische Aufgaben für das Römische Reich. So versahen die Könige der Burgunder seit 463 das Heermeisteramt für Gallien. Der König der Rheinfranken kontrollierte die Provinz Germania II, während Childerich (460–482), der König der Salfranken, die Provinz Belgica II verwaltete und seine Krieger unter römischem Oberbefehl gegen die Westgoten, Alamannen und Sachsen führte. Der Westgotenkönig Theoderich I. zog 422 gegen die Vandalen zu Felde und folgte 451 seinem einstigen Widersacher Aëtius in der Schlacht gegen die Hunnen auf den Katalaunischen Feldern, obwohl er kein militärisches Amt bekleidete. Sein Sohn Theoderich II. besiegte 456 im Auftrag des Kaisers Avitus die Sueben. Eine Ausnahme stellte der Vandalenkönig dar. Geiserich hatte sich zwar gegenüber dem Kaiser zu militärischen Hilfeleistungen verpflichtet, betrachtete sich letztlich aber als unabhängiger Herrscher.
Indem Germanen immer mehr Macht im Römischen Reich gewannen, blieb es nicht aus, dass einige von ihnen selbst nach der Kaiserwürde strebten. Doch taten sie dies ohne nennenswerte Auswirkungen und dauerhaften Erfolg. Bereits zwischen 276 und 282 ließ sich Proculus, ein Mann fränkischer Abstammung, in Köln zum Kaiser ausrufen; seine Usurpation wurde indes schnell niedergeschlagen. Erfolgreicher war dagegen der germanische Offizier Magnentius. Nach seiner Proklamation fand er 350 Anerkennung im ganzen Westen. Er beging jedoch 353 Selbstmord, nachdem ihm Kaiser Constantius II. mehrere Niederlagen beigebracht hatte. Der fränkische Heermeister Silvanus konnte sich 355 nach seiner Usurpation noch nicht einmal einen Monat lang an der Macht halten. Im Jahre 408 war der Vandale Stilicho fälschlicherweise verdächtigt worden, er wolle seinen Sohn Eucherius zum Kaiser ausrufen lassen, was beiden das Leben kostete. Als sich 423 ein Interregnum ergab, erhob sich der gotische Hofbeamte Johannes zum Kaiser; er wurde allerdings von Konstantinopel nicht anerkannt und 425 nach seiner Gefangennahme hingerichtet.
Erst am Ende des 5. Jahrhunderts gelang es dem Goten Theoderich als erstem Germanenkönig, dauerhaft und von den Römern anerkannt über weite Teile des Römischen Reiches wie ein Kaiser zu herrschen. Mit seinem Rombesuch brachte er dies deutlich zum Ausdruck. Dieser politische Erfolg war aufgrund seiner Herkunft nicht abzusehen gewesen. Er ist umso erstaunlicher, als Theoderich einem eher unbedeutenden gotischen Stamm angehörte, der noch keine feste Herrschaft auf römischem Boden gegründet hatte.