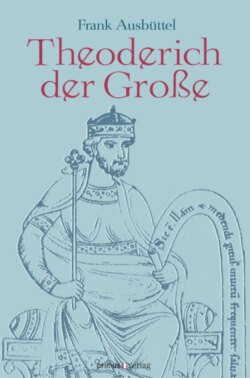Читать книгу Theoderich der Große - Группа авторов - Страница 9
II. Feldzüge auf dem Balkan
ОглавлениеMit dem Abzug der Goten aus Pannonien verlor Theoderich nicht nur nach kurzer Zeit sein gerade erworbenes Territorium, sondern musste sich auch völlig dem Oberbefehl seines Vaters unterordnen. In der darauf folgenden Zeit bis 488 gelang es ihm jedoch, als alleiniger König die Macht seines Stammes zu erweitern und im Dienst des römischen Kaisers zu besonderen Ehrungen und Auszeichnungen zu gelangen wie kaum ein germanischer Heerführer vor ihm. Dadurch wurde er aber auch immer mehr in die Machtkämpfe am Hof und in viele sinnlose Feldzüge verwickelt, die sein Verhältnis zum oströmischen Kaiser belasteten.
Zunächst entwickelten sich die Ereignisse für die pannonischen Goten aber nicht dramatischer, als zu erwarten gewesen wäre. Nachdem sie ihre Wohngebiete verlassen hatten, setzten sie ungehindert über die Save. Die Sarmaten verhielten sich ruhig, und auch römische Truppen scheinen die Goten nicht an ihrem Vormarsch gehindert zu haben. Ohne nennenswerten Widerstand ergab sich ihnen Naissus, ein verkehrstechnisch günstig gelegener Handelsmittelpunkt in Mösien, wo Theodemer und Theoderich ihr Quartier aufschlugen. Wahrscheinlich verbrachten sie und ihre Gefolgsleute hier den Winter von 473 auf 474.
Da sich die Goten vor römischen Angriffen nicht sicher fühlten, teilten sie sich bei ihrem weiteren Vormarsch auf (Abb.2). Unterstützt von den Heerführern Astat und Invilia zog Theoderich mit seinen Kriegern über Castrum Herculis und Ulpiana und eroberte die makedonische Stadt Stobi. Dann stieß er bis nach Thessalien vor und brachte die Städte Heraclea und Larissa in seine Gewalt. Durch diesen Erfolg seines Sohnes ermutigt, verließ auch Theodemer Naissus, nicht ohne eine gotische Garnison zur Bewachung der Stadt zurückzulassen. Sein Ziel war Thessalonica, die wohlhabende Hafenstadt am Thermaischen Golf. Sie war indes stark befestigt und beherbergte in ihren Mauern Truppen, die der Patricius und Leiter der kaiserlichen Kanzleien Hilarianus befehligte. Dieser ließ es auf keine bewaffnete Auseinandersetzung mit den Goten ankommen, sondern einigte sich mit Theodemer darauf, dass dessen Leute in Makedonien Land zugewiesen bekamen. Ihr neues Territorium umfasste die Städte Cyrrhus, Pella, Europus, Methone, Pydna, Beroea und Dium. Die Goten hatten damit ein fruchtbares Gebiet erhalten, durch das mit der Via Egnatia eine wichtige Staatsstraße von Dyrrhachium nach Konstantinopel verlief und in dem sich andere Verbindungswege zur Donau und nach Griechenland kreuzten. Für die Römer hatte Hilarianus mit dem Abkommen erreicht, dass die Goten weit genug von der Hauptstadt fern blieben.1
Abb. 2: Wanderungsbewegungen und Feldzüge der pannonischen Goten in der Zeit von 473–480.
Bald nach diesem Friedensschluss erkrankte Theodemer schwer. In Cyrrhus hielt er noch 474 eine Versammlung seiner Goten ab und bestimmte den erst zwanzigjährigen Theoderich zu seinem Nachfolger, bevor er starb. Damit begann die zweite Phase in der Herrschaft Theoderichs. Er wurde ohne Widerstand als alleiniger König der Goten akzeptiert, was für das gestiegene Ansehen seines Vaters und der Familie der Amaler, aber auch für seine unumstrittene Anerkennung als Heerführer spricht. Seinen jüngeren Bruder Theodemund beteiligte er nicht an der Herrschaft; eine Teilung der Macht wie zu Zeiten Valamers und seiner Brüder kam für Theoderich offensichtlich nicht mehr in Frage.
Obwohl die Goten von Pannonien rund 1200 km weit gezogen waren, blieben sie nicht lange in Makedonien; denn bald darauf brachen sie abermals auf – diesmal etwa 400 km nach Nordosten.2 Erneut ließen sie sich im römischen Grenzgebiet nieder, diesmal im Gebiet von Novae in Niedermösien. Offensichtlich fühlten sie sich dort sicherer als in Makedonien, das ihnen zu zentral lag. Da ihnen Hilarianus anscheinend keine Subsidien und ihren Anführern keine Ehrenstellungen versprochen hatte, dürfte ihnen der Abmarsch umso leichter gefallen sein. Trotzdem befanden sie sich in Niedermösien weiterhin in Reichweite des Kaisers für den Fall, dass dieser ihre Unterstützung benötigte.3
In der Tat erreichte Theoderich in Novae ein Hilfegesuch Zenos (Abb. 3), der den Goten aus dessen Zeit als Geisel am Hof kannte. Zeno hatte sich einige Tage nach dem Tod Leos I. am 9. Februar 474 zum Mitkaiser des erst siebenjährigen gleichnamigen Enkels Leos ausrufen lassen. Als dieser Leo II. Ende 474 starb, zettelte der Heermeister Basiliscus mit Unterstützung seiner Schwester Verina, der Witwe Leos I., und deren Neffen Armatus sowie des isaurischen Generals Illus eine Verschwörung gegen Zeno an. Der Kaiser musste sich daraufhin aus Konstantinopel zurückziehen und Basiliscus den Thron überlassen.
In die Verschwörung war auch ein Gote namens Theoderich mit dem Beinamen Strabo („der Schieler“) verwickelt. Trotz der Namensgleichheit war er mit dem Amaler Theoderich nicht verwandt. Damit sie nicht verwechselt werden können, werden sie im Folgenden als Strabo und Amaler bezeichnet.
Abb. 3: Münzbild des oströmischen Kaisers Zeno (474–491).
Strabo gehörte zu den in Thrakien lebenden Goten. Als Neffe von Aspars dritter Ehefrau verfügte er über gute Kontakte zum kaiserlichen Hof. Nach der Ermordung des Heermeisters, Zenos mächtigen Gegenspielers, hatte er seine Rivalen beseitigt und die in Thrakien lebenden Goten unter seiner alleinigen Herrschaft vereinigt. Da Strabo wohl mehr als 12.000 Soldaten stellen konnte, war er für Leo I. zu einem wichtigen Machtfaktor geworden, zumal die Goten nicht weit von der kaiserlichen Residenz siedelten. 473 schlossen Theoderich Strabo und Leo I. ein Bündnis. In ihm verpflichtete sich der Kaiser, den Goten jährlich 2000 Pfund Gold zu zahlen; Strabo erhielt den Rang des oberen Heermeisters am Hofe. Leo I. willigte außerdem ein, ihn als alleinigen Herrscher der Goten zu akzeptieren und keine gotischen Deserteure aufzunehmen. Als Gegenleistung musste Strabo gegen jeden Feind des Kaisers kämpfen, mit Ausnahme der Vandalen.4 Die thrakischen Goten befanden sich damit in einer viel günstigeren Lage als ihre pannonischen Stammesbrüder.5
Zeno setzte bei seiner Machtübernahme denn auch sogleich Strabo als Heermeister ab und stellte die Subsidienzahlungen für dessen Heer ein. Basiliscus wiederum gab nach der Vertreibung Zenos den thrakischen Goten ihre Rechte zurück und ernannte im Januar 475 Strabo erneut zum Heermeister am Hofe. Während seines Exils bemühte sich Zeno um die Unterstützung verschiedener mächtiger Personen – so auch, wie bereits erwähnt, um die des Amalers Theoderich. Er, der wahrscheinlich über 15.000 Mann verfügte, ließ sich auf dieses Machtspiel ein und konnte nun die thrakischen Goten von Nordwesten aus bedrohen.
Bereits im August 476 gelang Zeno die Rückkehr nach Konstantinopel, nachdem Armatus und Illus zu ihm übergelaufen waren und Basiliscus getötet worden war. Auch Strabo hatte sich von dem Usurpator abgewandt, da er sich von ihm zurückgesetzt fühlte. Zudem befürchtete er nun einen Konflikt mit den nach Novae vorgerückten pannonischen Goten. Sein Seitenwechsel kam jedoch zu spät, um die Gunst Zenos zu gewinnen. Dieser ernannte nach seiner Rückkehr anstelle von Strabo 476 den Amaler Theoderich zum Heermeister am Hofe und verlieh ihm den mit diesem Amt verbundenen Ehrentitel Patricius. Theoderich hatte damit, ohne eine militärische Laufbahn absolviert zu haben, die ranghöchste Stelle eines Befehlshabers im römischen Heer erhalten. Das entsprach durchaus der damaligen Praxis, nach der die Kaiser nach Bedarf für sie wichtige Personen zu Heermeistern ernannten. Bedenklich für den Goten war eher die Tatsache, dass er keiner der mächtigen Heermeisterfamilien angehörte und somit ein Emporkömmling innerhalb des spätrömischen Militäradels war. Diesen Makel glich der Kaiser aber kurze Zeit später aus, indem er den Amaler nach germanischer Sitte adoptierte und als seinen Waffensohn anerkannte. Es ist dies die erste bekannte Adoption eines Barbarenfürsten durch einen römischen Kaiser. Auch wenn mit der Waffensohnschaft keine erbrechtlichen Ansprüche verbunden waren, verdeutlichte Zeno mit ihr, dass er den Amaler zu seinen engsten Vertrauten zählte und ihm eine Vorrangstellung unter den mit dem Reich verbündeten Goten einräumte. Dessen pannonische Goten erhielten nun jene Subsidien, die Leo I. den thrakischen Goten zugestanden hatte.6 Der Amaler hatte damit endlich sein Ziel erreicht, für seine Gefolgsleute mehr Macht und Wohlstand zu erlangen, indem sie ihr Territorium vom Norden weiter nach Südosten in die Nähe der Hauptstadt verlagerten.
Ihre neue Lage machte die pannonischen Goten zu Rivalen ihrer thrakischen Stammesbrüder. Über diese Rivalität, die sich bis 484 hinzog, sind wir phasenweise durch längere Fragmente aus dem Geschichtswerk des Malchus informiert. Die folgenden Ereignisse sind jedoch etwas verwirrend, weil sich Stammesquerelen mit Usurpationsversuchen verbinden, Feinde sich zwischenzeitlich aussöhnen und wieder entzweien. Hinzu kommt ein quellenkritisches Problem: Philologen und Historiker haben die Fragmente aus Malchus’ Geschichtswerk unterschiedlich angeordnet, was unweigerlich zu unterschiedlichen Rekonstruktionen der Ereignisse geführt hat. Eine neuere Untersuchung hat sie allerdings in eine Ordnung gebracht, durch die der Ablauf der Ereignisse klarer und übersichtlicher wird.7
Theoderich Strabo gab nach dem Verlust seiner Position am kaiserlichen Hof keineswegs auf, sondern setzte seinen ganzen Ehrgeiz darein, sie zurückzuerlangen. Er konnte dabei mit der Rückendeckung des Illus rechnen, den Zeno nach seinem Sieg über den Usurpator Basiliscus zum Patricius und Leiter der kaiserlichen Kanzleien ernannt hatte; denn da Illus den Bruder Zenos gefangen hielt, war der Kaiser bei aller Antipathie auf die Zusammenarbeit mit ihm angewiesen. Es war wahrscheinlich dieser Illus, der Strabo 477 aufforderte, Zeno ein Vertragsangebot zu machen. Nachdem der Senat bereits erklärt hatte, dass die Finanzlage des Staates es nicht zulasse, an beide Goten Subsidien zu zahlen, machte Zeno seinen ganzen Einfluss geltend, um das Bündnis mit dem Amaler aufrechtzuerhalten. Er versammelte alle in Konstantinopel stationierten Truppeneinheiten und heizte die Stimmung gegen Strabo an. Der Kaiser erklärte, Strabo sei den Römern gegenüber stets feindlich gesinnt gewesen, habe den Bewohnern Thrakiens Schaden zugefügt und seinen Gegner Basiliscus unterstützt. Diesen habe er sogar überredet, seine römischen Truppen zu Gunsten der gotischen aufzugeben. Bevor Zeno allerdings Strabos Gesuch abschlägig beschied, ließ er drei Personen inhaftieren, die den Gotenfürsten über die Ereignisse in der Hauptstadt informiert hatten. Ein Senatorengericht verurteilte sie in Illus’ Anwesenheit zu ewiger Verbannung.
Im darauf folgenden Jahr konnte der mächtige Hofbeamte es wieder durchsetzen, dass Strabo erneut staatliche Gelder erhielt und als „Freund“ angesehen wurde. Der Hintergrund hierfür ist in einem gescheiterten Attentat auf Illus zu suchen, das die Kaiserinmutter Verina veranlasst hatte. Sie musste Zeno nun seinem Gegner ausliefern.
Das Bündnis zwischen Illus und Theoderich Strabo zerbrach bereits wenig später bei einem erneuten Usurpationsversuch. Gegen Ende des Jahres 479 erhob sich der Heermeister Flavius Marcianus, der Sohn des weströmischen Kaisers Anthemius und Ehemann von Leos I. und Verinas Tochter Leontia, gegen die Herrschaft der Isaurier. Er forderte von Illus die Auslieferung seiner Schwiegermutter Verina. Strabo wollte die Gelegenheit nutzen und den Heermeister gegen den Kaiser unterstützen. Als er mit seinen Truppen nach Konstantinopel zog, kam er jedoch zu spät. Illus und Zeno hatten die Revolte bereits niedergeschlagen. Der Heerführer der thrakischen Goten gab nun vor, er habe den Kaiser und seine Stadt verteidigen wollen. Zeno lobte ihn denn auch für seinen Einsatz und bat ihn zugleich umzukehren. Strabo weigerte sich jedoch; seine Soldaten seien zu erschöpft, um sich sofort wieder zurückzuziehen. Dies konnte Zeno nicht hinnehmen. Er befürchtete Unruhen in der Hauptstadt, solange die thrakischen Goten vor ihren Toren lagerten. Mit großen Geldsummen sowie mit Drohungen und Versprechungen bewog er sie und Strabo abzuziehen. Trotz mehrmaliger Bitten des Kaisers weigerte sich der Gotenkönig allerdings, die Verschwörer auszuliefern, die zu ihm geflohen waren.
Der Amaler Theoderich betrachtete diese Ereignisse aus der Distanz und verhielt sich zunächst ruhig und abwartend. Er sah keinen Nutzen darin, sich in die innenpolitischen Angelegenheiten einzumischen. Strabo hatte zwar vor Konstantinopel eindrucksvoll seine Macht demonstriert, der Amaler brauchte dennoch nichts von seinem gotischen Gegner zu befürchten, da dieser mit seiner vorschnellen Aktion seinen alten Verbündeten Illus gegen sich aufgebracht hatte. Angesichts dieser Lage begann Zeno Strabo zu provozieren. Durch Gesandte schlug er dem Gotenfürsten vor, seinen Sohn als Geisel auszuliefern und selbst als Privatmann in Konstantinopel zu leben. Als Gegenleistung garantierte er ihm seinen erworbenen Besitz, forderte ihn aber gleichzeitig auf, keine Unruhe zu stiften. Strabo lehnte dieses Ansinnen mit der Begründung ab, er habe eine Menge Leute, die zu ihm gekommen seien, zu versorgen oder mit ihnen Krieg zu führen.8
Zeno suchte jetzt die Entscheidung gegen Strabo, indem er vom Schwarzen Meer, aus Kleinasien und den östlichen Bezirken Truppen zusammenzog. Den Oberbefehl sollte anfänglich der Leiter der Hofkanzleien Illus übernehmen. Als Zeno dann aber den Heermeister Martinianus berief, verunsicherte das die Soldaten, und es kam zu Unruhen im Heer. Zeno forderte daraufhin den Amaler Theoderich auf, nicht länger einer Schlacht auszuweichen und die Erwartungen zu erfüllen, die man in ihn als römischen Heermeister gesetzt habe. Der Amaler war aber angesichts der Ereignisse der letzten Zeit vorsichtig geworden. Er wollte sich und seine Soldaten nicht unnötig der Gefahr aussetzen und dachte nicht daran, in einem Feldzug seine Kräfte zu verschleißen; denn nach der Zurücksetzung des Illus konnte es sein, dass dessen Partner die Seite wechselten und er somit allein dastand. Daher insistierte er darauf, dass Kaiser und Senat in einem Eid schworen, nie mit Theoderich Strabo ein Abkommen einzugehen. In der Tat legten der Senat und die führenden Amtsträger einen Schwur ab, allerdings mit dem Zusatz, sofern der Kaiser es nicht anders wolle. Zeno selbst schwor, seinerseits die bestehenden Verträge einzuhalten, sofern der Amaler sie nicht breche.
Dieser fühlte sich jetzt sicher genug und zog seine Streitkräfte bei Marcianopolis zusammen. Vor dem Haemus sollte ihn der für Thrakien zuständige Heermeister mit 2000 Reitern und 10.000 Fußsoldaten empfangen. Nach der Überquerung des Gebirges war bei Adrianopel ein weiterer Zuwachs um 6000 beziehungsweise 20.000 Mann geplant. Des Amalers Streitmacht hätte dann ungefähr 50.000 Personen umfasst und wäre den thrakischen Goten um das Vier- bis Fünffache überlegen gewesen. Falls notwendig, hätten aus Heraclea und den Garnisonen in der Umgebung Konstantinopels weitere Streitkräfte angefordert werden können.
An dem vereinbarten Ort traf der Amaler allerdings weder auf den thrakischen Heermeister noch auf die versprochenen Einheiten. Dies mag keine böse Absicht gewesen sein: Da unter den kaiserlichen Truppen Unruhe herrschte, hatte sich deren Aufstellung verzögert. Bei dem Amaler weckte die Situation aber großes Misstrauen, als auch die für ihn bestimmten Subsidienzahlungen ausblieben. Überdies fühlte er sich verraten, weil die Wegführer, die ihm begegnet waren, sich sehr unvorsichtig verhielten; denn sie führten seine Reiterei, die Wagen und die ganze Fourage über steile Gebirgswege, sodass sie dem Feind ein leichtes Angriffsziel boten. Am Fuße des Berges Sondis stieß der Amaler dann auch mit seinem Gefolge überraschend auf seinen Gegner Strabo. Diese Begegnung gefährdete die politische Existenz des Amalers. Infolge des Feldzuges hatten seine Gefolgsleute hohe Verluste hinnehmen müssen und vor allem viele Pferde verloren. Am Sondis raubten die pannonischen und thrakischen Goten sich nun gegenseitig ihre Herden und versuchten möglichst viel Beute beim Gegner zu machen. Dabei kam es zu persönlichen Auseinandersetzungen, die Strabo psychologisch geschickt für sich ausnutzen konnte. Bei den pannonischen Goten, die sich ohnehin von den Römern getäuscht fühlten und wegen ihrer Verluste entmutigt waren, steigerte er die Unzufriedenheit. Strabo überzeugte sie davon, dass der Kaiser letztlich von der Zwietracht unter den Goten profitierte. Immer mehr Gefolgsleute des Amalers berieten sich daraufhin mit ihren Befehlshabern und waren bereit, zu Strabo überzulaufen. Angesichts dieser Lage und um seine Machtposition nicht zu gefährden ließ der Amaler mit seinem Namensvetter ein Treffen vereinbaren, das an einem Fluss stattfinden sollte. Das Misstrauen zwischen ihnen war indes sehr groß. Nach dem Bericht des oströmischen Historikers Malchus blieb jeder auf seiner Seite des Ufers stehen. Über das Wasser hinweg sollen sie dann – wohl durch Zuruf – vereinbart haben, nicht mehr gegeneinander zu kämpfen; jeder solle tun, was für ihn vorteilhaft sei. Nachdem sie sich dies gegenseitig geschworen hatten, schickten beide Gesandte nach Konstantinopel.
Der Amaler wähnte sich wegen dieses Bündnisses in einer starken Position. Bei Zeno beschwerte er sich jetzt darüber, dass dieser ein Abkommen mit Strabo geschlossen und ihn damit hintergangen habe. Er forderte die Zuweisung von Land und ausreichend Getreide für seine Truppen bis zur nächsten Ernte. Kaiserliche Finanzbeamte, welche die Getreidespeicher beaufsichtigten, sollten ihm überdies Rechenschaft über ihre Einnahmen ablegen, ansonsten könne er seine Soldaten nicht von Plünderungen abhalten. Der Kaiser wies die Vorwürfe des Gotenkönigs zurück und warf ihm seinerseits dessen Bündnis mit Strabo vor, das den thrakischen Heermeister erst davon abgehalten habe, sich den Goten anzuschließen. Da Zeno den Amaler aber weiterhin für seine Ziele einspannen wollte, ließ er es nicht zu einem Bruch kommen. Das Verhalten des Kaisers kann man auch dahingehend interpretieren, dass er insgeheim hoffte, die beiden Gotenheere würden sich früher oder später gegenseitig bekämpfen und aufreiben. Daher versprach er im Falle eines erfolgreichen Feldzuges und eines Sieges über Strabo dem Amaler eine reiche Belohnung im Wert von 1000 Pfund Gold, 40.000 Pfund Silber und jährliche Subsidien im Wert von 10.000 Solidi.9 Zudem wurde ihm die Ehe mit der Tochter des ehemaligen weströmischen Kaisers Anicius Olybrius oder einer anderen Frau aus den höchsten Kreisen Konstantinopels zugesagt. Auf die Forderungen, die der Amaler seinerseits gestellt hatte, ging Zeno nicht weiter ein. Der Gote ließ sich indes auch von zwei Unterhändlern des Kaisers nicht von seinem Bündnis mit Strabo abbringen. Um seinem Standpunkt Nachdruck zu verleihen, ordnete er Angriffe kleinerer Einheiten an, die bis zur Chersones vordrangen. Mit seiner harten Haltung sollte der Amaler zunächst Recht behalten. Statt zurückzuschlagen, blies der Kaiser sogar einen schon geplanten Feldzug gegen ihn ab und ließ die Soldaten in ihre Winterquartiere einrücken, was diese nur widerwillig befolgten.10
Plündernd und mordend zogen die Truppen des Amalers damals durch das Rhodopegebirge, und selbst hohe Verluste im Kampf mit römischen Einheiten konnten sie nicht abhalten. Ihr König zog weiter nach Makedonien und verwüstete dort Stobi, wie bereits sechs Jahre zuvor. Die Bewohner von Thessalonica versetzte er damit in Angst und Schrecken. Da keine kaiserlichen Truppen erschienen, die ihnen hätten helfen können, glaubten sie, Zeno wolle ihre Stadt dem Feind überlassen. Als der Amaler und sein Heer bereits vor den Toren standen, organisierten sie rasch eine Bürgerwehr. Da schließlich schickte Zeno zwei Unterhändler zu dem Gotenkönig, denen es gelang, den Amaler zum Einlenken zu bewegen. Er zeigte sich gesprächsbereit und schickte seinerseits eine Gesandtschaft nach Konstantinopel. Zudem hielt er seine Soldaten davon ab, Brände zu legen und zu morden, zog aber plündernd mit ihnen weiter. Als er zu der makedonischen Stadt Heraclea Lynkestis kam, beschenkte ihn deren Bischof reichlich. Daraufhin ließ er Land und Leute unversehrt und seine Truppen von den umliegenden Gütern maßvoll versorgen.
Des Amalers Drohgebärde – seine Raubzüge und Plünderungen – zeigte Wirkung: In Konstantinopel erreichten seine Gesandten, dass Zeno einen ranghohen Senator, den ehemaligen Stadtpräfekten Adamantius, zu ihm schickte. Dieser sollte ihn von Raubzügen abhalten, indem er ihm Land im Gebiet von Pautalia – zwischen Stobi und Serdica – zur Ansiedlung versprach. Aus römischer Sicht hatte dies zwei Vorteile: Zum einen konnte der Amaler von dort mit seinen Truppen schnell in Thrakien gegen Strabo einmarschieren, zum anderen hätten die in Illyrien und Thrakien stationierten römischen Truppen die Goten des Amalers besser in Schach halten können. Es war indes zu befürchten, dass dieser nicht nach Pautalia gehen wollte, weil keine Ernte zu erwarten war und seine Soldaten daher nicht versorgt werden konnten. Auch für diesen Fall hatte Zeno vorgesorgt. Sein Unterhändler erhielt 200 Pfund Gold, um von den lokalen Behörden die nötigen Lebensmittel kaufen zu können.
Allerdings kam es zu keinen Verhandlungen mit dem Amaler, da sich Adamantius nach Thessalonica begab. Die dort stationierten Soldaten hatten den Prätorianerpräfekten bedroht. Um eine weitere Eskalation des Streites zu verhindern, beauftragte Zeno seinen Gesandten, ihn zu schlichten. Der Amaler, der vielleicht schon von den kaiserlichen Plänen erfahren hatte, nutzte die Gelegenheit, seine Position weiter zu verbessern. Sein Ziel war, Dyrrhachium einzunehmen, eine reiche und befestigte Hafenstadt an der Adriaküste, von der aus man leicht Epirus kontrollieren und relativ schnell nach Italien übersetzen konnte. Um dies zu verwirklichen, bediente sich der Amaler einer List seines einflussreichen Landsmanns Sidimund, der in Epirus lebte. Er besaß dort große Ländereien und empfing Gelder vom Kaiser. Da Sidimunds Cousin Aedoingus Befehlshaber der kaiserlichen Garde und zudem mit der Kaiserwitwe Verina verwandt war, besaß er gute Kontakte zum Hof in Konstantinopel. Er versprach sich von der Ankunft des Amalers viel und nutzte seine Stellung und sein Ansehen bei der Bevölkerung von Dyrrhachium, indem er ihr erzählte, die Goten rückten mit Erlaubnis Zenos heran; zum Beweis verwies er auf die Anreise des kaiserlichen Gesandten Adamantius. Angesichts dieser Lage sei es besser, wenn die Einwohner so schnell wie möglich mit ihrem Besitz auf die Inseln oder in andere Städte flöhen. Selbst die 2000 Mann starke Besatzung Dyrrhachiums, gegen die der Amaler die Hafenstadt schlecht hätte erobern können, vermochte Sidimund zum Abzug zu bewegen.
Der Amaler gab währenddessen vor, auf die kaiserliche Gesandtschaft zu warten. In dieser Zeit traf ihn ein familiärer Schicksalsschlag: Seine namentlich nicht bekannte Schwester erkrankte schwer und starb bald darauf. Dies änderte aber nichts an seinem weiteren Vorgehen. Von der Stadt Heraclea forderte er eine Menge Getreide und Wein als Verpflegung für seine Soldaten. Deren Bewohner hatten sich indes, wohl ahnend, was ihnen bevorstand, in eine Festung zurückgezogen und erklärten, sie seien nicht in der Lage, solchen Forderungen nachzukommen. Daraufhin brannten die Goten den größten Teil der verlassenen Stadt nieder und brachen auf einem schwierigen und engen Weg nach Dyrrhachium auf. Dem Heer voraus schickte der Amaler seine Reiterei. Durch Überraschungsangriffe vertrieb sie Garnisonen, die sich ihr in den Weg stellten. Das übrige Gotenheer hatte der König in drei Kolonnen eingeteilt; die erste befehligte er selbst, die zweite Soas, sein fähigster Befehlshaber, und die Nachhut sein Bruder Theodemund. Als die Goten die Berge überwunden hatten, befahl der Amaler dem Tross, langsamer zu folgen, da durch römische Truppen keine Gefahr zu drohen schien und er mit seinen Soldaten so schnell wie möglich vorrücken wollte. Der Versuch, Lychnidus zu erobern, misslang aber, da die Stadt gut versorgt und befestigt war. Dafür nahm der Amaler das bereits evakuierte Scampia ein und eroberte schließlich im Sommer 480 Dyrrhachium.
Der kaiserliche Gesandte Adamantius war über diesen Coup verärgert, musste er doch um den Erfolg seiner Mission fürchten. Er schickte Kuriere zu dem Gotenkönig, die sich über dessen Vorgehen beschwerten. Ferner forderte er ihn auf, keine Schiffe in Dyrrhachium zu beschlagnahmen und auf seine Ankunft zu warten. Adamantius glaubte offensichtlich noch an eine friedliche Übereinkunft mit den Goten, zumal den Römern für einen Kampf nicht genügend Truppen zur Verfügung standen. Allerdings war Sabinianus Magnus, dem Adamantius gerade erst die Ernennung zum Heermeister für Illyrien überbracht hatte, ganz anderer Ansicht. Er war zum Kampf entschlossen und begann sogleich, ein Heer zusammenzustellen. Der Amaler ahnte davon noch nichts und wähnte sich weiterhin in einer starken Position. Erneut empfing er einen Kurier des Adamantius, der ihm als mögliche Verhandlungsorte Lychnidus oder Dyrrhachium vorschlug. Für den Fall, dass der kaiserliche Gesandte nach Dyrrhachium käme, sollte der Amaler als Gewähr für seine Sicherheit den Römern zwei hochrangige gotische Befehlshaber als Geiseln übergeben. Zum Verhandlungsort bestimmte er Dyrrhachium, weil er sich dort sicher glaubte, und schickte daher die beiden Geiseln los. Er befahl ihnen aber in Scampia zu bleiben, bis Sabinianus Magnus einem Abgesandten geschworen habe, ihnen kein Leid zuzufügen. Der Heermeister verweigerte aber getreu seiner Einstellung den Goten gegenüber den Schwur. Da es Adamantius nicht gelang, ihn von seiner starren Haltung abzubringen, ergriff er die Initiative und zog mit nur 200 Soldaten Begleitschutz nach Dyrrhachium.
Nahe der Hafenstadt besetzte Adamantius eine Befestigung oberhalb eines Flusses. Dort traf er sich mit dem Amaler, nachdem sich beide durch Soldaten gegen eventuelle Übergriffe des anderen abgesichert hatten. Zu Beginn der Unterredung warf der Gote dem kaiserlichen Gesandten vor, wie sehr man ihn bei Beginn des Feldzuges gegen Strabo im Stich gelassen habe. Adamantius wies die Vorwürfe zurück und versuchte seinerseits den Amaler einzuschüchtern. Er erinnerte ihn daran, wie sehr der Kaiser ihn geehrt und beschenkt habe und dass die Goten nur aus Thrakien hätten abziehen können, weil die Römer es zugelassen hätten. Ferner forderte er den Amaler auf, angesichts der römischen Übermacht Vernunft zu zeigen und Epirus zu verlassen. Um aber den Goten nicht ganz gegen sich aufzubringen, unterbreitete er ihm zum Abschluss seiner Rede erneut das Angebot Zenos, mit seinen Leuten nach Pautalia in die Provinz Dardania zu ziehen, wo sie schönes und fruchtbares Land erwarte, das nicht bewohnt sei und das ganze Gotenheer ernähren könne. Der Amaler beugte sich fürs Erste den Argumenten des Adamantius und schwor, das Angebot anzunehmen, forderte aber angesichts des langen Marsches und der großen Entbehrungen, die auf sein Gefolge warteten, die lange Reise dorthin auf das kommende Frühjahr zu verschieben. Den Winter wollte er noch in Dyrrhachium verbringen, aber keine weiteren Raubzüge unternehmen. Als Sicherheit dafür versprach er, seinen persönlichen Besitz und alle Leute, die nicht kämpfen konnten, einer Stadt nach Wahl des Kaisers zu überlassen sowie seine Mutter und eine Schwester als Geiseln zu stellen. Als Gegenleistung für das angebotene Siedlungsland wollte er sich mit 6000 seiner besten Krieger sobald wie möglich an einem Feldzug gegen die in Thrakien wohnenden Goten Strabos beteiligen. Gleichzeitig verlieh er seiner Hoffnung Ausdruck, dass er im Falle eines Sieges wieder zum Heermeister ernannt werde und als Bürger in Konstantinopel leben dürfe. Zudem erklärte er sich bereit, anschließend auf Befehl Zenos nach Dalmatien zu gehen, um dem aus Italien geflohenen Kaiser Julius Nepos wieder auf den Thron zu helfen.
Adamantius verhielt sich gegenüber derartigen Zukunftsplänen zurückhaltend, war es doch vorrangig sein Ziel, dass die Goten die Adriaküste verließen. Um Zeit zu gewinnen, wies er deshalb darauf hin, er müsse dem Kaiser erst berichten, ehe er weitere Zusagen machen könne. Allerdings erübrigte sich seine Vorsichtsmaßnahme; denn von Lychnidus aus, wo er viele Truppen gesammelt hatte, griff der illyrische Heermeister Sabinianus Magnus den gotischen Tross an, den Theodemund befehligte und bei dem sich auch Theoderichs Mutter Erelieva befand. Sie und ihr Sohn konnten den Verfolgern entkommen, indem sie eine Brücke über eine Felsenschlucht hinter sich zum Einsturz brachten. Sie nahmen dabei sogar in Kauf, dass sie ihren eigenen Leuten den Fluchtweg abschnitten und damit den feindlichen Truppen auslieferten. Die Römer nahmen mehr als 5000 Goten gefangen und erbeuteten 2000 Wagen. Mit seinem Erfolg vereitelte Sabinianus Magnus einen Friedensschluss mit dem Amaler. Sowohl er als auch Adamantius, mit dem er in Lychnidus wieder zusammentraf, berichteten Zeno über ihre Begegnungen mit den Goten. In seinem Schreiben sprach sich der Heermeister, der seinen Erfolg stark aufbauschte, gegen ein Übereinkommen mit ihnen aus. Zeno entschied sich dann ganz in dessen Sinne für weitere Angriffe. Allerdings blieb es Adamantius vorbehalten, die Befehle des Kaisers den versammelten Truppen zu verlesen, bevor er sich zurückzog. Sabinianus Magnus befand sich auch insofern in einer günstigen Lage, als er mit der Unterstützung Gentos rechnen konnte, eines Goten, der mit einer Römerin aus Epirus verheiratet war und der über eine eigene Streitmacht verfügte.11
In der Zwischenzeit wandte sich Zeno wieder Theoderich Strabo zu. Dies tat er nicht ganz freiwillig, denn die innenpolitische Lage eskalierte erneut. Der Usurpator Marcianus, den er nach dessen gescheiterter Machtergreifung in Kappadokien inhaftiert hatte, war nämlich aus der Gefangenschaft entflohen und rückte nun mit einer großen Schar aufrührerischer Bauern an. In dieser Lage ging Zeno auf die Forderungen Strabos ein, die dieser bereits nach seinem Treffen mit dem Amaler gestellt hatte. Damals hatte er verlangt, den von ihm mit Leo I. geschlossenen Vertrag einzuhalten, die noch ausstehenden Gelder zu zahlen und seine Verwandten, die sich in römischem Gewahrsam befanden, lebend auszuliefern. Im Frühjahr 480 musste sich der Kaiser kompromissbereit zeigen, um zu verhindern, dass Strabo dem Usurpator Marcianus erneut half, indem er die Hauptstadt von Westen angriff. Der Kaiser bot Strabo Lebensmittel, Sold für 13.000 Mann und den Befehl über zwei Reitertruppen an. Ferner sollte Strabo seinen früheren Besitz zurückerhalten und wieder als Heermeister am Hofe anstelle des Amalers eingesetzt werden. Die Verwandten des thrakischen Gotenfürsten behielt Zeno als Sicherheitsgarantie für sich. Sie erhielten ihren Besitz zurück und hatten in einer vom Kaiser festgelegten Stadt zu leben.12
Der Amaler Theoderich besaß jetzt keinen Bündnispartner mehr, sondern war ganz auf sich allein angewiesen. Allerdings brauchte er in Dyrrhachium keine schwerwiegenden Kämpfe zu befürchten. Bereits im Sommer 480 zerbrach die Allianz zwischen dem Kaiser und Strabo wieder. Der Bruder des Hofministers Illus, Trokundes, der das Heermeisteramt für den Osten bekleidete, schlug den Aufstand in Kleinasien nieder, nahm Marcianus gefangen und brachte ihn nach Isaurien. Damit war Zeno nicht mehr auf die Unterstützung durch Strabo angewiesen, setzte den Gotenfürsten wegen dessen Beteiligung an der Verschwörung von seinem Amt ab und übertrug es Trokundes.13
Strabo nahm sogleich Kontakt zu seinem Namensvetter in Epirus auf, verbündete sich mit dem Amaler und plünderte Städte in Thrakien. Zeno holte daraufhin erstmals die Bulgaren zu Hilfe.14 Strabo konnte diese aber mühelos besiegen und griff jetzt zweimal Konstantinopel an; Illus konnte allerdings die Stadt erfolgreich verteidigen. Ebenfalls scheiterte Strabos Versuch, über den Bosporus nach Bithynien überzusetzen. Er soll damals eine Streitmacht von 30.000 Mann angeführt haben, darunter nicht nur Goten, sondern auch Verbündete. Nach diesen Misserfolgen wandte er sich nach Westen in Richtung Griechenland, wohl um sich mit den Truppen des Amalers in Epirus zusammenzuschließen. Da ereignete sich 481 ein folgenschwerer Unfall. Bei Stabulum Diomedis an der makedonischen Grenze fiel Strabo von seinem Pferd in eine aufrecht stehende Lanze und starb. Seine Nachfolge trat sein Sohn Rekitach zusammen mit den Brüdern seines Vaters an. Er ließ sie jedoch alsbald umbringen, um allein zu herrschen.15
Wesentlich ruhiger war die Lage für die pannonischen Goten, zumal sich deren Verhältnis zu Zeno verbesserte. Von Dyrrhachium aus hatte der Amaler, der fortan wieder Theoderich genannt wird, ebenfalls Raubzüge gegen die Römer geplant. Da Sabinianus Magnus seinen militärischen Erfolg nicht hatte fortsetzen können, blieben die pannonischen Goten relativ ungestört; zudem wurde der römische Feldherr 481 ermordet. Im darauf folgenden Jahr zogen Theoderich und seine Soldaten plündernd durch Makedonien und Thessalien und raubten dort Larissa aus. Zwei Feldherrn, die Zeno mit Truppen gegen sie ausgeschickt hatte, vermochten wenig auszurichten. 483 schloss der Kaiser deshalb wieder ein Bündnis mit dem Gotenkönig und wies dessen Gefolgsleuten Land in den Grenzprovinzen Dacia Ripensis und Moesia II zu, wo sie sich bereits 476 einmal aufgehalten hatten. Höchstwahrscheinlich versprach der Kaiser auch Geldzahlungen. Ihren Befehlshaber ernannte er jedenfalls wieder zum Heermeister am Hofe und nominierte ihn zum Konsul für das Jahr 484. Dies war eine hohe, aber keineswegs neue Auszeichnung für einen Germanen. Vor Theoderich hatten bereits andere Heerführer wie Stilicho und Rikimer den Konsulat inne. Für den Goten dürfte dieses Amt noch eine weitere Bedeutung gehabt haben; spätestens ab diesem Zeitpunkt besaß er das römische Bürgerrecht, sofern er es nicht schon vorher erhalten hatte. Außerdem wurde eine Reiterstatue des Gotenkönigs vor dem Kaiserpalast aufgestellt. Zeno sah sich zu diesen Zugeständnissen veranlasst, weil einer seiner hohen Reichsbeamten, der in dieser Hinsicht hinlänglich erfahrene Illus, seit 481 von Antiochia aus systematisch den Sturz des Herrschers betrieb.16
Gleichzeitig dürfte Zeno mit Rekitach verhandelt haben. Dieser hielt sich 484 jedenfalls in Konstantinopel auf. Rekitach, der möglicherweise durch eine Ehe, die Theoderich Strabo und Theoderich der Amaler bei ihrem Bündnis vereinbart hatten, mit dem Amaler verwandt war, machte trotz solcher familiären Beziehungen aus seiner Abneigung und Eifer sucht gegenüber Theoderich kein Hehl. Eine solche Rivalität zwischen den Gotenfürsten war in der angespannten Situation für Zeno wenig hilfreich. Er gab schließlich seinem Konsul Theoderich als dem Mächtigeren von beiden nach und erlaubte ihm, Rekitach umzubringen. Als der Sohn seines früheren Gegners in Bonophatianae, einem Vorort der Hauptstadt, nach einem Bad zu einem Gastmahl ging, tötete ihn Theoderich eigenhändig mit einem Hieb in die Seite – es sollte nicht seine letzte Bluttat bleiben.
Theoderich gelang nun, was Strabo einst vergeblich am Berg Sondis beabsichtigt hatte: Er zog die Mehrheit der Gefolgschaft seines gotischen Gegenspielers auf seine Seite. Dies fiel ihm trotz seines Verbrechens offensichtlich nicht schwer, da Rekitach durch sein Verhalten, insbesondere durch die Ermordung der Brüder seines Vaters viele seiner Gefolgsleute gegen sich aufgebracht hatte. Überdies fühlten sie sich unter dem Befehl eines Goten sicherer, als wenn sie ganz in römische Dienste getreten wären. Theoderich konnte auf diese Weise seine Anhängerschaft etwa verdoppeln und verfügte über 20.000 Soldaten im Kampf gegen Illus.17 Rückblickend kommt der Vereinigung der beiden wichtigsten gotischen Volksgruppen auf dem Balkan noch eine andere historische Bedeutung zu: Man kann in diesem Ereignis die ‘Geburtsstunde’ des Stammes der Ostgoten sehen. Jedoch handelt es sich hier um einen neuen Stammesverband, der nichts mit denen gemeinsam hat, die vorher diese Bezeichnung trugen. Theoderichs Aufgabe bestand nun darin, diese verschiedenen gotischen Gruppierungen zusammenzuhalten und ihnen eine Identität zu geben. Dies konnte nur durch gemeinsame Aktionen geschehen, was letztlich neue Feldzüge bedeutete.
Theoderich hatte während seines Konsulats eine einzigartige und vor kurzem noch ungeahnte Machtposition erlangt – aber sie war auf Dauer nicht sicher. Dies sollte sich zeigen, als der Krieg gegen Illus ausbrach. Zeno selbst hatte den Konflikt provoziert, indem er die Freilassung seines immer noch gefangen gehaltenen Bruders Longinus forderte und Illus und Trokundes aus ihren Ümtern als Heermeister entließ. Illus rief daraufhin zunächst Marcianus und etwas später Leontius als Gegenkaiser aus.
Die Quellen geben nur ein recht unscharfes Bild über die nun folgenden Ereignisse. Mit dem kaiserlichen Heer marschierten die Goten 484 in Kleinasien ein. Theoderich erregte jedoch bald den Argwohn Zenos. Weil dieser erneut an seiner Loyalität zweifelte, berief er den Gotenkönig bei Nikomedien ab, während dessen Einheiten weiterhin am Feldzug teilnahmen. Stattdessen schickte der Kaiser Rugier unter dem Befehl Ermanarichs, dem Sohn seines früheren Gegenspielers Aspar, und eine Streitmacht über See. Dieser Wechsel wirkte sich keineswegs nachteilig auf seinen Feldzug aus. Noch im Laufe des Jahres musste Illus bei Antiochia eine Niederlage hinnehmen. Er zog sich in die isaurische Festung Papyrion zurück, wo er noch vier Jahre aushalten konnte, ehe die Festung 488 erobert und er enthauptet wurde.18
Seit der Abberufung Theoderichs hatte sich das Verhältnis zu Zeno zusehends verschlechtert. 486 rebellierte der Gotenkönig und zog plündernd durch Thrakien. Vermutlich in diese Zeit fällt auch sein Sieg über die Bulgaren, die bis dahin ungehindert mehrmals über die Donau eingefallen waren. Dabei soll Theoderich den Anführer der Bulgaren im Kampf mit seiner Rechten niedergestreckt haben. Ein Jahr später brach der Gotenkönig erneut von Novae in Niedermösien auf, zog bis nach Rhegium und Melantias, von wo aus er die Vororte Konstantinopels heimsuchte. Um die Bewohner der Hauptstadt unter Druck zu setzen, zerstörte er die Wasserleitung und schnitt sie so teilweise von der Wasserzufuhr ab. Um Schlimmeres zu verhindern und ihn zu beschwichtigen, gab Zeno Theoderich seine Schwester zurück. Bei ihr dürfte es sich um Amalafrida gehandelt haben, die der Gote dem Kaiser bei einer der Verhandlungen, die nach der Okkupation von Dyrrhachium stattfanden, als Geisel gegeben hatte und die seitdem am Hofe der Kaiserin lebte. Ferner erhielt Theoderich einen hohen Geldbetrag. Die Goten kehrten daraufhin wieder nach Novae zurück, aber die Bedrohung für Konstantinopel war damit noch nicht gebannt.19 Da machte Zeno 488 Theoderich ein verlockendes Angebot: Er stellte ihm die Herrschaft über Italien in Aussicht.