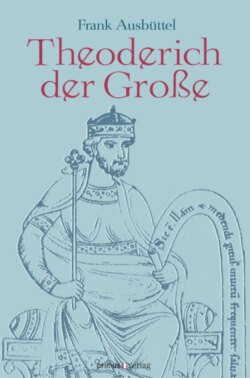Читать книгу Theoderich der Große - Группа авторов - Страница 8
I. Herkunft und Jugend
ОглавлениеAls die Hunnen in das Gebiet des Gotenfürsten Valamer einfielen, empfing er sie mit wenigen Getreuen und streckte in einem langen Kampf so viele von ihnen nieder, dass fast niemand entkam. Sofort schickte er seinem Bruder Theodemer einen Boten mit der freudigen Nachricht; als dieser im Haus Theodemers ankam, erfuhr er eine weitaus glücklichere Nachricht: Gerade an diesem Tag war dessen Sohn Theoderich, ein hoffnungsvolles Knäblein, von Erelieva, einer Konkubine, zur Welt gebracht worden. So lautet der Bericht des Jordanes über die Geburt des späteren Gotenkönigs.1
Theoderich entstammte demnach einer außerehelichen Beziehung, was sich aber auf seinen weiteren Werdegang nicht nachteilig auswirken sollte. Erst der Katholik Jordanes und seine Leser in der Mitte des 6. Jahrhunderts scheinen der ehelichen Geburt eine größere Bedeutung beigemessen zu haben als hundert Jahre zuvor die Goten. Theoderichs Vater Theodemer gehörte der Familie der Amaler an, die ihren Namen von einem legendären König namens Amal ableitete. Über die Gründe, weshalb er Erelieva nicht heiratete, lässt sich nur spekulieren. Ihre Herkunft oder soziale Stellung mögen ebenso wie ihre religiöse Überzeugung eine Rolle gespielt haben. Während die Goten Arianer waren, trat Erelieva später zum katholischen Glauben über und nannte sich nach ihrer Taufe Eusebia. Diese Tatsache und ihre Stellung als Konkubine hatten auf das Verhältnis zu ihrem Sohn jedoch keine negativen Auswirkungen. Vielmehr scheinen sich beide gut verstanden zu haben. Sie begleitete Theoderich Jahrzehnte später auf seinen Feldzügen und genoss in Italien um 496 ein hohes Ansehen als Königin. Ob Theodemer und Erelieva noch andere gemeinsame Kinder hatten, wird nicht erwähnt. Denkbar ist allerdings, dass Theoderichs jüngerer Bruder Theodemund aufgrund seiner engen Beziehung zu Erelieva ebenfalls ihr Sohn war. Die beiden Schwestern Theoderichs, von denen nur Amalafrida namentlich bekannt ist, könnten dagegen aus einer anderen Beziehung Theodemers stammen.2
Das Hauptaugenmerk seines Berichts legt Jordanes indes nicht so sehr auf die familiären Verhältnisse Theoderichs als vielmehr auf die politischen Umstände seiner Geburt. Offensichtlich wollte sie der gotische Historiker, wie in der antiken Geschichtsschreibung durchaus üblich, mit einem bedeutenden Ereignis in Verbindung bringen – der endgültigen Befreiung seines Volkes von der hunnischen Herrschaft durch die Amaler. Allerdings erfolgte diese erst lange nach Theoderichs Geburt; denn wenn man bedenkt, dass Theoderich mit 18 Jahren den Thron bestieg und im Jahr 500 in Rom sein dreißigstes Regierungsjubiläum feierte, dürfte er um 453 zur Welt gekommen sein.3 Zu diesem Zeitpunkt standen die von den Amalern geführten Goten aber noch unter dem Einfluss der Hunnen.
Die Amaler versuchten später während Theoderichs Regierung über Italien den Eindruck zu vermitteln, dass alle Goten nördlich der Donau einst unter ihrer Herrschaft gestanden hätten. Als Beleg hierfür legten sie einen Stammbaum vor, der eine weit zurückreichende Kontinuität suggeriert. In ihm werden vierzehn Vorfahren Theoderichs aufgeführt und seine angebliche Verwandtschaft zu dem mächtigen Gotenkönig Ermanarich nachgewiesen, der vor dem Einbruch der Hunnen 375 von der Ukraine aus ein gewaltiges Reich beherrscht hatte.4 Die Angaben in dem Stammbaum sind allerdings chronologisch ungenau sowie widersprüchlich und liefern nur wenige konkrete Anhaltspunkte. Als sicher kann gelten, dass die von den Amalern geführte Gruppe nur einer von mehreren gotischen Stämmen war. Wie die meisten gerieten sie seit 440 unter die Herrschaft der Hunnen Attilas; diese dürften ihnen daraufhin Land in Pannonien zugewiesen haben.5 Dort erstreckte sich ihr Stammesgebiet vom Südwesten des Plattensees bis zur Drau. In diesem Gebiet und damit auf römischem Boden wird auch Theoderich zur Welt gekommen sein.
Die Kontrolle über die pannonischen Goten teilten damals drei Amaler unter sich auf: Theoderichs Vater Theodemer und seine beiden Brüder Vidimer und Valamer; dabei fiel Letzterem die Führung zu. Er be saß das besondere Vertrauen Attilas und half dem Hunnenkönig, als dieser 447 die Donauprovinzen plünderte. Mit seinen beiden Brüdern zog Valamer anschließend im Gefolge Attilas nach Gallien und kämpfte dort 451 auf den Katalaunischen Feldern. Dessen Niederlage und seinen Tod 453 nutzten viele Völker aus, um sich in gemeinsamer Anstrengung von der hunnischen Herrschaft zu befreien. Unter Führung der Gepiden errangen sie 453/454 am Nedao, vermutlich einem Nebenfluss der Save, einen Sieg über die Söhne Attilas. Die pannonischen Goten standen damals wahrscheinlich noch auf der Seite der Hunnen, profitierten aber gleichfalls von deren Niederlage. Als jene sie erneut unterwerfen wollten, gelang Valamer der erwähnte historische Sieg, den Jordanes mit der Geburt seines Neffen Theoderich in Verbindung brachte. Valamer arrangierte sich daraufhin mit den Römern und ließ sich vom oströmischen Kaiser Marcian noch vor 457 die Ansiedlung in Pannonien bestätigen. Als die Goten Illyrien plünderten, schloss Leo I. (Abb.1) um 461 mit Valamer erneut einen Vertrag. Darin sicherte er den Goten die jährliche Zahlung von 300 Pfund Gold zu – eine für den Kaiser vergleichsweise kleine Summe, wenn man bedenkt, dass die Kosten für die römische Armee mindestens das Hundertfache, wenn nicht das Zwei hundertfache betrugen. Ob die Goten dafür irgendwelche militärischen Dienste gegen barbarische Stämme zu leisten hatten, wird nicht erwähnt, ist aber anzunehmen. Damit sie die Vereinbarungen einhielten, musste Valamers Neffe Theoderich als Geisel nach Konstantinopel gehen, wo er immerhin zehn Jahre bleiben sollte.6
Abb. 1: Münzbild des oströmischen Kaisers Leo I. (457–474).
Die Geiselhaft bedeutete für den erst achtjährigen Goten eine große persönliche Umstellung. Fern von seiner Familie wurde er nun mit einer Kultur konfrontiert, die ihm fremd war, ihn aber letztlich entscheidend prägen sollte; denn Konstantinopel muss ihm, der bislang nur dörfliche Siedlungen seines Stammes und römische Provinzstädte kannte, tief beeindruckt haben. Seit Constantin hatten die Kaiser diese Stadt zu einem zweiten Rom ausgebaut; gewaltige Befestigungsanlagen schützten sie vor feindlichen Angriffen. Allein die Seemauern hatten 188 Türme. Um 425 verfügte Konstantinopel über fünf Paläste, vierzehn Kirchen, acht Thermen, zwei Basiliken, jeweils zwei Theater und Amphitheater, vier Häfen und 4863 Häuser unterschiedlicher Art. Kurz vor Theoderichs Ankunft war mit dem Augusteum ein neues Forum errichtet worden. Mit seinen zahlreichen Kunstwerken, die unter anderem aus Delphi und Olympia herbeigeschafft worden waren, wirkte die Hauptstadt wie ein großes Museum.
Durch die Gunst des Kaisers erhielt Theoderich in Konstantinopel eine umfassende Ausbildung bei den besten Lehrern seiner Zeit. Immerhin besaß die Stadt die größte Hochschule im Osten des Reiches. Hier dürfte sich der junge Gote ausführlich mit den Freien Künsten – Grammatik, Dialektik, Rhetorik, Geometrie, Arithmetik, Astronomie und Musik – befasst haben. In seinen Briefen an den Philosophen Boëthius bemerkte er später einmal, dass er sich mit gebildeten Menschen gerne über die Geheimnisse der Mathematik unterhalte sowie über Kunst und Musik spreche. Auch wenn die zehn Jahre, die Theoderich in der kaiserlichen Residenzstadt verbrachte, wohl nicht ausgereicht haben, um seine Ausbildung abzuschließen, so war er doch in der Lage, sich zwanglos unter vornehmen Römern bewegen und Kontakte zu Gelehrten wie Cassiodor und Ennodius halten zu können. Äußerungen, die ihn als ungebildet und als Analphabeten abstempeln, sind daher als politische Propaganda zu bewerten. Vielleicht sind sie darauf zurückzuführen, dass Theoderich eher mit der griechischen als mit der lateinischen Schrift und Kultur vertraut war; denn in seiner Lobrede auf den Gotenkönig erklärte Ennodius: Es erzog dich Griechenland im Schoß der Zivilisation, vorausahnend, was da herankäme.7
Nicht minder wichtig für seine späteren Entscheidungen war für den jungen Amaler, dass er während seiner Geiselhaft das römische Herrschaftssystem und die Machtverhältnisse am Hofe näher kennen lernte. Gegenüber dem Kaiser Anastasius I. äußerte er einmal recht diplomatisch und zurückhaltend, dass er in seinem Staat mit göttlicher Hilfe gelernt habe, wie man gerecht über die Römer herrschen könne.8 Für einen jungen Barbaren wie Theoderich musste der Kaiser, der mit großem Pomp in der Öffentlichkeit auftrat und dem man sich nur nach festen Regeln nähern durfte, als eine allmächtige und übermenschliche Person erscheinen. In Konstantinopel dürfte er indes alsbald erkannt haben, dass er so mächtig gar nicht war, Barbaren in seiner Umgebung über großen Einfluss verfügten und Intrigen sowie Machtkämpfe das Leben am Hofe bestimmten. Mit Leo I. stand damals ein Thraker aus dem Volk der Bessen an der Spitze des Reiches. Seine Herrschaft hatte er dem Heermeister Aspar, einem Alanen, zu verdanken. Dieser hatte 457 nicht An themius, den Schwiegersohn des gerade verstorbenen Kaisers Marcian, sondern mit Leo I. den Tribunen einer Garnison am Marmarameer favorisiert. Gerade die Person und die Vorgehensweise Aspars haben Theoderich sehr beeindruckt und beschäftigt. Noch im Jahre 502 erinnerte er sich an einen Ausspruch des einstigen Heermeisters. Als nämlich der Senat von Konstantinopel Aspar aufforderte, sich selbst zum Kaiser auszurufen, soll dieser geantwortet haben, er befürchte, durch ihn reiße diese Gewohnheit in der Herrschaft ein.9 Er wollte damit wohl zum Ausdruck bringen, dass er lieber selber den Kaiser bestimmen als dessen Amt übernehmen wolle. Zu dieser Überlegung dürften ihn sein arianischer Glauben und seine germanische Herkunft gebracht haben.
Noch während seiner Zeit als Geisel erlebte Theoderich, wie sich der Machtkampf zwischen Leo I. und Aspar zuspitzte. Im Laufe seiner Regierungszeit war der Kaiser stets bestrebt gewesen, den Einfluss des Heermeisters zu mindern und dessen Konkurrenten zu stärken. Mit Leos I. Unterstützung war 467 Anthemius, der 461 noch gegen die pannonischen Goten gekämpft hatte, zum Kaiser des Westreiches aufgestiegen. Ferner konnte sich der Kaiser seit 466 auf einen gewissen Tarasicodissa verlassen. Dieser war als Anführer isaurischer Krieger aus Kleinasien nach Konstantinopel gekommen und nannte sich nach einem Landsmann, der 447 die Hauptstadt erfolgreich verteidigt hatte, Zeno. Er brachte Aspars Sohn, den Heermeister Ardabur, zu Fall, indem er ihn wegen seiner Kontakte zu den Persern des Hochverrats bezichtigte. Leo I. ernannte Zeno daraufhin zum Befehlshaber seiner Leibgarde und gab ihm seine älteste Tochter Ariadne zur Frau. Aspar besaß allerdings großen Rückhalt bei den nicht unweit der Hauptstadt in Thrakien lebenden Goten, auf deren Truppen er sich verlassen konnte, zumal er durch seine dritte Ehefrau mit einem ihrer Befehlshaber verwandtschaftlich verbunden war.10 Um sich weiterhin die Loyalität seines Heermeisters zu sichern, verlieh Leo I. 470 dessen Sohn Patricius den Titel eines Caesar und vermählte ihn mit seiner Tochter Leontia. Der Machtkampf spitzte sich 471 zu, als Ardabur einen Aufstand anzuzetteln versuchte. Leo I. lud daraufhin ihn und dessen Vater in seinen Palast ein und ließ sie umbringen – eine Tat, die ihm den Beinamen „der Schlächter“ einbrachte. Aspars Gefolgschaft konnte noch dessen Ehefrau aus dem Palast befreien und setzte sich nach Thrakien zu Theoderich Strabo ab, der nun die Nachfolge des einst so mächtigen Heermeisters für sich beanspruchte.
Am kaiserlichen Hof konnte Theoderich ferner die Erfahrung machen, wie schwer sich die Römer in ihren Auseinandersetzungen mit barbarischen Völkern taten. Ein besonders lehrreiches Beispiel hierfür boten die Vandalen: Durch Verhandlungen mit ihrem König Geiserich war es Leo I. gelungen, die ehemalige Kaiserin Eudoxia mit ihren Töchtern zu befreien, nachdem eine von ihnen Geiserichs Sohn Hunerich geheiratet hatte. Weil die Vandalen mit ihren Raubzügen dennoch nicht aufhörten, plante Leo I. mit seinem Kollegen im Westen einen Großangriff auf ihr Reich. Den Oberbefehl über die oströmischen Streitkräfte übergab er seinem Schwager Basiliscus. Dessen Flotte vernichtete Geiserich nach einem kurzfristigen Waffenstillstand, und der Feldzug endete mit einem Desaster.
Angesichts dieser Niederlage dürfte bei Theoderich die Erkenntnis gereift sein, dass die Römer den barbarischen Völkern auf dem Balkan nicht grundsätzlich überlegen waren. Vielmehr rieben sich diese selbst durch ihre ständigen Kämpfe untereinander auf, was auch für sein eigenes Volk zutraf, das mehrere Kriege gegen Hunnen, Sarmaten und Germanen zu führen hatte. Allerdings konnten in der Zeit der Geiselhaft Theoderichs die pannonischen Goten ihre Macht stetig ausdehnen und feindliche Nachbarvölker in Schach halten. Nach dem Friedensschluss mit Leo I. zeigten sie sich recht angriffslustig und überfielen die sarmatischen Sadagen im Innern Pannoniens. Als während dieses Feldzuges Attilas Sohn Dengizich nahe Sirmium die Stadt Basiana belagerte, kehrten die Goten um und vertrieben die Hunnen; möglicherweise handelten sie dabei im Auftrag des Kaisers.
Auf einem ihrer Beutezüge von Nordpannonien nach Dalmatien passierten in dieser Zeit die Sueven das Gebiet der Goten und raubten deren Viehherden. Als sie sich zurückzogen, griff Theodemer sie unerwartet am Plattensee an und brachte ihnen eine schwere Niederlage bei. Allerdings war er daran interessiert, sie als Verbündete zu gewinnen, und adoptierte deshalb ihren König Hunimund, der ihm in die Hände gefallen war; danach durfte er in seine Heimat zurückkehren. Hunimund, der nicht von den Goten abhängig sein wollte, wiegelte indes die auf der anderen Seite der Donau wohnenden Skiren gegen die mit ihnen verbündeten Goten auf. Diese wurden zwar von deren Angriff überrascht, konnten aber um 465 in einer Schlacht die Skiren vernichtend schlagen. Jedoch verloren die Goten dabei ihren König Valamer. Seine Nachfolge trat Theodemer an, zu dem die Anhänger seines Bruders geflohen waren.
Die Suevenkönige Hunimund und Alarich schlossen daraufhin mit Sarmaten, Gepiden, Rugiern und den restlichen Skiren ein Bündnis und rückten gegen die Goten vor. Beide Seiten wandten sich damals an Konstantinopel. Während dort der Heermeister Aspar riet, sich aus dem Konflikt herauszuhalten, gab Leo I. an seine illyrischen Truppen den Befehl, die Skiren, die Feinde der Goten, zu unterstützen. Noch bevor die römischen Truppen eingreifen konnten, fiel an der Bolia, einem Fluss in Pannonien, die Entscheidung zu Gunsten der Goten. Im darauf folgenden Winter überquerte Theodemer die zugefrorene Donau und verwüstete das Land der Sueven. Ferner hielten die Goten die Rugier in Schach und hinderten 468 deren König daran, aus dem Gebiet von Ufernoricum nach Italien abzuziehen. Vier Jahre später stießen gotische Truppen in Binnennoricum bis in das Gebiet der oberen Drau vor und belagerten dort die Provinzmetropole Teurnia. Zwar konnten sie die Stadt nicht einnehmen, zwangen aber deren Bewohner, Abgaben an sie zu leisten. Darunter befanden sich zahlreiche Kleidungsstücke, welche die Bürger von Teurnia auf Geheiß des heiligen Severin für die Armen des Landes gesammelt hatten.11
Diese Ereignisse fallen in die Zeit, in der Theoderich aus Konstantinopel zurückkehrte. Nach Aspars Ermordung 471 entließ Leo I. ihn aus der Geiselhaft, nicht ohne ihn reich zu beschenken. Offensichtlich wollte er mit dieser großzügigen Geste die Gunst der Goten Theodemers gewinnen, die von ihm zuletzt nicht gerade freundlich behandelt worden waren und nach ihren Erfolgen über die Sueven und Rugier deutlich an Macht gewonnen hatten.
Die Zeit seiner Rückkehr fällt genau in das Jahr, das Theoderich später als Beginn seiner Königsherrschaft propagieren sollte. Man könnte vermuten, dass Theodemer ihn zum Mitregenten erhob und ihm jenes Gebiet überließ, das einst Valamer gehörte. Theodemer hätte damit sogleich wieder einen Teil seiner Macht an seinen Sohn abgetreten, obwohl dieser mit den Verhältnissen in seinem Reich noch nicht so recht vertraut war. Dies alles ist eher unwahrscheinlich. Vielmehr bezog Theoderich den Beginn seiner Regierungszeit auf ein Ereignis, über das Jordanes wie folgt berichtet:
Dieser Theoderich, der schon in das Jünglingsalter kam und die Kindheit hinter sich gelassen hatte – er war 18 Jahre alt –, holte sich zuverlässige Gefährten seines Vaters und scharte Anhänger aus dem Volk und Gefolgsleute um sich, fast 6000 Mann, mit denen er ohne Wissen seines Vaters über die Donau setzte und Babai, den König der Sarmaten, überfiel, der damals über Camundus, den Heerführer der Römer, einen Sieg errungen hatte und von Hochmut aufgebläht herrschte. Theoderich überfiel ihn, tötete ihn, raubte seine Familie und sein Vermögen und kehrte mit dem Sieg zu seinem Vater zurück. Sodann drang er in die Stadt Singidunum ein, welche die Sarmaten selbst besetzt hatten; er gab sie nicht den Römern zurück, sondern unterwarf sie seiner Gewalt.12 Theoderich hatte demnach den Herrschaftsbereich der Goten ausgedehnt und ein Gebiet erobert, das er aufgrund seines Erfolges ohne weiteres für sich beanspruchen konnte.
Bald darauf war er aber wie sein Vater ein König ohne Land; denn bereits 473 verließen die Goten ihre pannonischen Gebiete, obwohl sie auf ihren Feldzügen so erfolgreich gewesen waren. Immer mehr fehlte es ihnen an Lebensmitteln und Kleidung, nicht zuletzt weil ihre Beute aus den Feldzügen gegen benachbarte Völker – auch nach dem Einfall in Noricum – weiter abnahm. Viele Goten drängten daher Theodemer, das Land zu verlassen. Hinzu dürften Rivalitäten zwischen den beiden Amalern Vidimer und Theodemer gekommen sein. In dieser Lage entschied das Los, dass Vidimer mit seinem Gefolge nach Italien ziehen sollte, wo er kurz darauf starb. Sein gleichnamiger Sohn folgte ihm dort in der Herrschaft, hielt sich aber nicht lange in Italien auf. Der weströmische Kaiser Glycerius schickte ihn 473/474 nach Gallien, wo sich seine Gefolgschaft mit den Westgoten vereinigte. Theodemer war nun, nachdem sein Bruder die Gegend verlassen hatte, das alleinige Oberhaupt der pannonischen Goten. Mit ihm und Theoderich zogen sie weiter nach Illyricum – in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft.