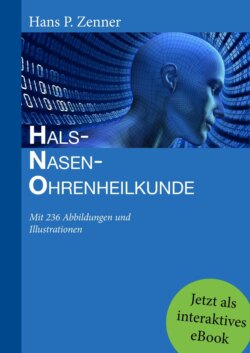Читать книгу Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde - Группа авторов - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2 Ohrmuschel und Gehörgang
R. Probst
Die Ohrmuschel und der knorpelige Anteil des äußeren Gehörgangs bilden anatomisch und in vielen pathologischen Belangen eine Einheit. Affektionen der Ohrmuschel greifen deshalb oft auf den Gehörgang über und umgekehrt.
Als anatomische Besonderheit mit Auswirkungen auf das pathologische Geschehen ist eine innige Verbindung zwischen dem Perichondrium des elastischen Knorpels und der lateralen Dermis der Ohrmuschel zu nennen. Bei Hautveränderungen und Schwellungen sind deshalb oft das Perichondrium und der Knorpel mitbetroffen, was zu starken Schmerzen, schlechter Resorption und Knorpeldestruktionen mit bleibenden Formveränderungen führen kann.
Die Haut des knöchernen Gehörgangs (mediales Drittel) ist sehr dünn und direkt mit dem Periost verbunden. Auch dieser anatomische Befund kann zu besonderen pathogenetischen Verläufen von Gehörgangsaffektionen führen.
2.1 Entzündungen
2.1.1 Ohrmuschel
2.1.1.1 Ekzem und Dermatitis
Definition: Entzündliche Hautveränderungen der Ohrmuschel ohne klinische Beteiligung des Knorpels.
Ätiologie: immunologisch-allergische, toxische oder physikalische Ursachen. Häufig verantwortlich sind Schmuckgegenstände (Ohrringe).
Kosmetika und Pflegemittel (Seifen, Shampoo, Haarspray).
Hörhilfen (Hörgeräte, Ohrpaßstücke, Einsteckhörer).
Wärme- bzw. Kälteschäden (Sonne, Radiotherapie, Erfrierung – s. Abschn. 2.2.1.3).
Klinik: auf die Dermis beschränkte rötliche und schuppende entzündliche Veränderung, die den Knorpel und das Perichondrium nicht einschließt (Konturen nicht verstrichen). Sie kann auf eine Region beschränkt sein wie das Ohrläppchen (bei Schmuck) oder retroaurikulär (Hörgerät), wenig Schmerzen, Juckreiz.
Diagnostik: Inspektion und anamnestische Eruierung exogener Ursachen. Eine allergologische Abklärung kann angezeigt sein.
Differentialdiagnose: Abgrenzung gegenüber Pyodermie, Perichondritis, Erysipel,. Hautmykose und Dermatosen wie Psoriasis.
Therapie: Ausschalten der Ursache und Therapie nach dermatologischen Prinzipien. Antibiotika sind nur bei bakteriellem Superinfekt indiziert.
2.1.1.2 Perichondritis
Definition: entzündliche Veränderung der Ohrmuschel, die sowohl die Haut als auch das Perichondrium und damit auch den Knorpel selbst beteiligt.
Ätiologie: häufig liegt ein bakterieller Infekt vor, v.a. durch Staphylokokken und Pseudomonas; selten auch allergisch-toxische oder autoimmune Ursachen.
Pathogenese: Oft handelt es sich um einen Infekt, der von einer kleinen Verletzung im Konchabereich ausgeht. Eine bakterielle Infektion der lateralen Ohrmuschel ist fast regelmäßig mit einer Perichondritis verbunden (wegen der engen Verbindung zwischen Haut und Perichondrium).
Klinik: sich schnell entwickelnde starke Schmerzen und Wärmegefühl.
Diagnostik:
Inspektion und (vorsichtige!) Palpation: Es finden sich verstrichene Ohrmuschelkonturen (Abb. 2-1), häufig eine Schwellung im Konchabereich und eine ausgeprägte Druckdolenz. Blasenbildungen der Haut sind möglich. Das Ohrläppchen ist symptomfrei (weil es keinen Knorpel hat).
Otoskopie: begleitende Otitis extema (s. 2.1.2) ist möglich, Trommelfellbefund und Gehör sind i. allg. normal.
Regionäre Lymphknoten sind vergrößert und dolent.
Abb. 2-1. Perichondritis der rechten Ohrmuschel: Man erkennt eine starke Rötung und Schwellung der Ohrmuschelhaut mit verstrichenen Konturen
Allgemeinsymptome: Fieber, Leukozytose und andere Entzündungszeichen.
Abstrich mit bakterieller Bestimmung und Resistenzprüfung (da Problemkeime möglich).
Komplikationen: Destruktion des Knorpels mit bleibender Formveränderung (Ringerohr).
Differentialdiagnose:
Rezidivierende Polychondritis (relapsing polychondritis): Autoimmunkrankheit mit Knorpelzerstörung der Ohrmuschel, der Bronchialknorpel, der Nasenscheidewand und im Kehlkopfbereich.
Ekzem und Dermatitis.
Andere Infekte wie Erysipel (Ohrläppchen miterfaßt) oder Zoster oticus.
Physikalische Schäden (Verbrennungen, Erfrierung, Trauma).
Durchbrechende Mastoiditis.
Gichttophi: schmerzhafter Knoten am Helixrand.
Therapie: Systemische Verabreichung von Antibiotika, die gegen Staphylokokken wirksam sind, ggf. Umstellen nach Erhalten des Antibiogramms. Nach sorgfältiger Reinigung der Ohrmuschel und des Gehörgangs wird eine desinfizierende oder Antibiotikasalbe lokal aufgetragen.
Nichtsteroidale Antirheumatika werden als Schmerzmittel eingesetzt.
2.1.1.3 Erysipel
Definition: Streptokokkeninfekt der Ohrmuschelhaut, der hauptsächlich die Subkutis betrifft. Charakteristisch sind eine starke, über die Ohrmuschel reichende Rötung, ausgeprägte Allgemeinsymptome und ein rasches Fortschreiten der unbehandelten Krankheit.
Ätiologie: Streptokokken, deren Eintrittspforte meist kleine Verletzungen, häufig im Konchabereich gelegen, sind.
Klinik: allgemeines Krankheitsgefühl, Schmerzen in der Ohrregion und Fieber.
Diagnostik: Das klinische Erscheinungsbild ist typisch. Es bestehen Rötung, Schwellung und Überwärmung der Ohrmuschel, des Ohrläppchens und der periaurikulären Gebiete, v.a. in Richtung Gesicht. Eine Inspektion und Reinigung des Gehörgangs mit Erhebung des Trommelfellbefunds ist zum Ausschluß einer Mittelohraffektion notwendig. Abstriche und, falls möglich, ein Antibiogramm sollten angefertigt werden.
Komplikationen: nekrotisierende Fasziitis (schwerer, kaum beherrschbarer Infekt der Subkutis, häufig durch Anaerobier mitbedingt), rheumatische Erkrankungen bei Infektion mit Streptokokken der Gruppe A (Glomerulonephritis, rheumatisches Fieber, Endocarditis rheumatica).
Differentialdiagnose:
Perichondritis: umgebende Weichteile und Ohrläppchen i.a. nicht betroffen.
Zoster oticus: Beteiligung des Innenohrs und des N. facialis.
Ekzem und Dermatitis.
Therapie: Hochdosierte, systemische Gabe von Antibiotika, die gegen Streptokokken wirksam sind (Penicillin G), sowie nichtsteroidale Antirheumatika als Schmerzmittel.
2.1.2 Gehörgang
2.1.2.1 Otitis externa circumscripta
(Synonym: Gehörgangsfurunkel)
Definition: Umschriebener, bakterieller Infekt im knorpeligen Bereich des Gehörgangs. Es handelt sich meist um einen Staphylokokkeninfekt der Haarbälge oder der Zeruminaldrüsen.
Pathogenese: Dieser Infekt entsteht oft im Zusammenhang mit lokaler Beanspruchung und Verschmutzung des Gehörgangs (z.B. durch Einsteckhörer, staubige Umgebung, Badewasser, Selbstreinigungsversuche).
Klinik: Es bestehen starke Schmerzen, leichte Schwerhörigkeit, im allgemeinen kein Fieber. Wenig Ohrfluß ist möglich.
Diagnostik:
Inspektion und Palpation: Tragusdruckschmerz und umschriebene, stark dolente Schwellung des knorpeligen Anteils des Gehörgangs.
Falls zentrale Einschmelzung vorhanden: vorsichtige Eröffnung, um einen bakteriologischen Abstrich zu gewinnen.
Otoskopischer Befund: starke Gehörgangsschwellung, Detritus; das Trommelfell ist meist nicht sichtbar, aber normal. Bei komplettem Verschluß des Gehörgangs ist Schalleitungsschwerhörigkeit möglich.
Untersuchung auf systemische Prädispositionen wie Diabetes mellitus.
Komplikationen: Entwicklung eines Gehörgangsabszesses mit Beteiligung der umgebenden Weichteile, vor allem infraaurikulär und präaurikulär. Bei Übergreifen auf die Ohrmuschel Perichondritis. Otitis externa necroticans (s. Abschn. 2.1.2.3).
Differentialdiagnose: Fremdkörper im Gehörgang, begleitende Otitis externa bei Otitis media acuta oder chronica; retroaurikuläres, infiziertes Atherom, Gehörgangstumoren.
Therapie: Vorsichtige Gehörgangsreinigung. Lokale Behandlung mit 70%igem Alkohol auf Gazestreifen oder selbstexpandierendem Schwamm. Nach Abschwellung Antibiotika und steroidhaltige Ohrentropfen. Nichtsteroidale Antirheumatika als Schmerzmittel. Inzision eines Abszesses.
Systematische Antibiotika bei Allgemeinsymptomen und starken lokalen Infektionszeichen.
Prognose: Besonders beim Vorliegen eines Diabetes mellitus sind schwere Verläufe möglich.
2.1.2.2 Otitis externa diffusa und Gehörgangsekzem
Definition: akuter, bakterieller Infekt der Gehörgangshaut, gelegentlich auch des Trommelfells (Myringitis); häufig auf dem Boden einer ekzematösen Veränderung der Gehörgangshaut (Gehörgangsekzem) entstehend.
Ätiologie: Das Gehörgangsekzem ist eine Folge mechanischer, toxischer oder allergischer Schädigung. Darauf entsteht die Otitis externa häufig als Mischinfekt, der gramnegative Keime (Pseudomonas) und Anaerobier (fötides Sekret) enthält. Primär oder sekundär können mykogene Infekte entstehen (Gehörgangsmykose).
Pathogenese: Durch das Zeruminalsekret (saurer pH-Wert, antibakterieller Fettsäurengehalt) und durch die physiologische Migration des Gehörgangsepithels nach außen weist der normale Gehörgang wirksame Schutzfaktoren gegen Infektionen auf. Eine Störung dieses Schutzes kann zur Infektion führen. Sie kommt zustand durch:
exogene Faktoren (Mazeration der Haut durch Wasser, pH-Erhöhung durch Seife/ Shampoo, mechanische „Selbstreinigung", Einsteckhörer).
endogene Faktoren (Ekzemneigung, Allergien, Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes mellitus).
lokale Verhältnisse (Exostosen, Stenosen, anatomische Varianten).
Klinik: Es besteht vorweigend Juckreiz. Krustenbildung und Ohrfluß sind möglich.
Diagnostik: Das Gehörgangsekzem zeigt eine trockene, schuppende Haut mit Neigung zu Schrundenbildung. Bei Infektion kommt es zu diffuser Schwellung der Gehörgangshaut, Sekretion oder Krustenbildung.
Komplikationen: Otitis externa necroticans. Perichondritis und Erysipel.
Differentialdiagnose: Begleitende Otitis externa bei Otitis media acuta oder chronica mit Ohrfluß. Otitis externa necroticans.
Therapie: Gehörgangsreinigung. Steroid- und antibiotikahaltige Ohrtropfen (außer bei Mykose, Antibiotikaüberempfindlichkeit und Trommelfellperforation!). Vernünftige Ohr-hygiene.
2.1.2.3 Otitis externa necroticans
(Älteres Synonym: Otitis externa maligna)
Definition: Durch Pseudomonas aeruginosa bedingte gefährliche Otitis externa, die zu einer Ostitis und Destruktion des umgebenden Gewebes führt; häufig bei älteren Personen mit Diabetes mellitus.
Ätiologie: Pseudomonas aeruginosa.
Pathogenese: Meist von einer banalen Otitis externa ausgehend, entwickelt sich ein Ulkus mit Ostitis am Boden des Gehörgangs. Die Knocheninfektion kann auf das Mittelohr, die Schädelbasis, die Fossa retromandibularis und die Parotisloge übergreifen.
Klinik: Zunächst mäßige Schmerzen können in sehr starke Schmerzen übergehen.
Diagnostik:
Anamnestisch schleichende Otitis externa mit fehlender Heilungstendenz.
Die Inspektion kann Infektionszeichen der Umgebung ergeben, die Otoskopie zeigt fast immer ein Ulkus des Gehörgangbodens mit freiliegendem, bräunlichem Knochen; fötides Sekret.
Abstriche und Resistenzprüfung: Pseudomonas aeruginosa.
Knochenszintigraphie und Computertomogramm zur Dokumentation der Infektionsausdehnung und der Knochendestruktion.
Abklärung auf Diabetes mellitus und Immundefekte.
Biopsie zum Ausschluß eines Tumors.
Komplikationen: Mittelohrinfekt und Mastoiditis, Petrositis, Weichteilabzesse. Hirnnervenausfälle, vor allem N. facialis; Sinusthrombose, Sepsis, Meningitis.
Differentialdiagnose: Gehörgangstumoren, chronische Otitis media mit Komplikationen.
Therapie: Bei geringer Knochenbeteiligung erfolgt zunächst eine gegen Pseudomonas aeruginosa wirksame, höchstdosierte antibiotische Behandlung über 6 Wochen, evtl. Kontrolle und Einstellung eines Diabetes mellitus. Bei ungenügendem Ansprechen der konservativen Therapie, bei ausgedehnten Befunden und bei Komplikationen ist eine operative Knochenresektion angezeigt, die bis zur Petrosektomie reichen kann.
Prognose: Bei Fazialisparese oder Sinusthrombose liegt die Überlebenswahrscheinlichkeit bei lediglich ca. 50%.
2.1.2.4 Otitis externa bullosa
(Synonym: Grippeotitis)
Definition: Blutblasenbildender (viraler) Infekt der Gehörgangshaut im medialen Bereich und des Trommelfells, der mit starken Schmerzen verbunden ist.
Ätiologie: Es werden virale Infekte vermutet, Influenzavirus wurde vereinzelt nachgewiesen; toxische Kapillarschädigung.
Klinik: Plötzlich einsetzender, heftiger Schmerz. Blutige Sekretion aus dem Ohr ist möglich.
Diagnostik:
Otoskopie: seröse bis blutige Blasenbildung des Epithels im knöchernen Gehörgangsbereich und des Trommelfells, frische Blutungen beim Platzen der Blasen, später Krustenbildung.
Gehörprüfungen: normal oder Schalleitungsschwerhörigkeit, bei Innenohrbeteiligung Schallempfindungsschwerhörigkeit.
Komplikationen: Beteiligung des Mittelohrs und/oder des Innenohrs. Diese kann mit Empfindungsschwerhörigkeit und Schwindel verbunden sein. Aufstieg der Infektion entlang dem Nervus statoacusticus mit evtl. nachfolgender lebensgefährlicher Hirnstammenzephalitis (selten).
Differentialdiagnose: Gehörgangstumoren, Herpes zoster oticus, toxische oder traumatische Schädigung (Barotrauma).
Therapie: Eine spezifische antivirale Therapie fehlt. Man verabreicht lokalanästhesierende Ohrentropfen, nichtsteroidale Antirheumatika als Schmerzmittel sowie systemische Antibiotika bei V.a. bakterieller Mitbeteiligung des Mittel- und Innenohrs.
2.1.2.5 Herpes zoster oticus
(Synonym: Ramsay-Hunt-Syndrom)
Definition: Infektion der Hirnnerven VII und/oder VIII (gelegentlich auch IX und X) mit dem Herpes zoster-Virus. Es bestehen Ohrenschmerzen, Effloreszenen in der Gehörgangsregion, Funktionsausfälle der Hirnnerven VII und/oder VIII sowie regionäre Lymphknotenschwellungen.
Ätiologie: Infektion mit Herpes-zoster-Virus (Varizellenvirus).
Klinik: Ohrenschmerzen auf einer Seite, Hörverlust, vestibuläre Beschwerden, Fazialisparese.
Diagnostik: Typisch gruppierte (herpetiforme) Bläschen im Bereich des Gehörgangs und der Koncha, gelegentlich auch palatinal (Abb. 2-2).
Begleitende Lymphadenitis der hohen zervikalen Lymphknoten.
Die Diagnose läßt sich meist anhand des klinischen Befunds vermuten und kann durch direkten elektronenoptischen Virusnachweis aus Bläscheninhalt oder später serologisch gesichert werden (vierfacher Titeranstieg).
Abb. 2-2. Herpes zoster oticus rechts: Es lassen sich typisch gruppierte Bläschen erkennen
Klinische Zeichen von Läsionen der Hirnnerven VII und VIII: Fazialisparese, Schallempfindungsschwerhörigkeit, Nystagmus, einseitige Untererregbarkeit des Vestibularorgans.
Komplikationen: Sekundäre bakterielle Infektion, v.a. durch Staphylokokken und Pseudomonas. Persistierende Funktionsausfälle der Hirnnerven VII und VIII. Postzosterneuralgien. Zostermeningoenzephalitis.
Differentialdiagnose: Hörsturz, Otitis media, Otitis externa bullosa, Mastoiditis, Labyrinthitis. Fazialisparese anderer Ursachen.
Therapie: Bereits bei klinischem Verdacht wird eine adäquate Therapie mit Aciclovir eingeleitet.
2.1.2.6 Gehörgangsmykose
(Synonym: Otomykose)
Definition: Mykotische Infektion der Gehörgangshaut und des Trommelfellepithels, die primär oder sekundär nach bakterieller Otitis externa entstehen kann. Oft hartnäckiger Verlauf.
Ätiologie: Pilzinfektion (Aspergillus, Candida albicans, Mucor, Dermatophyten). Die Infektion wird durch ein verändertes Gehörgangsmilieu und durch den Gebrauch von steroid- und antibiotikahaltigen Ohrentropfen begünstigt.
Klinik: Die Pilzinfektion äußert sich weniger in Schmerzen als vielmehr in starkem Juckreiz und Völlegefühl im Ohr.
Diagnostik: Otoskopisch sind oft Pilzrasen oder Beläge von unterschiedlicher Farbe (weiß, gelb bis schwarz) zu erkennen; Myzel im Direktpräparat. Mikrobiologischer Nachweis und Bestimmung des Erregers.
Komplikationen: Trommelfellperforation und Otitis media.
Differentialdiagnose: andere Formen der Otitis externa.
Therapie: Nach sorgfältiger Reinigung/Trocknung des Gehörgangs erfolgt die Anwendung lokaler Antimykotika. Der Verlauf ist oft hartnäckig und rezidivierend.
2.1.2.7 Otitis externa specifica
Lues (vor allem im Stadium II) und Tbc-Bazillen sind seltene Ursachen einer Otitis externa. Infektionen mit atypischen Tbc-Bazillen durch unsachgemäße Spülungen wurden beschrieben.
2.2 Verletzungen und thermische Schäden
R. Probst
2.2.1 Ohrmuschel
2.2.1.1 Othämatom und Otserom
Definition: Geschlossene Ablösung der Haut-Perichondrium-Schicht vom Ohrmuschelknorpel mit Bildung eines Hämatoms/Seroms zwischen Perichondrium und Knorpel.
Ätiologie: stumpfe Gewalt, häufig Sportverletzung (Ringerohr).
Klinik: Der Befund bei Inspektion und Palpation ist eindeutig (Abb. 2-3): Schwellung und Fluktuation im Bereich der lateralen Ohrmuschelhaut.
Abb. 2-3. Othämatom links. Das Perichondrium und die Haut sind durch die subperichondriale Blutung abgehoben
Diagnostik: Ausschluß von Begleitverletzungen (Felsenbein, Gehörgang/Mittelohr, Kiefergelenk) und sekundären Infektionen.
Komplikationen: Da eine schlechte Resorptionstendenz des Hämatoms/Seroms besteht, kann es zu bleibenden Formveränderungen des Knorpelgerüsts kommen (Blumenkohlohr). Eine sekundäre Infektion führt zur Perichondritis.
Differentialdiagnose: rezidivierende Polychondritis.
Therapie: operatives Ausräumen des Hämatoms/Seroms mit Knorpelfensterung, Refixation des Perichondriums und modelliertem Verband.
Prophylaxe: Ohrenschutz bei entsprechenden Sportarten.
2.2.1.2 Scharfe Verletzung und Ohrmuschelabriß
Definition: Offene Ohrmuschelverletzung mit freiliegendem Knorpel. Ein Ohrmuschel-abriß kann partiell (Hautbrücke vorhanden) oder komplett sein (Ohrmuschelteil vollständig abgetrennt, s. Kasten I).
Kasten I:
Erstmaßnahmen bei Ohrmuschelabriß
Wunde steril abdecken
Sofortige Einweisung in eine HNO-Klinik
Abgetrennte Ohrteile dem Patienten mitgeben
Falls möglich, Teile kühlen, aber nicht direkt auf Eis (Erfrierungsgefahr); ideal: Ohrteilin feuchter Gaze und wasserdichter Verpackung (Plastikbeutel) in Eiswasser legen
In der Klinik
Reanastomierungsversuch, falls es die Umstände erlauben (Zeitgrenze: 6 h)
Alternative: subkutane Implantation des Knorpels retroaurikulär oder zervikal zur sekundären Rekonstruktion nach 6 Monaten
Ätiologie: Rißverletzungen oder scharfes Trauma.
Diagnostik: Zunächst erfolgen sorgfältige Reinigung und Inspektion. Haut- und Knorpelbrücken sollen auf jeden Fall erhalten bleiben. Ausschluß von Begleitverletzungen (Felsenbein, Gehörgang/Mittelohr, Kiefergelenk).
Komplikationen: Perichondritis, Nekrose von gequetschten oder abgetrennten Teilen.
Therapie: Perichondriums- und Hautnaht mit Deckung von freiliegendem Knorpel. Modellierter Ohrverband. Bei Ohrmuschelabriß s. Kasten I und II (Rekonstruktion).
Prophylaxe: Tetanusimpfung.
2.2.1.3 Verbrennungen und Erfrierungen
Definition: Bei Schädigungen I. Grades (Rötung) bis II. Grades (Blasenbildung) thermischer Hautschaden, II. bis III. Grades (Gewebsnekrose) Schaden der Haut-KnorpelEinheit.
Pathogenese: Erfrierungen sind oft Folge unzweckmäßiger Kleidung, Verbrennungen oft Unfälle.Komplikationen: Perichondritis, bleibende Formveränderungen wegen Knorpelnekrose; Frostbeulen am Helixrand mit Ulzerationen und Juckreiz.
Differentialdiagnose: Verätzungen, Strommarken.
Therapie:
Verbrennung: Allgemeine Verbrennungsbehandlung: Kühlung und andere entzündungshemmende lokale Maßnahmen bei leichtgradigen, operatives Vorgehen bei höhergradigen Verbrennungen.
Erfrierungen: Aufwärmen (Wärmelampe); bei Blasen und Nekrosen trockene Behandlung und Abwarten der Demarkation; evtl. durchblutungsfördernde Mittel (Dextran, Pentoxifyllin).
Rekonstruktive Spätversorgung s. Kasten II.
Prognose: Höhergradige Verbrennungen/Erfrierungen sind oft mit bleibenden Formveränderungen verbunden.
2.2.2 Gehörgang
2.2.2.1 Verletzungen
Definition: Isolierte Verletzungen des Gehörgangs, die hauptsächlich durch Fremdkörper oder unsachgemäße Manipulationen bedingt sind.
Klinik: Schmerzen und Blutungen aus dem Gehörgang.
Diagnostik: Anamnese eines Traumas; otoskopischer Befund einer Epithelverletzung und Blutung. Begleitverletzungen des Trommelfells, des Mittelohrs, des Kiefergelenks und der Schädelbasis müssen ausgeschlossen werden.
Komplikationen: sekundäre Infektion, Zystenbildung oder Gehörgangsstenose bei der Heilung.
Therapie: Eine Epithelablösung soll, wenn möglich, readaptiert werden. Bei Blutungen kann eine Gehörgangstamponade mit Gelatine- oder Kunststoffschwämmchen notwendig sein.
Prognose: isolierte Gehörgangsverletzungen sind meist banal und zeigen eine gute Heilungstendenz.
2.3 Tumoren
2.3.1 Benigne Tumoren der Ohrmuschel
2.3.1.1 Senile Keratose
Definition: Vorzugsweise retroaurikulär gelegene, hyperkeratotische Hautveränderung. Präkanzerose. Häufig mit hyperkeratotischen Veränderungen an anderen Stellen einhergehend.
Klinik: unscharf begrenzte, flache Hauterhebung brauner Farbe und rauher Oberfläche.
Diagnostik: Im Zweifelsfall Biopsie oder Exzisionsbiopsie.
Differentialdiagnose: Basaliom, Cornu cutaneum, Morbus Bowen, Plattenepithelkarzinom.
Therapie: Exzision; als Alternative Kryochirurgie.
2.3.1.2 Atherom
Definition: benigner Haarbalgtumor.
Pathogenese: Retentionszysten von Hautanhangsdrüsen; selten Ektodermversprengung.
Klinik: retroaurikulär gelegener, gut verschieblicher Tumor.
Diagnostik: Sicherung der Diagnose durch Exzision und Histologie.
Komplikationen: häufig Entzündungen und sekundäre Infektionen mit Abszedierung.
Differentialdiagnose: kongenitale Zysten, Parotistumor, Lymphknotenvergößerung.
Therapie: Exzision im Gesunden mit spindelförmigem Hautanteil. Bei Sekundärinfektion zuerst Inzision und Drainage.
2.3.1.3 Chondrodermatits nodularis chronica helicis
Definition: kein Tumor sondern entzündliche Hautveränderung der Haut-Perichondrium-Einheit mit unbekannter Ursache.
Klinik: typischer Befund mit knötchenförmiger Veränderung und Schmerzen, vor allem am freien Helix- oder Anthelixrand.
Diagnostik: Sicherung der Diagnose durch Exzision und Histologie.
Komplikationen: sekundäre Infektionen
Differentialdiagnose: Präkanzerosen, Basaliom, Plattenepithelkarzinom oder Gichttophi.
Therapie: Exzision im Gesunden.
Prognose: häufig Rezidive.
2.3.2 Maligne Tumoren der Ohrmuschel
2.3.2.1 Basaliom
(Synonym: Basalzellkarzinom)
Klinik: häufig ulzerierender Tumor mit Tiefeninfiltration des Perichondriums und des Knorpel (Abb. 2-4).
Diagnostik: Bei ausgedehnten Befunden Biopsie, sonst Exzisionsbiopsie.
Abb. 2-4. Basaliom der rechten Ohrmuschel
Diffemtialdiagnose: Plattenepithelkarzinom, M. Bowen, senile Keratose, Chondrodermatitis nodularis.
Therapie: Exzision mit Schnellschnittdiagnostik und Randschnittkontrolle; keine Radiotherapie; evtl. Rekonstruktion (s. Kasten unter 2.3.2.3).
Prognose: sehr selten Metastasierung, aber lokale Rezidive.
Prophylaxe: Sonnenschutz.
2.3.2.2 Plattenepithelkarzinom
(Synonyme: Spinaliom, Stachelzellkarzinom)
Definition: Hautkarzinom mit Infiltration der umgebenden Strukturen (Knorpel!) (Abb. 2-5) und lokoregionärer Metastasierung (Halslymphknoten).
Klinik: Tumor mit unscharfer Begrenzung und/oder Randwallbildung, exophytisch oder ulzerös.
Diagnostik: Diagnose durch Histologie. Der Status der regionären Lymphknoten muß abgeklärt werden (Palpation, Ultraschall, CT, selten MRI).
Komplikationen: durch lokale Infiltration und Metastasierung (Halslymphknoten) bedingt; Fernmetastasen (Lunge, Leber, Gehirn, Knochen) selten.
Abb. 2-5. Plattenepithelkarzinom der rechten Ohrmuschel
Differentialdiagnose: Basaliom, M. Bowen, senile Keratose.
Therapie: in der Regel chirurgische Exzision im Gesunden (mit Schnellschnittkontrolle); evtl. Rekonstruktionen (s. Kasten II). Eine Radiotherapie ist wegen Knorpelinfiltration oft unmöglich.
Eine Therapie der regionären Lymphknoten ist oft angezeigt (Neck-dissection [s. Kasten XII] oder Radiotherapie).
Prophylaxe: Sonnenschutz.
Prognose: abhängig von der Ausdehnung, jedoch bei adäquater Therapie relativ gut (5-Jahres-Überlebensrate 70-80%).
Kasten II:
Rekonstruktion der Ohrmuschel
Umfang und Aufwand einer rekonstruktiven Chirurgie der Ohrmuschel richtet sich nach der Grundkrankheit sowie den Bedürfnissen und den Möglichkeiten einer Rekonstruktion. Eine vollständige Ohrmuschelrekonstruktion gehört zum Schwierigsten und Anspruchsvollsten in der plastisch-rekonstruktiven Chirurgie.
Man kann unterscheiden:
Formkorrektur: relativ einfaches Verfahren, z.B. bei abstehenden Ohren
Rekonstruktion nach Teilexzision: meist Rekonstruktion mit verbleibendem Knorpel
Totalrekonstruktion, v.a. bei kongenitalen Aplasien und Mißbildungen: sehr aufwendige, schwierige und meist mehrzeitige Verfahren mit autologen Knorpeltransplantaten (z.B. von der Rippe) oder Kunststoffimplantaten
Epithetische Versorgung: künstliche Ohrattrappe als Alternative zur Rekonstruktion mit Befestigung an implantierten Titanschrauben, am Brillenbügel oder mit Klebstoff
2.3.2.3 Melanom
Definition: Tumor aus maligne entarteten Melanozyten, gehäuft an lichtexponierter Haut auftretend. Man unterscheidet verschiedene Formen (Lentigo maligna, „superficial spreading“ Form, noduläre Form, lentiginöse Form).
Diagnostik: blauschwarze Verfärbung von Ohrmuscheltumoren; Untersuchung der Halslymphknoten mittels Ultraschall, CT, seltener MRI.
Differentialdiagnose: Pigmentzellnävus, senile Keratose, Naevus caeruleus.
Therapie: Exzision; meist ist eine Ablatio der Ohrmuschel notwendig, evtl. Rekonstruktion (s. Kasten II). Oft zusätzliche Ausräumung der Halslymphknoten.
Prophylaxe: Sonnenschutz, Früherkennung.
Prognose: bei einer Invasionstiefe bis 1,5 mm 95%, bei 4 mm nur noch 45% 5-Jahres-Überlebensrate.
2.3.3 Tumoren des Gehörgangs
2.3.3.1 Exostosen
Definition: echte Osteome oder reaktive Hyperostosen bei häufigem Wasserkontakt (Schwimmerohr).
Diagnostik: typischer otoskopischer Befund mit meist mehreren glatten, weißlichen Erhebungen im medialen Anteil des Gehörgangs. Es kann eine Gehörgangstenose vorliegen.
Komplikationen: Otitis extema, Schalleitungsschwerhörigkeit.
Therapie: operative Abtragung bei Komplikationen.
2.3.3.2 Maligne Tumoren
Definition: Es handelt sich vor allem um Karzinome der Gehörgangshaut. Andere maligne Tumoren sind adenoidzystische Tumoren, Adenokarzinome, Basaliome, evtl. Mitbeteiligung des Gehörgangs bei Ohrmuschelmalignomen, was das Therapiekonzept entscheidend ändert.
Klinik: exulzerierte, schmerzhafte und nicht heilende Veränderung der Gehörgangshaut; oft mit Blutungen und Sekundärinfektionen.
Diagnostik: Biopsieentnahme unter Operationsmikroskop; Untersuchung des Ausmaßes der Infiltration (Computertomographie).
Differentialdiagnose: Otitis extema necroticans, Mittelohrtumoren, Parotistumoren.
Therapie: operativ und radiotherapeutisch
Prognose: von der Ausdehnung abhängig, insgesamt eher ungünstig.
2.4 Mißbildungen
Aurikularanhänge
Meist präaurikulär gelegene, funktionell bedeutungslose Haut-Knorpel-Anhänge, die selten mit anderen Ohrmißbildungen einhergehen können (Gehörsabklärung). Exzision bei kosmetischer Auffälligkeit.
Kongenitale aurikuläre Fisteln
Präaurikulär, meist am Helixrand gelegene Fistelöffnung (Kiemenbogenmißbildung). Komplikationen meist in Form von Infektionen. Bei Komplikationen vollständige Exzision unter Berücksichtigung der möglichen Verläufe (N. facialis, Gehörgang).
Ohrmuschelmißbildungen (Abb. 2-6) Einfache Anomalien wie abstehende Ohren oder Höckerbildung an der Helix (Darwin-Höcker) bedürfen keiner oder einfach durchzuführender operativer Korrekturen. Schwerere Formen wie Klappohr, Makakusohr und Mikrotie (s. unten) bedingen anspruchsvolle Korrekturen (s. Kasten II).
Abb. 2-6. Ohrmuschelmißbildung links
Gehörgangsatresie, Ohratresie
Mirkotien oder Anotien (Fehlen einer Ohrmuschel) sind häufig mit Gehörgangstenose oder Gehörgangsatresie vergesellschaftet. Die Sicherstellung eines mindestens einseitigen funktionell genügenden Gehörs muß bereits bei der Geburt erfolgen (Gehörabklärung und entsprechende Rehabilitation, s. Kap. 5).
Operative Korrektur mit oder ohne Gehörgangs- und Mittelohraufbau frühestens im Vorschulalter.
2.5 Sonstiges
2.5.1 Cerumen obturans
Definition: Vorweigend Sekret der Zeruminaldrüsen, vermischt mit Talg, Desquamationen und Verunreinigungen.
Ätiologie: Störung der physiologischen Selbstreinigung durch Migration des Gehörgangepithels nach außen (s. Otitis extema diffusa). Durch ungeeignete Reinigung Verlagerung des Zerumens nach innen, was durch Ansammlung zu einem Gehörgangsverschluß (Cerumen obturans) führen kann. Auch durch Wasser aufgequollenes Zerumen kann eine Obturation verursachen.
Diagnostik: Erfragen der Ohranamnese (Trommelfellperforation?). Otoskopischer Befund mit Verlegung des Gehörgangs durch gelb-braune bis schwarze Massen, die eine unterschiedliche Konsistenz aufweisen können. Kontrolle und Hörprüfung nach Spülung!
Komplikationen: Otitis externa.
Differentialdiagnose: Cholesteatom, Tumoren.
Therapie: Spülung (s. Kasten III), instrumentelle Entfernung durch den Facharzt.
Kasten III:
Ohrspülung
Ohranamnese, insbesondere Trommelfellperforationen, Felsenbeinfrakturen und Ohroperationen, erfragen; falls positive Anamnese, keine Spülung!
Unter Umständen Vorbehandlung mit Wasserstoffsuperoxid, glyzerinhaltigem Mittel oder anderen Detergenzien (bei hartem Zerumen)
Ohrspülung mit Wasser (37° C) mit einer Ohrspritze unter Verwendung einer stumpfen Kanüle
Wasserstrahl nach hinten oben richten, nicht gegen das Trommelfell
Nach Spülung Otoskopie und klinische Gehörprüfung
Kontraindikationen einer Spülung (Überweisung zum Facharzt):
- Positive Ohranamnese (s.o.)
- Einziges hörendes Ohr
- Unruhiger, unkooperativer Patient
2.5.2 Gehörgangsfremdkörper
Definition: Akzidentell eingebrachter oder eingedrungener Fremdkörper im Gehörgang.
Ätiologie: Am häufigsten handelt es sich um Spielsachen (bei Kleinkindern), Insekten oder Gegenstände, die von Erwachsenen zu Manipulationen im Gehörgang benutzt werden.
Abb. 2-7. Entfernung eines Gehörgangfremdkörpers. Keine Pinzette oder ähnliches Instrument verwenden (links), da sonst die Gefahr einer Verlagerung des Fremdkörpers auf das Trommelfell und ins Mittelohr besteht. Rechts: korrekte Entfernung mit stumpfem Ohrhäkchen
Diagnostik: in der Regel problemlos durch Otoskopie, da der Fremdkörper sichtbar ist. Schwierigkeiten können bei sekundären Verletzungen und Entzündungen auftreten. Auf eine mögliche, gleichzeitige Schädigung von Mittelohrstrukturen muß geachtet werden (Fazialisfunktion, Schwindel und Nystagmus, Schallempfindungs- oder persistierende Schalleitungsschwerhörigkeit).
Komplikationen: Mittel- und Innenohrschäden, sekundäre Otitis (häufig durch Pseudomonas).
Differentialdiagnose: Zerumen, Tumoren, Cholesteatom, Otitis externa.
Therapie: fachgerechte Entfernung, z.B., mit Extraktionshaken (keine Pinzette!), unter Sicherstellung, daß ein tieferes Eindringen des Fremdkörpers in den Gehörgang oder ins Mittelohr ausgeschlossen ist! Keine Spülung! Bei Kindern ist oft eine Extraktion in Narkose einer gefährlichen Manipulation vorzuziehen. Festsitzende Fremdkörper müssen u. U. durch eine Inzision operativ entfernt werden.