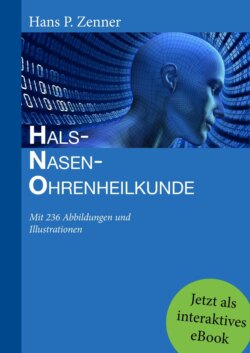Читать книгу Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde - Группа авторов - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3 Trommelfell, Mittelohr und Mastoid
3.1 Tubenventilationsstörungen
H.P. Zenner
3.1.1 Akuter Tubenverschluß, Serotympanum
(Synonyma: akuter Tuben-Mittelohr-Kartarrh, seröse Otitis media)
Definition: Die akute Insuffizienz der ansonsten bei jedem Schluckvorgang ausgelösten Öffnung der Tuba auditiva (Eustachi-Röhre) führt zu einem serösen Paukenhöhlenerguß (Serotympanum).
Pathogenese: Störung der Tubenöffnung (physiologischerweise durch den M. tensor veli palatini) aufgrund einer Schwellung der Schleimhaut des Tubeneingangs. Wichtigste Ursachen für eine Tubeneingangsschwellung sind:
akute Rhinitis,
akute Sinusitis,
allergische Rhinitis,
Adenoide (hyperplastische Rachenmandel) bei Kindern,
Nasopharynxkarzinom bei Erwachsenen.
Bei plötzlichen äußeren Luftdruckänderungen (Barotrauma: Flugzeug, Bergbahn, Paßfahrten) kann eine subklinische, bis dahin symptomatische Tubeninsuffizienz plötzlich wirksam werden.
Als Folge des Tubenverschlusses wird das Mittelohr nicht mehr belüftet. Statt dessen wird die Luft im Mittelohr resorbiert, und es entsteht ein Unterdruck im Mittelohr. Folgen des plötzlichen Mittelohrunterdrucks sind:
Retraktion des Trommelfells, dadurch Steifheitszunahme der Gehörknöchelchen: Schalleitungsschwerhörigkeit;
Schleimhautödem mit Transsudation von Serumbestandteilen, der daraus resultierende Paukenhöhlenerguß (Serotympanum) erhöht den Reibungswiderstand für die Gehörknöchelchen: auch dadurch Schalleitungsschwerhörigkeit.
Abb. 3-1. a Serotympanon: Das Mittelohr ist flüssigkeitsgefüllt, man sieht eine Luftblase unterhalb des Hammergriffes
Klinik: Akuter Druck im Ohr, Schalleitungsschwerhörigkeit, zum Teil Ohrenschmerz, Knackgeräusch beim Schlucken. Zusätzlich klinische Symptomatik der jeweils auslösenden Ursache (vgl. Pathogenense).
Diagnostik: Trommelfellretraktion mit Verzerrung oder Verlust des dreieckigen Lichtreflexes. Bei Paukenerguß ist die Flüssigkeit hinter dem Trommelfell zu erkennen an
dunkelgelber Farbe,
manchmal an der dunklen Linie des Flüssigkeitsspiegels sowie
ringförmigen Luftblasen,
Stimmgabelversuche nach Weber (Lateralisation ins kranke Ohr) und Rinne (zumeist negativ), Tonschwellenaudiogramm (Schalleitungsschwerhörigkeit); Tympanogramm: bei Unterdruck nach links (zu negativen Drücken) verschoben und etwas flacher, bei Serotympanum ganz flache Kurve;
Abklärung der auslösenden Ursache (vgl. Pathogenese).
Therapie: a-Sympathominmetika als Nasentropfen zum Abschwellen des Tubeneingangs, Kamilleninhalation. Bei nichtentzündlicher Genese: Tubendurchblasungen nach Valsalva oder Politzer. Keine Ohrentropfen. Werden Tubendurchblasungen nach Valsalva oder Politzer bei akuter Rhinitis/Sinusitis durchgeführt, dann droht Keimverschleppung ins Mittelohr.
Grundsätzlich außerdem: Therapie der Grundkrankheit (z.B. Entfernen vorhandener Adenoide, antiallergische Therapie bei Allergie, onkologische Therapie eines Nasopharynxkarzinoms, adäquate Therapie einer Rhinitis/Sinusitis).
Prophylaxe: bei Adenoiden im Kindesalter frühzeitige Adenotomie.
Prognose: Bei adäquater Therapie wird die Tubenfunktion in der Regel in wenigen Tagen wiederhergestellt. Ein Serotympanum bildet sich dann zurück.
Gelingt die Öffnung der Tube nicht, dann geht der akute Tubenverschluß in einen chronischen Tubenverschluß mit Seromukotympanum (seromuköse Otitis media Abschn. 3.2.1) über.
3.1.2 Chronischer Tubenverschluß, Seromukotympanum
(Synonyme: chronischer Tùben-Mittelohr-Kartarrh, chronische seromuköse Otitis media)
Definition: Eine chronische Tubeninsuffizienz führt zu einem Seromukotympanum mit Schalleitungsschwerhörigkeit.
Ätiologie: Die zum akuten Tubenverschluß (s.o.) führenden Ursachen können auch eine längerdauernde Tubeninsuffizienz auslösen. Eine chronische Behinderung der Tubenöffnung tritt auch bei Insuffizienz des M. tensor veli palatini (z.B. Gaumenspalte) auf.
Pathogenese: Der längerdauernde Tubenverschluß führt zu einem längerdauernden Unterdruck im Mittelohr. Folgen sind
eine Metaplasie der Schleimhaut des Mittelohrs mit Ausbildung schleimbildender Becherzellen.
Das Sekret der Becherzellen und das Transsudat im Mittelohr vermischen sich zu einer dickflüssigen, zähen Flüssigkeit, wodurch das Seromukotympanum entsteht.
Seromukotympanum und Schleimhautmetaplasie mit Schleimhautschwellungen behindern ihrerseits die Belüftung des Mittelohrs, wodurch der Effekt des chronischen Tubenverschlusses verstärkt wird.
Die Folge ist, daß selbst bei Beseitigung der Tubenventilationsstörung am nasopharyngealen Tubeneingang die Metaplasie der Mittelohrschleimhaut mit Aufrechterhaltung des Seromukotympanums bleibt. Die Folgen des Unterdrucks und des Seromukotympanums sind eine Versteifung sowie ein ausgeprägter Reibungswiderstand der Gehörknöchelchen-kette, was zu einer ausgeprägten Schalleitungsschwerhörigkeit führt.
Klinik: Sehr unangenehmes Druckgefühl, ausgeprägte Schwerhörigkeit bis Taubheitsgefühl, knackendes Geräusch bei Schlucken, Gähnen oder Schneuzen. Kann ein- oder beidseitig auftreten.
Diagnostik: Das Trommelfell ist retrahiert. An den Stellen, an welchen sich seromuköse Flüssigkeit im Mittelohr ansammelt, ist eine dunkelblaue Verfärbung des Trommelfells („blue ear drum“) manchmal verbunden mit ringförmig erscheinenden Luftblasen zu erkennen. Die Schalleitungsschwerhörigkeit (Stimmgabel: Weber-Versuch lateralisiert ins kranke Ohr, Rinne negativ; Audiogramm: Luft-Knochen-Leitungs-Differenz) kann sehr ausgeprägt sein und 30-60 dB erreichen. Bei der Tympanometrie zeigt sich die Kurve stark abgeflacht. Die Ursache des chronischen Mittelohrkartarrhs (Adenoide bei Kindern, chronische Rhinitis, chronische Sinusitis, nasale Allergie, Nasopharynx(arzinom bei Erwachsenen, Gaumenspalte) muß gefunden werden.
Differentialdiagnose: Trommelfelladhäsivprozeß, Hämatotympanum.
Therapie: Grundkrankheit sanieren: Adenotomie bei Adenoiden, onkologische Therapie eines Nasopharynxkarzinoms, Sanierung einer chronischen Rhinitis oder Sinusitis, antiallergische Therapie bei Allergie; Tubendurchblasungen nach Politzer und Valsalva oder nach Sondierung des Tubeneingangs über die Tubensonde (Cave: Verletzungsrisiko). Zusätzlich Einsetzen eines Paukenröhrchens in die Parazenteseöffnung (Paukendrainage s. Abb. 3-1b), um diese für mehrere Monate offenzuhalten. Dadurch wird eine Belüftung des Mittelohrs von außen erreicht, die zur Rückumwandlung der metaplastischen Schleimhaut beiträgt.
Kommt die Schleimproduktion trotz eingelegtem Paukenröhrchen nicht zur Ruhe, Versuch mit Kortison (lokale Applikation durch das Paukenröhrchen oder systemisch). Weitere Behandlungsversuche: intratympanale Gabe von Hyaluronidase oder a-Chymotrypsin.
Abb. 3-1. b Paukendrainage: Man sieht ein Trommelfellröhrchen, das nach einer Parazentese (Abb. 3-4) in das Trommelfell eingesetzt wurde. Über das Trommelfellröhrchen wird die Paukenhöhle für einige Wochen bis Monate belüftet
Prophylaxe: bei Adenoiden unverzügliche Adenotomie, sobald ein Serotympanum manifest wird.
Prognose: Nur in einem Teil der Fälle ist mit folgenloser Ausheilung zu rechnen. Ansonsten chronische Exazerbation des Krankheitsbilds mit
Bildung von Cholesteringranulomen durch Ausfällung von Cholesterinkristallen in der seromukösen Flüssigkeit (s. Abschn. 3.2.2.2).
Ausbildung einer Tympanosklerose (s. Abschn. 3.2.2.2)
Ausbildung eines Trommelfelladhäsivprozesses (s. Abschn. 3.1.4)
3.1.3 Klaffende Tube
Definition: Eine zu weit offene Tuba auditiva stellt eine offene Verbindung zwischen Mittelohr und Nasopharynx dar, wodurch sich das Trommelfell mit den Luftdruckänderungen im Nasopharynx mitbewegt und der Schall der eigenen Stimme über die Tube das Ohr erreicht.
Pathogenese: Verlust der elastischen Rückstellkraft des Tubenknorpels oder auch Verlust von submukösem Fettgewebe am Tubeneingang; möglicherweise auch erhöhter Dauertonus der Gaumenmuskulatur (M. levator und tensor veli palatini).
Klinik: Autophonie: Der Kranke hört seine eigénen Worte dröhnend im Ohr; inspirato- tische und exspiratorische Ohrgeräusche, bei dünnem (atrophsichem) Trommelfell knatternd.
Diagnostik: Unter dem Ohrmikroskop kann man eine atemsynchrone Trommelfellbewegung sehen.
Therapie: sehr selten erforderlich; ggf. Unterfütterung des Tubeneingangs mit flüssigem Kollagenimplantat.
3.1.4 Adhäsivprozeß des Trommelfells
Definition: Beim Trommelfelladhäsivprozeß verklebt das Trommelfell mit der Promontorialwand des Innenohrs (d.i. mediale Wand des Mittelohrs), so daß eine Schalleitungsschwerhörigkeit entsteht.
Pathogenese: Chronischer oder chronisch rezidivierender Tùbenverschluß mit Resorption der Luft im Mittelohr und entsprechendem Unterdruck, der das Trommelfell nach innen zieht, bis es die Promontorialwand berührt und dort anwächst. Gleichzeitig laufen die unter chronischem Tubenverschluß (s. Abschn. 3.1.2) beschriebenen Vorgänge ab. Die Folge ist eine Fixation von Trommelfell und Gehörknöchelchenkette mit ausgeprägter Schalleitungsschwerhörigkeit.
Klinik: Seit langem bestehende Schwerhörigkeit.
Diagnostik: Unter dem Ohrmikroskop zeigt sich das Trommelfell massiv eingezogen und mit der Promontorialwand verwachsen (Abb. 3-2).
Bei den Versuchen nach Valsalva und Politzer ist die Titbe nicht oder nur sehr schwer durchgängig. Schalleitungsschwerhörigkeit: Weber-Versuch Lateralisation zum erkrankten Ohr, Rinne-Versuch negativ. Tonschwellenaudiometrie: Luft-Knochen-Leitungs-Differenz.
Abb. 3-2. Trommelfellretraktion mit Adhäsivprozeß. Durch Unterdruck in der Paukenhöhle wurde das Trommelfell nach medial gezogen. Man sieht, daß es mit der Promontorialwand des Innenohrs verwachsen ist (Adhäsivprozeß)
Therapie: Versuch der Wiederherstellung der Tubenfunktion wie beim chronischen Tubenverschluß. Gelingt zwar eine zuverlässige Tubensuffizienz, aber wird das Hörvermögen dadurch nicht ausreichend besser: Tympanoplastik (s. Kasten IV).
3.2 Entzündungen
H.P. Zenner
3.2.1 Akute Otitis media
Definition: Akute eitrige Entzündung der Mittelohrschleimhaut, immer mit Beteiligung der Schleimhaut des Mastoids einhergehend.
Ätiologie und Pathogenese:
Fast immer bakterielle Infektion über die Tube durch (in Reihenfolge ihrer Häufigkeit) ß-hämolysierende Streptokokken der Gruppe A, Pneumokokken (besonders bei Kindern), Haemophilus influenzae, Staphylokokken. Bei traumatischer (s. Abschn. 3.8.2.1) oder chronisch entzündlicher Trommelfellperforation (s. Abschn. 3.2.2) Eindringen von Keimen durch die Perforationsstelle, beispielsweise beim Schwimmen oder bei Ohrspülungen, häufig Infektion mit Problemkeimen: E. coli, Proteus, Pyocyaneus, Pseudomonas.
z.T. Virusinfekte mit nachfolgender bakterieller Superinfektion.
Sehr selten hämatogen: Scharlach, Masern, Typhus, Sepsis.
Klinik: Bei voll entwickeltem Krankheitsbild unterscheidet man 3 aufeinanderfolgende Stadien:
Stadium 1
Exsudative Entzündung: dauert bis zu zwei Tagen und geht mit einem Temperaturanstieg bis 39-40° C, starken pulsierenden Ohrenschmerzen, Schwerhörigkeit und mit z.T. Schüttelfrost einher (im Alter nicht immer Fieber). Nebensymptom: beim Kind gelegentlich Meningismus.
Stadium 2
Trommelfelldurchbruch: Zwischen dem 3. und B. Tag durchbricht der Eiter spontan das Trommelfell, wodurch Ohrenschmerzen und Fieber häufig schlagartig nachlassen. Bei adäquater Therapie (s.u.) werden der Trommelfelldurchbruch vermieden und eine frühzeitige Schmerzbeseitigung und Entfieberung erreicht.
Stadium 3
Heilung: Der Eiterausfluß aus dem Ohr kommt innerhalb einer Woche (selten länger dauernd) zum Erliegen, das Trommelfell verschließt sich, das Ohr wird wieder normal über die Tube belüftet, das Hörvermögen normalisiert sich.
a
b
Abb. 3-3 a, b. Akute Mittelohrentzündung: a z.T. entdifferenziertes, z.T. rotes Trommelfell; b Trommelfellvorwölbung durch Druck des Eiters
Diagnostik:
Stadium 1:
Unter dem Ohrmikroskop sind
a) Blutgefäße sichtbar („Injektion“), dann werden
b) graue Schollen auf dem Trommelfell erkennbar, so daß sich die Hammergriffkontur zu verwischen erscheint („Entdifferenzierung“, Abb. 3-3a); anschließend wird
c) das Trommelfell rot („rotes Trommelfell“, Abb. 3-3a) und
d) stark vorgewölbt unter dem Druck des Eiters im Mittelohr („Trommelfellvorwölbung“, Abb. 3-3b), z.T. pulsierend, z.T. auf die Gehörgangswand übergreifend.
Schalleitungsschwerhörigkeit: Weber-Versuch ins kranke Ohr lateralisiert, Rinne-Versuch auf krankem Ohr negativ, Tonaudiometrie zeigt Schalleitungsstörung (Luft-Knochen-Leitungs-Differenz). Aufgrund der stets auftretenden Begleitmastoiditis teilweise druckschmerzhaftes Mastoid.
Stadium 2:
An der Stelle der stärksten Vorwölbung (zumeist im vorderen oder hinteren unteren Quadranten) Entstehung einer winzigen „Perforation” (Abb. 3-4a) mit pulsierendem Austritt von serös-eitrigem, nicht fötidem Sekret.
Stadium 3:
Die Trommelfellrötung verschwindet, die Hammerkontur wird wieder gut sichtbar („Redifferenzierung“), die Spontanperforation verschließt sich mit einer winzigen Narbe, das Gehör wird wieder normal. Komplikationen: Die akute Otitis media kann zu lebensgefährlichen Komplikationen führen. Heilt eine adäquat behandelte Mittelohrentzündung nicht innerhalb von 2-3 Wochen vollständig aus, dann muß auch bei fehlender Komplikationssymptomatik an eine Komplikation gedacht werden, wie
Mastoiditis (s. Abschn. 3.2.1.6)
Pyramidenspitzeneiterung (s. Abschn. 3.3.5)
toxische oder eitrige Labyrinthitis (Abschn. 4.4.2)
Fazialisparese (s. Abschn. 6.1.2.7 u. 8.1.4)
epidurales Empyem (s. Abschn. 3.3.1)
Miningitis (s. Abschn. 3.3.2)
Hinrabszeß (s. Abschn. 3.3.4)
sinusthrombose (s. Abschn. 3.3.3)
Sepsis (s. Abschn. 3.3.3)
Abb. 3-4 a–c. Eiterabfluß bei akuter Mittelohrentzündung: a Spontanperforation, b, c, Parazentese an der Stelle der stärksten Vorwölbung [a, b aus: Boenninghaus H-G (1993) HNO-Heilkunde, 9. Aufl., Springer, Heidelberg]
Frühkomplikation: Tritt eine der Komplikationen während des 1. Stadiums auf (zumeist Fazialisparese oder Labyrinthitis), dann heißt sie otogene Frühkomplikation.
Spätkomplikation: Tritt die Komplikation während des 3. Stadiums auf, heißt sie Spätkomplikation.
Alarmsymptome im 3. Stadium:
erneutes Fieber,
erneute Ohrenschmerzen und Sekretion,
Kopfschmerzen,
reduzierter AZ,
BKS-Anstieg.
Differentialdiagnose: vergleichbare akute Ohrenschmerzen bei Otitis externa.
Therapie: Ohrentropfen sind sinnlos, denn sie erreichen nicht das Mittelohr (außer bei einer großen Trommelfellperforation ohne stärkere Sekretion). Richtig: Nasentropfen (alpha-Sym pathomimetikum) zum Abschwellen des Tubenostiums, damit Eiter aus dem Mittelohr abfließen kann; antibiotische Therapie für 8 Tage, (evtl. Antipyretika). Bei sich stark vorwölbendem rotem Trommelfell, unerträglichen Schmerzen oder Druckempfindlichkeit des Mastoids: Parazentese (s. Abb. 3-4b,c) an der Stelle der stärksten Vorwölbung. Bei Eiterabffuß infolge Spontanperforation oder Parazentese: Abstrich, Umstellen der Antibiose entsprechend dem Antibiogramm.
Prognose: in der Regel folgenlose Abheilung bis auf winzige Narbenbildung im Trommelfell. Bei Auftreten von Komplikationen fast immer Lebensgefahr.
3.2.1.1 Akute Otitis media im Säuglings- und Kleinkindesalter
Definition: Eitrige Entzündung der Schleimhaut des Mittelohrs mit Beteiligung der Ma- stoidschleimhaut wie beim Erwachsenen. In Einzelfällen jedoch zusätzliche charakteristische lokale und allgemeine Symptome (s.u.).
Ätiologie und Pathogenese: Säuglinge und Kleinkinder sind wegen ihrer kurzen, gerade verlaufenden und weiten Tuben besonders anfällig für Mittelohrinfekte. Dazu trägt auch die häufig vergrößerte Rachenmandel bei.
Klinik: wie beim Erwachsenen, wobei Spontanperforationen häufig ausbleiben; zusätzlich
lokale Symptome: häufiges Greifen nach dem kranken Ohr, Schmerzen bei Berührung der Ohrmuschel;
Allgemeinsymptome: hohes Fieber (über 40° C), Störung der Ernährung und Verdauung, Pyelonephritis, Meningismus.
Diagnose: wie bei Schulkindern und Erwachsenen (s.o.).
Therapie: wie bei Erwachsenen und Schulkindern (Antibiotikum allerdings parenteral). Bei ausbleibender Spontanperforation: Parazentese, danach zumeist sofortige Besserung des Krankheitsbilds.
Prognose: nicht selten protrahierter Verlauf mit Exazerbationen. Mit Komplikationen wie beim Erwachsenen muß gerechnet werden. Deshalb: Kommt es nicht zu einer raschen Erholung nach Einleitung der Therapie (spätestens nach 1 Woche), erfolgt eine Antrotomie (operative Ausräumung der entzündeten Anteile von Mastoid und Antrum mastoideum. über einen retroaurikulären Schnitt).
3.2.1.2 Mukosusotitis
Definition: anfänglich Infektion der Mittelohrschleimhaut durch Pneumococcus Typ III (mucosus) mit Knocheneinschmelzung ab der 3. Woche.
Klinik: ca. 2 Wochen lang protrahierter symptomarmer Verlauf mit geringen Ohrenschmerzen; in der 3. Woche Knocheneinschmelzung im Warzenfortsatz.
Diagnostik: Wenig ausgeprägte Veränderungen am Trommelfell (verdickt, blaß oder gerötet), starke BSG-Beschleunigung, Erregernachweis im Mittelohrsekret nach Parazentese; Röntgenaufnahme des Warzenfortsatzes (Schüller): Knocheneinschmelzung.
Komplikationen: bei Knocheneinschmelzung intrakranielle Komplikationen (Meningitis, epidurales Empyem, Hirnabszeß).
Therapie: bei Knocheneinschmelzung (fast immer vorhanden) Mastoidektomie. Ansonsten hochdosiert liquorgängige Antibiotika und abschwellende Nasentropfen.
3.2.1.3 Otitis media bullosa
(Synonym: Grippeotitis)
Definition: akute hämorrhagische Entzündung der Mittelohrschleimhaut durch Infektion mit Influenzaviren mit Blutblasen auf dem Trommelfell und im Gehörgang.
Pathogenese: toxische Kapillarschädigung.
Klinik: starke Ohrenschmerzen, Schalleitungsschwerhörigkeit.
Diagnostik: auffällige Blasen, z.T. Blutblasen (häufig eingetrocknet) oder Blutung auf Trommelfell und/oder im Gehörgang (Abb. 3-5).
Komplikationen: Innenohrbeteiligung mit Innenohrschwerhörigkeit, Mastoiditis mit Fazialislähmung, Meningitis.
Abb. 3-5. Hämorrhagische Otitis media, Grippeotitis. Blutblasen auf dem Trommelfell und im Gehörgang, z.T. eröffnet mit Blutung, z.T. in Abheilung begriffen
3.2.1.4 Zoster oticus
(s. Abschn. 4.4.2.2)
3.2.1.5 Scharlach und Masernotitis media
Definition: akute Mittelohrentzündung bei oder nach Scharlach oder Masern.
Pathogenese: hämatogen. Bei Masern folgen z.T. eine tubogene bakterielle Superinfektion und danach eine eitrige Mastoiditis, bei Scharlach Gewebsnekrosen mit Trommelfell-perforation (dann Übergang in chronische Otitis media mesotympanalis, s. Abschn. 3.2.2), Gehörknöchelchenverlust und Knocheneinschmelzung.
Klinik: Ohrenschmerzen und Schalleitungsschwerhörigkeit bei im Vordergrund stehender Allgemeinsymptomatik von Masern bzw. Scharlach. Dadurch wird die Ohrbeteiligung leicht übersehen.
Therapie: bei Scharlach Penizillin, bei Masernotitis Breitspektrumpenizillin.
3.2.1.6 Mastoiditis
Definition: häufigste Komplikation der Mittelohrentzündung.
Bei jeder Mittelohrentzündung ist zunächst die Schleimhaut des Warzenfortsatzes mitbeteiligt. Bei einer Mastoiditis greift die Entzündung auf den Knochen über. Je nach Ausdehnung unterscheidet man:
Mastoiditis: eitrige Einschmelzung der Zellen des Mastoiditis.
Petrositis: Übergreifen auf die Pyramidenspitze.
Zygomatizitis: Übergreifen auf die Zellen des Jochbogens.
Pathogenese: Verschiedene Ursachen können dazu beitragen, daß die eitrige Entzündung von der Schleimhaut auf den Knochen übergreift:
Tubenventilationsstörung, enges Antrum (zwischen Mittelohr und Mastoid).
Diabetes mellitus, reduzierter Allgemeinzustand bei Allgemeinerkrankung.
Erregervirulenz und -resistenz
Klinik: Verdächtig ist ein länger als zwei Wochen dauernder Verlauf einer akuten Mittelohrentzündung, auch wenn bereits eine scheinbare Besserung aufgetreten ist. Die Mastoiditis tritt typischerweise aus dieser scheinbaren Besserung heraus auf, zumeist in der 3. Woche.
Diagnostik:
Mastoiddruckschmerz.
Retroaurikulär verstrichene Ohrumschlagsfalte oder Schwellung mit abstehender Ohrmuschel sowie in der Regel – aber nicht immer – eines oder mehrere der folgenden Zeichen:
Ohrsekretion (falls sie auftritt, spricht man zusammen mit den beiden o.g. Symptomen von der klassischen Symptomentrias)
Zunahme der Schalleitungsschwerhörigkeit
Verdicktes Trommelfell, häufig schollig und getrübt
Fieber, deutlich reduzierter Allgemeinzustand
Röntgen (Schüller): Trübung und z.T. sichtbare Knocheneinschmelzung
Zygomatizitis: Schwellung über der Jochbogenwurzel
Bezold-Mastoiditis: Schwellung unter dem kranialen Ansatz des Musculus sternocleidomastoideus mit Schiefhals als Folge eines Durchbruchs der Entzündung durch die Masoidspitze in die Halsweichteile
Abb. 3-6. Komplikationen der Mastoiditis:
1 subperiostaler Abszeß als Folge eines Durchbruchs durch das Planum mastoideum,
2 Zygomatizitis (nicht gezeigt),
3 Labyrintheinbruch (nicht gezeigt),
4 Einbruch in den Fazialiskanal (nicht gezeigt),
5 Sinus-sigmoideus-Thrombose mit nachfolgender Thrombophlebitis, Sepsisgefahr, Gefahr eines episinuösen Abszesses,
6 Epiduralabszeß,
7 Hirnabszeß im Temporallappen,
8 Kleinhirnabszeß,
9 Bezold-Abszeß (Kleinkind) nach Arnold W., Ganzer U., Checkliste HNO-Heilkunde, Thieme 1990
Komplikationen: z.T. lebensbedrohliche Komplikationen (Abb. 3-6) wie bei akuter Otitis media (s. Abschn. 3.2.1). Bei fehlender oder ungenügender Behandlung (z.B. Verzicht auf operative Therapie) kann sich die Entzündung trotz Antibiose innerhalb des Felsenbeins ausbreiten und dazu führen, daß
sich eine diffuse Labyrinthitis mit irreversiblem Funktionsverlust des Hör-Gleichgewichts-Organs entwickelt,
eine Fazialisparese durch die Ausbreitung der Entzündung im Fazialiskanal hervorgerufen wird
bei Durchbruch der Entzündung durch den Knochen in den Sinus sigmoideus eine Sinuphlebitis mit Sinusthrombose und Gefahr einer Sepsis entsteht,
durch Arrosion des Knochens zur mittleren oder hinteren Schädelgrube die Entzündung in das Schädelinnere gelangt und eine Meningitis oder einen Hirnabszeß im Bereich des Temporallappens oder des Kleinhirns verursacht.
Differentialdiagnose: Otitis externa, Ohrmuschelentzündung, Kiefergelenkentzündung, Parotitis, Lymphadenitis colli.
Therapie: Mastoidektomie (Abb. 3-7). Von einem retroaurikulären Schnitt aus wird der krankhaft veränderte Knochen im Warzenfortsatz entfernt und Eiter abgelassen, daneben die Tubenventilation durch abschwellende Nasentropfen wiederhergestellt sowie Breitspektrumpenizillin verabreicht. Eine alleinige antibiotische Therapie ohne Operation kann die lebensbedrohlichen Komplikationen nicht zuverlässig verhindern.
Prognose: Bei adäquater kombinierter operativer und konservativer Therapie ist fast immer eine Ausheilung mit Erhalt des Hörvermögens zu erwarten.
Abb. 3-7. Mastoidektomie bei akuter Mastoiditis
a Schema:
1 Mastoidhöhle,
2 knöcherne Schale des Sinus sigmoideus,
3 knöcherner Kanal des Nervus facialis,
4 hintere Gehörgangswand zwischen Gehörgang und Mastoid,
5 Trommelfell
[mod. nach Becker et al. (1989) HNO-Heilkunde, 4. Aufl., Thieme, Stuttgart]
b Intraoperative Situation:
retroaurikuläre Schnittführung zur Eröffnung des Mastoids, Austritt von unter Druck stehendem Eiter aus dem Mastoid bei subperiostalem Abszeß
3.2.1.7 Okkulte Mastoiditis und okkulte Antritis des Säuglings
Definition: Bei Säuglingen und Kleinkindern kann bei Bauchschmerzen, Appetitlosigkeit und Fieber (nicht obligat) oft überraschenderweise eine okkulte Mastoiditis oder Antritis die alleinige Ursache sein.
Pathogenese: Vorausgegangen ist eine subklinische Otitis media, die zu einer periantralen Osteomyelitis geführt hat,.
Klinik: Keine Ohrsymtome, sondern Bauchschmerzen, Appetitlosigkeit sowie – nur in einem Teil der Fälle – Fieber, für die trotz intensiver pädiatrischer Diagnostik innerhalb von 2-3 Wochen keine Ursache gefunden wird.
Therapie: Antrotomie, Mastoidektomie.
Prognose: In der Regel überraschend schnelles Verschwinden von Bauchschmerzen und Appetitlosigkeit (z.T. schon am 1. postoperativen Tag) und schnelle Erholung des Säuglings nach der Operation.
3.2.2 Chronische Schleimhautentzündung des Mittelohrs
(Synonym: Chronische Otitis media mesotympanalis)
Definition: Chronische Entzündung der Schleimhaut von Mittelohr und Warzenfortsatz, als deren Folge eine zentrale Trommelfellperforation auftritt. Bei einem Teil der Patienten kommt es durch eine rarefizierende Ostitis zusätzlich zu einem Verlust von Teilen der Gehörknöchelchen. Folge ist zumeist eine chronische Schalleitungsschwerhörigkeit.
Ätiologie: Eine chronische Mittelohrentzündung entsteht fast nie als Folge einer akuten Mittelohrentzündung, sondern ist ein eigenständiges Krankheitsbild. Die Ätiologie ist ungeklärt. Auffällig ist, daß fast alle Betroffenen im Röntgenbild (Schüller) eine Minderpneumatisation des Mastoids aufweisen. Da die Pneumatisation des Mastoids in den ersten Lebensjahren vonstatten geht und eine Leistung der Mittelohrschleimhaut ist, geht man von einer Assoziation der teilweisen Trommelfell- und Gehörknöchelchenzerstörung mit einer konstitutionellen Schleimhautminderwertigkeit aus.
Pathogenese: Mit zunehmender Größe eines Trommelfelldefekts verschlechtert sich die Funktion des Trommelfells als Schalldruckempfänger, weil zum einen das Flächenverhältnis zwischen Trommelfell und Steigbügelfußplatte ungünstiger wird und zum anderen sich die Schwingungsamplitude der Gehörknöchelchen verkleinert. Dadurch entsteht eine Schalleitungsschwerhörigkeit.
Bestehen gleichzeitig eine Trommelfellperforation sowie eine Unterbrechung der Gehörknöchelchenkette, so wirken sich zahlreiche weitere Umstände auf diese Schalleitungsschwerhörigkeit aus. Derartige Randbedingungen sind:
der Ort der Kettenunterbrechung,
die Größe und die Lage der Trommelfell-perforation,
die Konsistenz (tympanosklerotische Plaques) und anatomische Anordnung (Adhärenzen?) des Resttrommelfells.
Beispiel: Ein wichtiger Gesichtspunkt ist die sog. Schallprotektion des runden Fensters. Das gesunde Mittelohr erlaubt die für die physiologische Wanderwelle des Innenohrs erforderlichen gegenphasigen Ein- und Ausschwingungen der ovalen und runden Fenstermembranen (wenn Steigbügel und ovales Fenster einschwingen, muß das runde Fenster ausschwingen und umgekehrt, vgl. Physiologielehrbuch). Physiologischerweise tritt der Schall nur durch das ovale Fenster in die Cochlea ein. Das runde Fenster hingegen ist vor dem Außenschall durch das Trommelfell geschützt. Ist bei einem Trommelfelldefekt das Resttrommelfell so gelegen, daß trotzdem noch die Schallprotektion des runden Fenster erreicht wird, so führen Schalldruckempfängerverlust des Trommelfells sowie Kettenunterbrechung zu Schalleitungsschwerhörigkeiten um etwa 28 dB. Führt der Trommelfelldefekt jedoch zu einem Verlust des Schallschutzes für das runde Fenster, so kann der dort eintreffende Luftschall die zum ovalen Fenster gegenläufige (phasenverschobene) Auslenkung des runden Fenster verhindern und die Schwerhörigkeit bis zu 42 dB steigern.
Klinik: monate- bis jahrelange Schwerhörigkeit, bei einem Teil der Patienten intermittierende schleimige, manchmal eitrige Sekretion aus dem Ohr.
Diagnostik: mesotympanaler zentraler Trommelfelldefekt (Achtung: im Gegensatz dazu hat die chronische Knocheneiterung (Cholesteatom) in der Regel einen epitympanalen randständigen Trommelfelldefekt). Fast immer Schalleitungsschwerhörigkeit; Röntgen (Schüller): Pneumatisationshemmung des Mastoids.
Der Verlauf einer chronischen Mittelohrentzündung wird beeinflußt durch
eine evtl. bestehende Tubenfunktionsstörung,
einen evtl. reduzierten Allgemeinzustand (z.B. Diabetes mellitus) sowie
vor allem durch rezidivierende Perioden von Schleimsekretion wie auch
rezidivierende Perioden bakterieller Superinfektion mit Eiterausfluß.
Differntialdiagnose: chronische Otitis media epitympanalis (Cholesteatom, aber epitympanaler, randständiger Trommelfelldefekt; Mittelohrtuberkulose (mehrere Defekte im Trommelfell), Mittelohrkarzinom.
Therapie: Tympanoplastik: mikrochirurgische Mittelohroperation, bei der gleichzeitig die Entzündung saniert, das Trommelfell verschlossen und die Gehörknöchelchen-kette ggf. wiederaufgebaut wird. Es gibt mehrere Typen von Tympanoplastiken (s. Kasten IV).
Bei verschlossener Tube Tympanoplastik erst durchführen nachdem die Ursache der Tubenventilationsstörung (s. Abschn. 3.1) beseitigt wurde. Bei starker Sekretion Operationsvorbereitung durch sekretionshemmende Therapie; mehrmals täglich Reinigung des Ohres mit Wasserstoffsuperoxid, Alkohol oder Kaliumpermanganat. Bei akuter Superinfektion mit purulenter Sekretion: Abstrich, systemische Antibiotikatherapie. Die lokale Gabe von aminoglykosidhaltigen Ohrentropfen ist wegen Ertaubungsgefahr kontraindiziert. Aufgrund der hohen Allergisierungsrate bei lokaler Anwendung wird auch auf die lokale Anwendung anderer Antibiotika im Normalfall verzichtet. Nach Abklingen der akuten Exazerbation Tympanoplastik. Falls operativ keine Hörverbesserung erzielt wird, bei beidseitiger Schwerhörigkeit Hörgerät (s. Kasten VI) oder elektronisches Hörimplantat (s. Kasten VII).
Prognose: Nach einer Tympanoplastik heilt die chronische Schleimhautentzündung bei normaler Tubenfunktion in mehr als 80% der Fälle aus. Ohne Operation schubweiser Verlauf der chronischen Mittelohrentzündung mit Exazerbationen im Abstand von Wochen, Monaten oder Jahre (z.B. Badewasser oder tubugene Infektionen), progrediente Schalleitungsschwerhörigkeit. Lebensbedrohliche Komplikationen sind nicht zu erwarten.
3.2.3 Chronische Knocheneiterung, erworbenes Cholesteatom des Mittelohrs
(Synonym: chronische Otitis media epitympanalis)
Definition: Das Cholesteatom bedeutet eine. chronische osteoklastische Knochenzerstörung als Folge von ortsfremdem, verhornendem Plattenepithel in den physiologischerweise nur mit Schleimhaut ausgekleideten Mittelohrräumen mit bedrohlichen Komplikationsmöglichkeiten.
Es besteht
– fast immer ein randständiger epitympanaler Trommelfelldefekt in der Pars flaccida (daher spricht man von der chronischen Otitis media epitympanalis oder vom Flaccida-Cholesteatom),
– sehr selten ein randständiger Trommelfelldefekt in der Pars tensa (Tensa-Cholesteatom).
Ätiologie und Pathogenese: Ein Cholesteatom entsteht als Folge des Einwachsens von verhornendem Plattenepithel in das normalerweise mit Schleimhaut ausgekleidete Mittelohr und Mastoid.
3.2.3.1 Primäres Cholesteatom (selten)
Papilläres Tiefenwachstum von verhornendem Plattenepithel des Trommelfells (sehr selten). Ein primäres Cholesteatom kann lange Zeit hinter einem klinisch intakten Trommelfell ohne sichtbare Trommelfellperforation wachsen. Es ist daher anfänglich ein okkultes Cholesteatom bei intaktem Trommelfell.
3.2.3.2 Sekundäres Cholesteatom (häufig)
Wie bei der chronischen Otitis media meso- tympanalis (chronische Schleimhauteiterung) findet man bei Kranken mit einem Cholesteatom meist eine Pneumatisationshemmung des Mastoids (röntgenologisch, Schüller-Aufnahme). Sie läßt, wie bereits bei der chronischen Schleimhauteiterung erwähnt, auf eine konstitutionelle Schleimhautminderwertigkeit schließen, als deren Folge nun keine zentrale, sondern eine randständige Trommelfellperforation (zumeist der Pars flaccida, selten der Pars tensa) (Abb. 3-8 c,d) auftritt, die an das verhornende Plattenepithel des Gehörgans grenzt. In der Folge kann verhornendes Plattenepithel in Mittelohr und Mastoid einwachsen.
Abb. 3-8 a–d. Typische Trommelfelldefekte. a, b Zentraler Defekt, nicht randständig: chronische Otitis mesotympanalis. c, d Randständiger Defekt, wie hier gezeigt zumeist epitympanal gelegen: chronische Otitis media epitympanalis, hochgradiger Cholesteatomverdacht [a, c aus Boenninghaus (1993) HNO-Heilkunde für Medizinstudenten, 9. Aufl., Springer, Heidelberg]
Abb. 3-9 a–c. Entstehung des sekundären Choiesteatoms bei chronischem Mittelohrunterdruck. a Retraktion der Pars flaccida des Trommelfells in das Epitympanon, wodurch Plattenepithel in das Epitympanon gerät. b Tiefenwachstum des Stratum corneum der Pars flaccida, Absonderung von osteoplastischen Enzymen mit beginnender Knochendestruktion. c Abgabe von Schuppen- und Hornlamellen in den vom Epithel gebildeten Hohlraum mit anschließender Superinfektion, weiterer Knochendestruktion und Übergreifen der Infektion auf den Knochen: Vollbild des Cholesteatoms mit Cholesteatomsack.
1. Invaginierte Pars flaccida
2. Hammerband
3. Epitympanon
4. Hammer
Weitere Vorstellungen zur Entstehung sind:
Bei chronischer Tubenventilationsstörung mit chronischem Unterdruck (s. Abb. 3-9) neigt die Pars flaccida zur Retraktion ins Epitympanon (Kuppelraum), wodurch Plattenepithel in den Kuppelraum des Mittelohrs gerät.
Traumatische Verlagerung von verhornendem Plattenepithel.
Bei primärem und sekundärem Cholesteatom breitet sich das Plattenepithel im Hohlraum von Mittelohr und Mastoid aus und bildet dadurch eine Sack mit glatter oder sich fingerförmig ausbreitender Oberfläche. In das Innere des Sackes sondert das verhornende Plattenepithel seine Hornschuppen ab. Nach außen gibt es osteoklastische Enzyme ab. die den dem Cholesteatom anliegenden Knochen zerstören. Fast immer kommt es zusätzlich zu einer Superinfektion mit Problemkeimen (Pseudomonas, Proteus, Pyocyaneus, E. coli), so daß der knochenzerstörende Prozeß eitert. Man spricht daher auch von einer chronischen Knocheneiterung.
Klinik: monate- bis jahrelange Schwerhörigkeit, bei den meisten Patienten rezidivierende schleimig-eitrige Sekretion mit sehr unangenehmem Fötor. Alarmsignal für eine akute Komplikation. Zusätzliches akutes Auftreten eines oder mehrerer der Symptome Schwindel, Erbrechen, Fazialisparese, Ertaubung, Fieber, Schüttelfrost oder Benommenheit.
Diagnostik: randständige Perforation (Ausnahme: okkultes Cholesteatom, Abb. 3-10), fast immer epitympanal (Pars flaccida, s. Abb. 3-8a), sehr selten in der Pars tensa. Häufig, aber nicht immer, lassen sich durch die Perforation die Schuppen des Cholesteatoms erkennen.
In einem Teil der Fälle wird der Blick auf die Schuppen durch eine Kruste oder einen Schleimhautpolypen verdeckt. Fast immer bestehen Schalleitungsschwerhörigkeit und in der Regel rezidivierende eitrige Otorrhö mit z.T. monatelangen beschwerdefreien Intervallen. Röntgen (Schüller): Pneumatisationshemmung, z.T. sichtbarer Knochendefekt mit Cholesteatomhöhle.
Abb. 3-10. Primäres Cholesteatom hinter intaktem Trommelfell (okkultes Cholesteatom)
Komplikationen: Schwerwiegende, z.T. lebensbedrohliche Komplikationen können auftreten (Abb. 3-11), z.B.
Zerstörung von Gehörknöchelchen mit Schalleitungsschwerhörigkeit,
Zerstörung des Innenohrknochens mit Einbruch in Cochlea und/oder Vestibular-apparat; Folgen: Labyrinthfistel, Labyrinthitis (s. Abschn. 4.4.2);
Zerstörung des knöchernen Fazialiskanals; mögliche Folge: periphere Fazialisparese (s. Abschn. 6.1.2.7);
Zerstörung der knöchernen Schädelbasis zur mittleren oder hinteren Schädelgrube; mögliche Folgen: otogene Sinusthrombose, epidurales Empyem, otogene Meningitis, otogener Himabszeß, Hydrozephalus oder Sepsis (s. Abschn. 3.3).
Die otogenen Komplikationen werden in Abschn. 3.3 ausführlich beschrieben.
Therapie: Eine operative Entfernung des Cholesteatoms ist absolut indiziert. Bei einer Komplikation erfolgt sie als Sofortoperation. Die Operation besteht aus 2 Hauptteilen:
1. radikale operative Entfernung von Cholesteatom und entzündetem Knochen aus Mittelohr und Mastoid,
2. Tympanoplastik: In vielen Fällen erfolgt zur Wiederherstellung des Hörvermögens eine Tympanoplastik mit Wiederherstellung von Trommelfell und Gehörknöchelchenkette. Es gibt verschiedene Typen von Tympanoplastiken (Abb. 3-12a–e), die im Kasten IV dargestellt werden.
Zusätzlich erfolgt die perioperative Verabreichung liquorgängiger Antibiotika sowie die Behandlung einer gestörten Tubenfunktion (Abschn. 3.1). Falls die Operation nicht zu einer Hörverbesserung führt, bei beidseitiger Schwerhörigkeit Hörgerät (s. Kasten VI) oder elektronisches Hörimplantat (s. Kasten VII).
Abb. 3-11. Typische Komplikationen des Cholesteatoms durch Knochendestruktion:
1 Zerstörung der Gehörknöchelchen, Schalleitungsschwerhörigkeit;
2 Zerstörung des knöchernen Fazialiskanals, Fazialisparese;
3 Einbruch in das Labyrinth, Labyrinthitis;
4 Einbruch in den Sinus sigmoideus, Sinusthrombose und Thrombophlebitis;
5 Einbruch in die mittlere Schädelgrube, Meningitis;
6 Einbruch in die mittlere Schädelgrube, Hirnabszeß, Enzephalitis;
7 Einbruch in die hintere Schädelgrube, Kleinhirnabszeß
Prognose: Ohne Operation werden eine oder mehrere der obengenannten z.T. lebensgefährlichen otogenen Komplikationen auftreten. Nach einer Operation besteht eine gute Prognose, das Hörvermögen kann in den meisten Fällen verbessert werden.
Abb. 3-12. Die wichtigsten Tympanoplastiktypen (vgl. Kasten) [a, b, e mod. nach Becker et al. (1989) HNO-Heilkunde, 4. Aufl., Thieme, Stuttgart; c, d nach Boenninghaus (1993) HNO-Heilkunde für Medizinstudenten, 9. Aufl., Springer, Heidelberg]
Beim Diabetiker sind besonders schwere Verlaufsformen mit gehäuft auftretenden Komplikationen sowie ein gestörter postoperativer Heilungsverlauf möglich.
3.2.3.3 Kongenitales Cholesteatom des Felsenbeins
Definition: Das sehr seltene kongenitale Cholesteatom entsteht aus ektodermalem, durch embryonale Keimversprengung in die Felsen-beinspitze gelangten Epithel. Das Trommelfell bleibt intakt, dadurch handelt es sich um ein okkultes Cholesteatom.
Ätiologie und Pathogenese: Das ektopische Plattenepithel verhält sich genau so wie beim erworbenen Cholesteatom des Mittelohrs und führt zu denselben z.T. lebensbedrohlichen Komplikationsmöglichkeiten.
Klinik: Keine Ohrsekretion, ansonsten wie beim erworbenen Cholesteatom. Aufgrund des intakten Trommelfells bei gleichzeitiger Lokalisation in der Felsenbeinspitze wird das kongenitale Cholesteatom nicht selten erst spät bei beginnender intrakranieller Komplikation erkannt. Bei Durchbruch des Cholesteatoms durch die Felsenbeinspitze kann bevorzugt ein Gradenigo-Syndrom (Abschn. 3.3.5) entstehen.
Diagnostik: intaktes Trommelfell, kein Trommelfelldefekt, ansonsten wie beim erworbenen Cholesteatom.
Therapie: wie beim erworbenen Cholesteatom.
3.2.4 Tympanosklerose, Tympanofibrose und Cholesteringranulom
Diese Krankheitsbilder sind Sonderformen der chronischen Mittelohrentzündung:
Tympanosklerose: Bildung von sklerotischen Plaques im Trommelfell und an den Gehörknöchelchen,
Tympanofibrisoe: fibrotische Organisation der chronischen Entzündung,
Cholesteringranulom: Ausfällung von Cholesterinkristallen;
Mischformen sind häufig.
Pathogenese: Sowohl bei chronischer Tubeninsuffizienz als auch bei chronischer Otitis media meso- oder epitympanalis kann eine Metaplasie der Mittelohrschleimhaut induziert werden, die durch eine Umwandlung des Mukoperiosts des Mittelohrs in eine aktive respiratorische Mukosa gekennzeichnet ist. Sie produziert Schleim, Entzündungsmediatoren, Proteasen und Antikörper. Die Produkte können narbig fibrosieren (Tympanofibrose) und sklerosieren (Tympanosklerose) oder zur Ausfällung von Cholesterin in Schleimhautzysten führen (Cholesteringranulome). Die Folge ist eine teilweise oder vollständige Versteifung der Gehörknöchelchenkette und des Trommelfells. Daneben ist eine Lockerung der Gelenke zwischen den Ossikeln mit gelegentlich narbiger Ankopplung möglich, wodurch die Schallenergie innerhalb der Kette verbraucht wird.
Klinik: monate- oder jahrelange Schwerhörigkeit.
Diagnostik: Schalleitungsschwerhörigkeit. Bei gleichzeitig bestehender chronischer Otitis media Trommelfelldefekt. Bei Tympanosklerose graue, harte sklerotische Plaques im Trommelfell; bei Cholesteringranulom bläulich durch das Trommelfell hindurchscheinende Verfärbung, z.T. vorgewölbt.
Therapie: Möglichst Tympanoplastik (s.u. Kasten); falls nicht möglich, bei beidseitiger Schwerhörigkeit Hörgerät (s. Kasten VI) oder Knochenleitungsimplantat (s. Kasten VII).
Kasten IV:
Hörverbesserung bei chronischer Mittelohrentzündung
Tympanoplastik. Das Prinzip der Tympanoplastik ist die Wiederherstellung des Hörvermögens nach Entfernung der Entzündung. Dabei sollen die Pauke vollständig belüftet, das Trommelfell verschlossen und eine funktionsfähige Gehörknöchelchenkette (intakt oder rekonstruiert) hergestellt werden. Tympanoplastiken werden mikrochirurgisch durchgeführt. Ohrchirurgen waren die Erfinder der Mikrochirurgie.
Die 4 wichtigsten Tympanoplastiktypen nach Wullstein:
Tympanoplastik Typ I: Rekonstruktion des Trommelfells (Myringoplastik) durch Transplantation von Faszie, Perichondrium oder Knorpel (Abb. 3-12a).
Tympanoplastik Typ II: Natürliche oder nahezu natürliche Rekonstruktion der Gehörknöchelchenkette, z.B. durch Knorpeltransplantation.
Tympanoplastik Typ III: Wiederherstellung der Schallübertragung durch eine verkürzte Verbindung zwischen Trommelfell und Steigbügel. Beispiel in Abb. 3-10c bei fehlendem Amboß: Transplantation eines allogenen Spenderamboßkörpers oder Implantation künstlicher Gehörknöchelchen (z.B. aus biokompatibler Keramik oder aus Titan) zwischen Steigbügel und Hammer (sog. Steigbügelüberhöhung). Bei fehlendem Hammer und Amboß Auflegen des Trommelfells auf den Steigbügel (klassischer Typ III in Abb. 3-12b) oder Steigbügelüberhöhung wie in Abb. 3-12c. Bei fehlenden Steigbügelschenkeln Transplantation eines Amboßteils oder einer Keramik oder Titan zwischen Steigbügelfußplatte und Hammer; bei Fehlen des Hammers Trommelfell. Man spricht von einer Kolumella (Abb. 3-12d).
Tympanoplastik Typ IV: Bei Zerstörung aller Gehörknöchelchen wird das Trommelfell so mit dem Knochen zwischen dem ovalem und runden Fenster verklebt, daß die Schallwellen nicht mehr zum runden Fenster gelangen können (Abb. 3-12e). Dadurch wird eine Schallprotektion des runden Fensters erreicht. Der Schall tritt durch das freiliegende ovale Fenster in das Innenohr ein, wobei aufgrund der Schallprotektion des runden Fensters das runde Fenster ausweichen kann. Die physiologische Schallübertragung (Impedanzanpassung) durch die Gehörknöchelchen auf das ovale Fenster fehlt jedoch. Es bleibt ein Hörverlust von ca. 25 dB Schalleitungskomponente.
Hörgerät. Bei unzureichendem Hörerfolg (in ca. 20% nach operativ sanierter Entzündung) kann ein Hörgerät verordnet werden. Einzelheiten sind in Kasten VI in Abschn. 4.1.1.3 dargestellt.
Elektronisches Hörimplantat. Statt eines Hörgerätes können ein Knochenleitungsimplantat oder ein implantierbares Hörgerät implantiert werden.
3.3 Otogene Komplikationen
U. Koch
3.3.1 Otogenes epidurales Empyem
Definition: Abszeßbildung zwischen Felsenbein und Dura.
Ätiologie und Pathogenese: Extradurale Empyeme entstehen durch unmittelbar angrenzende Ostitits u.a. als Folge akuter Otitis media, Mastoiditis oder ausgedehnter Cholesteatome.
Klinik: Ausgedehnte Empyeme ähneln in ihrer Symptomatik dem Erscheinungsbild der Hirnabszesse (s. Abschn. 3.3.4). Meist handelt es sich jedoch um intraoperative Zufallsbefunde ohne vorangegangene charakteristische klinische Zeichen, die über den Primärbefund (Mastoiditis, Cholesteatom) - der zur Operationsindikation führte - hinausgehen (s. Abschn. 3.3.4).
Diagnostik: Bei entsprechendem Verdacht hochauflösendes CT des Felsenbeins, da eine Röntgenaufnahme nach Stenvers nicht ausreicht.
Differentialdiagnose: Epidurale Empyeme in unmittelbarer Nachbarschaft des Temporallappens oder der Kleinhirnhemisphäre können mit Hirnabszessen verwechselt werden.
Therapie: Mastoidektomie (s. Abb. 3-7) mit Freilegen der Dura im Bereich der hinteren oder mittleren Schädelgrube, Drainage, intravenöse Antibiotikatherapie
3.3.2 Otogene Meningitis
Definition: bakterielle Entzündung der Leptomeningen.
Ätiologie und Pathogenese: von den Mittelohrräumen oder dem Labyrinth fortgeleitete bakterielle Infektion.
Mögliche Ausbreitung der Entzündung über:
präformierte Wege (z.B. angeborene Knochendestruktionen, Diploevenen),
Ductus endolymphaticus vom Labyrinth aus,
lokale Verbindung bei Schläfenbeinosteomyelitis oder maligner Otitis externa,
laterobasale Frakturen mit Duraeinriß,
Cholesteatome mit Arrosion der knöchernen Otobasis.
Häufigkeit: 0,15%
Klinik: Nach protrahiertem oder auch anbehandeltem Verlauf einer akuten Otitis media oder Mastoiditis entwickeln sich über wenige Stunden akut Kopfschmerzen, Mattigkeit, Fieber und schließlich Nackensteife mit Bewußtseinstrübung.
Diagnostik: Otoskopie ist nicht immer richtungsweisend, daher neurologische Untersuchung mit Lumbalpunktion; hochauflösendes Felsenbein-CT. Bei entsprechendem Allgemeinzustand Reintonaudiogramm und Lärmtrommel, um evtl. Ertaubung festzustellen.
Komplikationen: Ertaubung, Labyrinthausfall, Fazialisparese.
Differentialdiagnose: Komplikationen der akuten Mastoiditis mit schmerzhafter Einschränkung der Kopfgelenk- und Halswirbelsäulenbeweglichkeit, Bezold-Mastoiditis (s. Abschn. 3.2.1.6).
Therapie: intravenöse Antibiotikatherapie (Blut-Liquor-Schranke!). Operative Sanierung mit Mastoidektomie und Freilegen der Dura (wegen Hirnödemgefahr in der Akut-phase oft nicht möglich).
3.3.3 Otogene Sinusthrombose und otogene Sepsis
Definition: entzündungsbedingte intravasale Thrombosierung des Sinus sigmoideus durch fortgeleitete Entzündungen der Mittelohr-räume. Bei hämatogener Streuung Entstehen einer otogenen Sepsis.
Ätiologie: meist durch Übergreifen einer akuten Mastoiditis oder eines ausgedehnten Cholesteatom Thrombosierung des Sinus sigmoideus. Bei Kindern mögliche otogene Thrombosierung des Bulbus venae jugularis durch eine fortgeleitete akute Otitis media.
Mögliche Superinfektion des Thrombus. Durch potentielles Abschwemmen des thrombotischen Materials Gefahr der hämatogenen Streuung und Entstehung einer otogenen Sepsis.
Klinik: Klinische Zeichen sind bestimmt durch die akute Otitis media oder Mastoiditis sowie die im späteren Verlauf entstehende Septikopyämie mit septischen Temperaturen und Schüttelfrost. Die einseitige, nichtentzündliche Thrombosierung des Sinus sigmoideus ist klinisch stumm. Im Vergleich zur otogenen Meningitis oder zum otogenen Hirnabszeß kann die otogene Sinusthrombose klinisch blande verlaufen.
Diagnostik:
Otoskopie,
hochauflösendes Felsenbein-CT: In den meisten Fällen ist die Thrombosierung zwischen Bulbus venae jugularis und Sinus petrosus superior erkennbar;
Angiographie unter besonderer Berücksichtigung der venösen Einflüsse,
evtl. auch MR (magnetic resônance)-Angiographie.
Komplikationen: Bei Ausdehnung der Thrombosierung in den Sinus petrosus inferior kann es zum Gradenigo-Syndrom (s. Abschn. 3.3.5) kommen. Weitere Komplikationen sind die Septikopyämie, metastatische Abszesse, vor allem pulmonal, die Meningitis und der Kleinhimabszeß.
Differentialdiagnose: akute Mastoiditis, da bei einer Thrombosierung der venösen Emissarien des Mastoids eine Schwellung über dem Mastoid möglich ist. Kongenitale Atresie oder Hypoplasie des Sinus sigmoideus und der Venae jugularis interna.
Therapie: intravenöse Antibiotikatherapie, Antikoagulantien. Bei vollständiger Throm-
bosierung Notfallindikation zur Mastoidektomie und Freilegung des Sinus sigmoideus, Eröffnen des Sinus, Entfernen des infizierten Thrombus und Austamponieren des Sinus.
3.3.4 Otogener Hirnabszeß
Definition: Abszeßbildung innerhalb des Hirnparenchyms oder subdural.
Ätiologie: fortgeleitete bakterielle Infektion aus den Mittelohrräumen,
meist Folge und typische Spätkomplikation beim Cholesteatom,
seltene Folge einer offenen Schädel-HirnVerletzung oder Felsenbeinfraktur,
in seltenen Fällen ist die Fortleitung über das Innenohr möglich.
Pathogenese: Nach Eindringen der Erreger in die Hirnsubstanz entsteht im Rahmen der initialen enzephalitischen Reaktion eine fokale Nekrose mit Hyperämie und Ödem. Danach Abgrenzung des Abszesses durch Fibrose mit Narbenbildung. So entsteht der abgekapselte, demarkierte Hirnabszeß.
Klinik: Häufig ist das gestörte Allgemeinbefinden einziges klinisches Zeichen. Fieber ist beim Hirnabszeß relativ selten. Bei erhöhtem Hirndruck Kopfschmerzen, evtl. Übelkeit mit Erbrechen. Bewußtseinsstörungen und Augenhintergrundveränderungen finden sich nur im fortgeschrittenen Krankheitsstadium. Bei Herdzeichen eines Hirnabszesses ist die Lokalisation entscheidend. Hier muß unterschieden werden zwischen Schläfenlappen-und Kleinhimabszeß:
– Schläfenlappenabszeß: Sprachstörungen (anamnestische und sensorische Aphasie), epileptiforme Krämpfe der Gegenseite, Hirnnervenlähmungen (I–VIII), Gesichtsausfälle; selten sind Hörstörungen und ein Nystagmus zur Gegenseite.
– Kleinhirabszeß: Häufigstes Symptom ist die zerebelläre Gleichgewichtsstörung, so daß der Spontannystagmus zur kranken Seite wichtigstes Symptom des Kleinhirnabszesses ist.
Diagnostik: Neurologische Untersuchung u.a. mit EEG und Liquordiagnostik: Typische Liquorveränderungen beim Hirnabszeß gibt es nicht. Häufig findet sich eine Eiweißvermehrung, nur selten eine geringe Zellvermehrung. Das hochauflösende CT läßt typische Zeichen des Hirnabszesses mit hyperdenser Randzone und hypodensem Zentrum mit perifokalem Ödem erkennen.
Ophthalmologische Untersuchung: z.B. Gesichtsfeld, Okulomotorik.
Neurootologische Untersuchung: Unter der Frenzel-Brille oder im ENG häufig grobschlägiger Spontannystagmus zur Herdseite. Der Lagenystagmus ist meist divergent, grobschlägig, mittelfrequent und unerschöpflich.
Durch das ENG ist eine weitere differentialdiagnostische Abgrenzung von peripherem und zentralem Schwindel möglich.
Komplikationen: bei Ausbreitung oder Kapselruptur des Abszesses akute purulente Enzephalitis, Ventrikelruptur oder Hirnödem.
Differentialdiagnose: tumoröse Neubildung (z.B. Glioblastom).
Therapie: intravenöse Antibiotikatherapie. Nach Konsolidierung des Allgemeinzustands operative Sanierung der Mittelohrräume; evtl. Abszeßeröffnung über die Operationshöhle. Abgekapselte Abszesse sollten durch den Neurochirurgen möglichst total exstirpiert werden.
3.3.5 Pyramidenspitzeneiterung
Definition: eitrige Einschmelzung im Bereich der Pyramidenspitze.
Ätiologie und Pathogenese: Bei frühzeitiger Erkennung und Behandlung ursächlicher Entzündungen des Ohres (Cholesteatom, Mastoiditis) wird die Pyramidenspitzeneiterung nur selten gesehen. Sie entsteht beim gut pneumatisierten Warzenfortsatz durch Übergreifen bakterieller Infekte der Mittelohrräume auf die paralabyrinthären Zellen mit umschriebener Ostitits und Knochennekrose im Bereich der Pyramidenspitzenzellen.
Klinik: In der Tiefe lokalisierter Kopfschmerz, klinisches Bild der akuten oder chronischen Mastoiditis, Ertaubung und Schwindel, Gradenigo-Syndrom:
Abduzensparese,
Trigeminusneuralgie und
selten Okulomotoriusparese.
Diagnostik: hochauflösendes CT des Felsenbeins. Röntgenaufnahme des Felsenbeins nach Stenvers allein ist nicht ausreichend!
Komplikationen: Meningitis der mittleren oder der hinteren Schädelgrube, epiduraler Abszeß (s. Abb. 3-13). Selten kommt es zur Ausbreitung entlang der Arteria carotis interna mit Entstehung eines Paraphayryngealabszesses.
a
b
Abb. 3-13. a Kernspintomographie bei otogenem Hirnabszeß. b Sektionspräparat nach Tod durch Hirnabszeß
Differentialdiagnose: Epidermoid, Meningeom der Felsenbeinspitze und selten maligne epitheliale Tumoren, die wahrscheinlich von Epidermoiden ausgehen.
Therapie: Mastoidektomie mit Ausräumung auch der paralabyrinthären Zellen, ggf. mit translabyrinthärem Vorgehen oder transtemporal-extraduralem Zugang zur Felsenbeinspitze.
3.3.6 Fazialisparese
(s. Abschn. 6.1.2.7 u. 8.1.4) Labyrinthitis (s. Abschn. 4.4.2)
3.4 Spezifische Entzündungen
U. Koch
3.4.1 Ohrtuberkulose
Definition: durch Tuberkelbakterien verursachte granulomatöse Entzündung des Mittelohrs.
Ätiologie: durch Fortleitung einer bestehenden Infektion über den Nasopharynx und die Tuba Eustachii, selten auch hämatogen.
Häufigkeit: ca. 0,6%
Klinik: schmerzlose Otorrhö, Schalleitungsschwerhörigkeit.
Diagnostik: Wegweisend für die Erkennung sind zahlreiche nebeneinander bestehende Trommelfellperforationen. Ohrabstrich und Tierversuch; hochauflösendes Felsenbein-CT.
Komplikationen: Ausgedehnte ostitische Einschmelzungen können eine Fazialisparese, einen subperiostalen Abszeß oder eine Labyrinthitis verursachen.
Therapie: ohrchirurgische Sanierung und anschließend tuberkulostatische Therapie.
3.4.2 Aktinomykose, Toxoplasmose und Brucellose
Definition: Infektionskrankheiten des Mittelohrs mit granulomatöser Reaktion der Mittelohr- und Mastoidschleimhaut.
Erreger: Actinomyces israelii (meist Mischinfektion), Toxoplasma gondii, Brucella melitensis.
Klinik: Das klinische Erscheinungsbild entspricht einer chronischen Otitis media mit fötider Otorrhö.
Diagnostik: Ohrabstriche führen häufig nicht zur Diagnose. Intraoperativ sind Biopsien auch für mikrobiologische Untersuchungen zu entnehmen.
Komplikationen: Die Komplikationen entsprechen denen der Ohrtuberkulose. Rezidive sind häufig.
Differentialdiagnose: Mittelohrtuberkulose, M. Wegener, Neoplasien des Mittelohrs und des Gehörgangs, maligne Otitis externa.
Therapie: antibiotische Vorbehandlung, wenn bereits präoperativ die Diagnose bekannt ist. Operative Sanierung von Mittelohr und Mastoid.
3.4.3 Mittelohrlues(-syphilis)
Definition: Die Syphilis kann sich im äußeren, mittleren und inneren Ohr manifestieren; eindeutig am häufigsten ist jedoch der Befall des Innenohrs und des Hörnervs.
Ätiologie: Bei einer Lues sowohl im Sekundär- als auch Tertiärstadium finden sich im Bereich der Mittelohrräume papilläre Effloreszenzen der Schleimhaut und exostosenähnliche Knochenwucherungen mit periostitischen Verdickungen sowie granulierende und nekrotisierende Veränderungen, vor allem im Bereich der Gehörknöchelchenkette, im Warzenfortsatz selten ostitisch-gummöse Prozesse.
Klinik: fötide Otorrhö ohne Schmerzen; Schwerhörigkeit.
Diagnostik: Otoskopisch ist das Trommelfell im Sekundärstadium gelegentlich im Sinne einer Myringitis verändert. Suspekt sind multiple Trommelfelldefekte; ein typischer otoskopischer Befund besteht jedoch nicht. Im Audiogramm Schalleitungsschwerhörigkeit meist mit einer Innenohrbeteiligung. Hochauflösende Computertomographie des Felsenbeins und Luesserologie.
Differentialdiagnose: Mittelohrtuberkulose, M. Wegener, Brucellose und Neoplasien des Mittelohrs und des Gehörgangs.
Therapie: Penizillin, bei ausgedehnten granulierenden und nekrotisierenden Veränderungen zusätzlich otochirurgische sanierende Maßnahmen.
3.5 Knochenerkrankungen
U. Koch
3.5.1 Otosklerose
Definition: herdförmiger, selten auch diffuser, nichtentzündlicher Umbau des Labyrinthknochens.
– Eine „klinische Otosklerose“ liegt dann vor, wenn otosklerotische Herde zu einer Innenohrschwerhörigkeit oder (häufiger) zur Ankylose des Steigbügels und damit zur Schalleitungs-(Mittelohr-)schwerhörigkeit führen.
– Eine „subklinische histologische Otosklerose“ umfaßt alle Herde am Labyrinthknochen, auch wenn sie klinisch symptomfrei ablaufen.
– Das Verhältnis von klinischer Otosklerose zur subklinischen histologischen Otosklerose beträgt 1:10.
Ätiologie: Die genaue Ursache der Otosklerose ist bis heute unbekannt. Mineralstoffwechselstörungen werden diskutiert. Eine familiäre Häufung ist bei ca. 50% der Patienten zu beobachten, ein dominanter Erbgang wahrscheinlich. Hormonelle Einflüsse während der Schwangerschaft sind insbesondere bei der klinische Otosklerose erwiesen.
Bei allgemeinen ossären Erkrankungen mit Knochenbrüchigkeit, z.B. Van-der-Hoeve-Syndrom (Osteogenesis imperfecta, blaue Skleren, Schwerhörigkeit) sowie Ostitis deformans (Morbus Paget) finden sich otoskleroseähnliche Veränderungen im Bereich der Labyrinthkapsel, insbesondere der ovalen Fensternische.
Nach den klinischen Beobachtungen sind Frauen wesentlich häufiger als Männer betroffen. Die Otosklerose kann beim Erwachsenen in jedem Lebensalter auftreten, in der Kindheit wird sie sehr selten angetroffen.
Bei der weißen Rasse findet sich eine subklinische histologische Otosklerose in 8-10%, eine klinische Otosklerose in ca. 1%.
Pathogenese: Der otosklerotische Herd entwickelt sich aus der enchondralen Schicht des Labyrinthknochens. Osteoklasten führen zur Resorption von Knochen, in den entstandenen Knochenlücken wird fibröses Bindegewebe eingelagert. Überwiegend durch Osteoklasten wird ein neuer geflechtartiger Knochen (spongiöser Knochen) gebildet, der wiederum durch gefäßärmeren, wesentlich kompakteren Knochen ersetzt wird (Geflechtknochen). An- und Abbauvorgänge verlaufen nebeneinander. Der spongiosaähnliche Knochen wird als „aktiver Herd“, der daraus hervorgehende kompakte Knochen als „inaktiver Herd“ bezeichnet.
Zusammengefaßt besteht bei der Otosklerose eine Stoffwechselstörung im Labyrinthknochen mit einem Ungleichgewicht von Knochenresorption und Knochenneubildung. Otosklerotische Herde finden sich vor allem im Bereich der ovalen Fensternische (Fixation des Steigbügels, Abb. 3-14), seltener am runden Fenster (meist symptomfrei).
Herde im Bereich der Cochlea bzw. Cochleakapsel werden als Ursache für Schallempfindungsschwerhörigkeit bei der Otosklerose angesehen (Kapselotosklerose).
Klinik: Schwerhörigkeit, einseitig oder beidseitig, nimmt in der Regel langsam, anfänglich fast unbemerkt zu. Auch schubartige Hörverschlechterungen (vor allem bei Frauen in der Schwangerschaft und Menopause) werden beobachtet, dabei ist ein Ohr meist stärker betroffen.
Abb. 3-14. Otosklerotischer Herd der Labyrinthkapsel, der den Steigbügel erfaßt hat
Neben der Schwerhörigkeit findet sich in der Mehrzahl der Fälle gleichzeitig ein Ohrgeräusch (Tinnitus). Meist werden diese Ohrgeräusche (Rauschen, Brummen, überwiegend pulssynchron) als unangenehmer als die Schwerhörigkeit empfunden.
Bei der Paracusis Willisii (ca. 50%) wird bei Umgebungslärm relativ besser gehört; wahrscheinlich dadurch bedingt, daß die für den Normalhörigen als störend empfundenen tieffrequenten Nebengeräusche nicht wahrgenommen werden.
Diagnostik:
– Otoskopie: normales Trommelfell, gelegentlich Durchschimmern von rötlicher (gefäßreicher) Promontorialschleimhaut bei aktiven Otoskleroseherden (Schwartze-Zeichen).
– Tonschwellenaudiometrie: Je nach Lokalisation der Otoskleroseherde finden sich folgende Formen der Schwerhörigkeit:
reine Schalleitungsschwerhörigkeit,
kombinierte Schalleitungs-/Schallempfindungsschwerhörigkeit,
reine Schallempfindungsschwerhörigkeit.
Meist findet sich eine Schalleitungs- (ca. 70%) oder kombinierte Schwerhörigkeit.
Typisch für die otosklerotisch bedingte Mittelohrschwerhörigkeit ist eine Verschlechterung der Knochenleitungsschwelle von maximal 15 dB bei 2000 Hz (Carhart-Senke). Die Verschlechterung der Knochenleitungsschwelle ist dabei als schalleitungs- und nicht als innenohrbedingt anzusehen.
Die zusätzliche Schallempfindungsschwerhörigkeit auch in Kombination mit der Mittelohrschwerhörigkeit ist am ehesten durch die sog. Kapselotosklerose hervorgerufen (s.o.).
Bei überwiegender Schalleitungsschwerhörigkeit:
Rinne: negativ,
Weber: Lateralisation in das betroffene (bzw. schlechter hörende) Ohr.
Bei überwiegender Schallempfindungsschwerhörigkeit (s. Diagnostik der Schwerhörigkeit, Abschn. 1.3.):
Impedanzaudiometrie: normale Tubenfunktion bei normalen Mittelohrdruckverhältnissen, Stapediusreflexe nicht auslösbar.
Röntgen: gute Pneumatisation des Warzenfortsatzes (Aufn. n. Schuller).
Differentialdiagnose:
Luxation der Gehörknöchelchenkette (Trauma)
Tympanosklerose
Hammerkopffixation
Mittelohrmißbildung
Therapie:
Operative Behandlung durch Stapesplastik (s. Kasten V): Bei Stapesfixation und ausreichend funktionsfähigem Innenohr und sofern das Gegenohr nicht ertaubt ist, sollte immer die Wiederherstellung einer intakten und beweglichen Gehörknöchelchenkette angestrebt werden. Eine Kapselotosklerose kann nicht operiert werden.
Konservativ: Die bisher bekannten medikamentösen Behandlungsversuche sowohl der Stapesfixation als auch der Kapselotosklerose haben keinen gesicherten Therapieerfolg erbracht.
Kasten V: Stapesplastik
– Stapedotomie: Nach Trommelfellaufklappung Abtragen der Steigbügelsuprastruktur (Steigbügelschenkel mit -köpfchen) und Darstellung der Fußplatte; Perforieren der Fußplatte und Einsetzen eines Kunststoffstempels (z.B. Platindraht-Teflon-Piston, Abb. 3-15), der am Amboß fixiert wird, so daß eine freie Schallübertragung zum Innenohr über die Gehörknöchelchenkette möglich ist. Dieses Verfahren ergibt neben der Stapedektomie die besten Operationsergebnisse.
– Stapedektomie: Extraktion des gesamten (mit Fußplatte) otosklerotisch fixierten Steigbügels. Entweder Abdecken des ovalen Fensters durch Bindegewebe oder Ersatz des Steigbügels durch eine Draht- bzw. Kunststoffprothese oder Einsetzen einer Drahtprothese, in die Bindegewebe eingebunden ist.
– Fensterungsoperation: Bei diesem Operationsverfahren wird ein Fenster im Bereich des horizontalen Bogengangs durch Abschleifen der knöchernen Bedeckung angelegt. Unter Umgehung der Gehörknöchelchenkette gelangt der Schall zum Innenohr; damit bleibt eine Schalleitungsschwerhörigkeit von mindestens 20 dB bestehen. Durch die Weiterentwicklung der Eingriffe am Steigbügel und ovalen Fenster hat dieses Operationsverfahren an Bedeutung verloren.
Bei der Stapedektomie und Stapedotomie wird bei normaler Innenohrleistung in über 80% der Fälle ein normales Hörvermögen erzielt (Hörverbesserung in über 90%), eine Besserung des Ohrgeräusches in ca. 50%
Abb. 3-15. Größenvergleich eines natürlichen Steigbügels (Mitte) mit einer Draht-Teflon-Steigbügelprothese und einem Streichholzkopf
Hörgeräte: Bei Stapesfixation ist die Hörgeräteversorgung (s. Kasten VI) eine Alternative zur Operation, wobei die erzielten Hörergebnisse schlechter als bei der erfolgreichen Operation sind. Im Gegensatz zur Operation ist eine positive Beeinflussung des Tinnitus nicht möglich. Bei fortgeschrittener Kapselotosklerose ist die Hörgeräteversorgung die einzige Therapie.
Prognose: Unbehandelt führt die Otosklerose zur hochgradigen, an Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit. Der zeitliche Ablauf ihrer Entstehung ist sehr unterschiedlich. Langsam progrediente sowie schubweise Hörverschlechterungen (Schwangerschaft) sind bekannt. Grundsätzlich ist die Prognose der otosklerotischen Schwerhörigkeit schlechter, je jünger der betroffene Patient ist.
3.5.2 Idiopathische Hammerkopffixation
Definition: Ausbildung knöcherner Brücken zwischen Hammerkopf und Wand des Kuppelraums oder Ankylosierung zwischen Hammer und Amboß.
a
b
Abb. 3-16. a Blaue Skleren bei Van-der-Hoeve-Syndrom. b Osteogenesis imperfecta mit Stapesfixation
Klinik: Es findet sich eine ein- oder beidseitige Schalleitungsschwerhörigkeit, bisweilen im Rahmen von Mißbildungen (Klippel-Feil-Syndrom, Wildervanck-Syndrom [Mißbildung der Mittelohrossikel mit präaurikulärer Fistel oder Ohranhängen]).
Diagnostik: normaler Trommelfellbefund. Tonschwellenaudiometrisch ergibt sich eine Schalleitungsschwerhörigkeit. Die Stapediusreflexe sind ausgefallen oder abgeschwächt. Zum Teil gehemmte Pneumatisation.
Differentialdiagnostik: s. Differentialdiagnostik der Otosklerose.
Therapie: Probetympanotomie: diagnostischer Eingriff zur Kontrolle der Pauke und Gehörknöchelchenkette, evtl. Hörverbesserung durch Abfräsen der knöchernen Brücke zwischen Hammerkopf und knöcherner Wand des Attikus oder Unterbrechung der Gehörknöchelchenkette mit anschließender Rekonstruktion als Tympanoplastik Typ III (s. Kasten IV).
3.5.3 Stapesfixation bei generalisierter Skeletterkrankung
Osteogenesis imperfecta:
– Abnorme Knochenbrüchigkeit (pathologische Frakturen)
– Häufige Kombination mit einer Schalleitungsschwerhörigkeit Van-der-Hoeve-Syndrom:
– Abnorme Knochenbrüchigkeit bei Osteogenesis imperfecta
– Blaue Skleren (Abb. 3-16a)
– Schalleitungsschwerhörigkeit
Ätiologie: Bei der Osteogenesis imperfecta besteht ein genetisch bedingter primärer Defekt in der Kollagen-Elastin-Synthese. Infolgedessen ist die enchondrale Ossifikation fehlerhaft und verzögert. Die Folge sind abnorm brüchige Röhrenknochen.
Mit der Osteogenesis imperfecta ist die Stapesfixation überdurchschnittlich häufig kombiniert (Abb. 3-16b), obwohl heute beide Erkrankungen als zwar ähnliche, aber ätiologisch unterschiedliche Krankheiten angesehen werden.
Unter dem Namen Van-der-Hoeve-Syndrom werden die Symptome Knochenbrüchigkeit, blaue Skleren und Schwerhörigkeit zusammengefaßt.
Klinik: progrediente Schalleitungsschwerhörigkeit, evtl. zusätzliche Innenohrschwerhörigkeit.
Diagnostik und Therapie: s. Abschn. 3.5.1.
3.6 Tumoren
U. Koch
3.6.1 Glomustumor des Mittelohrs
(Synonyma: nicht chromaffines Paragangliom, Chemodektom)
Definition: Glomustumoren sind die häufigsten Neoplasien des Mittelohrs. Sie gehören zu den parasympathischen Paragangliomen und zählen nach den Glomus-caroticum-Tumoren zu den zweithäufigsten extraadrenalen Paragangliomen.
Pathogenese und Klassifizierung: Sie entstehen aus Paraganglienzellen entweder im Bereich des Ramus auricularis des N. vagus (Glomus jugulare) oder im Bereich des Ramus tympanicus des N. glossopharyngeus (Glomus tympanicum). Aus otochirurgischer Sicht erfolgt die Einteilung der Glomustumoren entsprechend ihrer Lokalisation und Ausdehnung in 4 Klassen:
Klasse A: Glomus-tympanicum-Tumor (lokale Beschränkung auf das Promontorium). Klasse B: Glomus-hypotympanicum-Tumor (lokale Beschränkung auf den Paukenkeller (Hypotympanum) ohne Zerstörung der knöchernen Begrenzung des Bulbus venae jugularis).
Klasse C: Glomus-jugulare-Tumor mit Einbruch in benachbarte Strukturen der Schädelbasis.
Klasse D: Glomustumor mit intrakranieller Ausdehnung.
Klinik: Die Patienten klagen über eine zunehmende Hörminderung und pulssynchrones Rauschen.
Diagnostik: Otoskopisch scheint ein pulsierender rötlich-bläulicher Tumor durch das Trommelfell; gelegentlicher Durchbruch des Tumors durch das Trommelfell. Relativ häufiges Einwachsen in die Schädelbasis mit Hirnnervenausfällen, insbesondere von Nn. glossopharyngeus, vagus, accessorius und hypoglossus. Audiologische Untersuchung, hochauflösende Computertomographie sowie die digitale Subtraktions-Angiographie. Letztere gibt Auskunft über den Ausgangspunkt des Tumors, seine Kollateralversorgung und das Vorhandensein weiterer Tumoren, vor allem im Bereich der Karotisgabel, die mit einer Inzidenz von 10% keine Seltenheit darstellen. Darüber hinaus bietet die Angiographie die Möglichkeit der selektiven Tumorembolisation und reduziert damit wesentlich das Risiko einer Operation.
Aufgabe der Computertomographie ist vor allem die differentialdignostische Abgrenzung von einem hochstehenden Bulbus venae jugularis oder einer aberrierenden A. carotis interna im Bereich des Mittelohrs.
Trotz ihres lokal destruierenden Wachstums erscheinen sie histologisch in der Regel benigne. Bei weniger als 4% aller Glomustumoren der Schädelbasis ist eine Metastasierung zu beobachten.
Eine endokrine Aktivität wurde bislang nur sehr selten beschrieben.
Therapie: Anzustreben ist die radikale chirurgische Tumorentfernung. Eine Embolisation sollte einige Tage vor der Operation durchgeführt werden, um die Blutungsneigung intraoperativ zu verringern. Eine Bestrahlung scheitert in der Regel an der niedrigen Strahlensensibilität der Paragangliome; nur bei sehr ausgedehnten Tumoren oder stark erhöhtem Operationsrisiko wird heute auf die Bestrahlung zurückgegriffen. In Einzelfällen kann so eine Tumorregression erzielt werden.
Prognose: Die Prognose der Glomustumoren im Bereich des Felsenbeins wird vor allem durch ihre lokale Ausdehnung bestimmt. Gelingt die vollständige chirurgische Entfernung, so sind Rezidive selten.
3.6.2 Osteome
Klassifizierung: Meist handelt es sich bei den Osteomen im Ohrbereich um fibroossäre Tumoren.
Lokalisation: Man unterscheidet kleine, kompakte Osteome der Knochenoberfläche, die entweder der Kortikalis des Mastoidknochens aufsitzen oder als Exostosen im äußeren Gehörgang (Abschn. 2.3.3.2) auftreten, und Osteome in den pneumatisierten Anteilen des Felsenbeins. Diese „Höhlenosteome“ kommen besonders häufig im Bereich der Stirnhöhle, selten in den Mittelohrräumen vor.
Klinik: Die Osteome zeichnen sich durch langsames Wachstum aus und finden sich vor allem im Bereich des Warzenfortsatzes oder in der Paukenhöhle. Sie verursachen praktisch keine Beschwerden und werden meist als Zufallsbefunde röntgenologisch oder intraoperativ gefunden.
3.6.3 Riesenzelltumoren
Diese seltenen, meist gutartigen Tumoren des Schläfenbeins wachsen ausgesprochen destruierend in den umgebenen Knochen.
Klinik: Sie führen zu einer lokalisierten, meist schmerzlosen Knochenauftreibung, die als harte Schwellung hinter oder vor der Ohrmuschel auftritt. Durch Obstruktion des Gehörgangs oder durch Einwandern in die Paukenhöhle kann es zur Schalleitungsschwerhörigkeit kommen.
Diagnostik: Die Diagnose wird aufgrund der Röntgenuntersuchung und des histologischen Befundes (bindegewebige) Proliferation, ausgehend vom Periost oder Endost, gestellt.
Differentialdiagnose: M. Paget, Osteosarkom.
Therapie: Anzustreben ist die radikale Operation. Die Bestrahlung führt zwar zu einer deutlichen Verkleinerung des Riesenzelltumors, aber nicht zur Ausheilung.
3.6.4 Plasmozytom
Das solitäre Plasmozytom ist ein seltener Tumor des Ohres, der meist im mittleren Lebensalter auftritt. Bevor ein solitäres Plasmozytom diagnostiziert wird, muß abgeklärt werden, ob es sich nicht um einen Herd bei einem multiplen (generalisierten) Plasmozytom handelt.
Diagnostik: Die Beschwerden sind abhängig von der Lokalisation des Herdes der röntgenologisch als gut erkennbare Knochendestruktion auftritt („Schrotschußschädel“). Meist besteht eine chronische Ohreiterung, in fortgeschrittenen Fällen die Gefahr von Hirnnervenlähmungen, insbesondere des N. facia-lis. Entscheidend für die Diagnose ist neben dem Röntgenbefund die histologische Untersuchung.
3.6.5 Eosinophiles Granulom, Hand-Schüller-Christian-Krankheit und Abt-Letterer-Siwe-Krankheit
Alle drei Erkrankungen werden heute der Histiozytose (Retikuloendotheliose) zugeordnet. Sie sind gekennzeichnet durch eine bisher ätiologisch unbekannte lokale oder generalisierte Wucherung von Histiozyten. Die Erkrankungen unterscheiden sich lediglich in ihrem klinischen Ablauf (Lokalisation der Krankheitsherde, Schwere des Krankheitsbilds etc.).
– Eosinophiles Granulom
Das eosinophile Granulom wird als eine lokalisierte Form der Retikuloendotheliose aufgefaßt. Es handelt sich um einen herdförmigen Prozeß im Knochen, wobei meist das Schläfenbein zuerst betroffen wird. Weitere Prädilektionsstellen sind die Rippen, das Becken und die langen Röhrenknochen.
Diagnostik: Bei Befall des Felsenbeins finden sich vor allem entzündliche Veränderungen der Ohrmuschel und des Gehörgangs mit Ohrsekretion und Hörverschlechterung.
Röntgenologisch bestehen Knochen defekte im Mastoid oder im fortgeschrittenen Stadium im Bereich des gesamten Felsenbeins.
Therapie: Operation und Nachbestrahlung, evtl. Zytostatika und Kortikosteroide.
– Hand-Schüller-Christian-Krankheit
Sie tritt vor allem im Kindesalter auf. Im Gegensatz zur lokalisierten Manifestation des eosinophilen Granuloms sind sowohl die Hand-Schüller-Christian-Krankheit als auch die Abt-Letterer-Siwe-Krankheit durch generalisierte Proliferationen und deren klinische Symptomatik gekennzeichnet; im Vordergrund stehen häufig Organmanifestationen.
Klinik: Granulomatöse Herde im Bereich des Schädels können in Abhängigkeit von der Lokalisation zu Ohrsekretion, Schwerhörigkeit und bei Befall der Schädelbasis zu Hirnnervenausfällen, Diabetes insipidus (Hypophyse) und bei Befall der Orbita zum Exophthalmus führen.
Therapie: Die Therapie entspricht der des eosinophilen Granuloms.
Prognose: Die Prognose ist sehr unterschiedlich. Sowohl rasch tödlich ausgehende Verlaufsformen als auch gutartige Verläufe (evtl. mit Ausheilung) sind wie beim eosinophilen Granulom bekannt.
– Abt-Letterer-Siwe-Krankheit
Hierbei handelt es sich um eine disseminierte Form der Histiozytose. Die Erkrankung verläuft meist akut mit raschem tödlichen Ausgang.
3.6.6 Mittelohrkarzinom
Eine Abgrenzung des Mittelohrkarzinoms vom Gehörgangskarzinom ist oft sehr schwierig, da in fortgeschrittenen Stadien eine genaue Zuordnung nicht mehr möglich ist.
Wie die Gehörgangskarzinome (s. Abschn. 2.3.3.1) sind auch die Mittelohrkarzinome sehr selten.
Histologisch handelt es sich fast immer um Plattenepithelkarzinome, sehr selten um Adenokarzinome.
Pathogenese: Umstritten ist bis heute, ob chronische Reize wie bei einer Mittelohreiterung prädisponierend für ein Mittelohrkarzinom sein können.
Klinik: Im Frühstadium sind die Beschwerden uncharakteristisch (Schwerhörigkeit, Ohrsekretion). Im fortgeschrittenen Stadium sind neuralgiforme Ohrenschmerzen, Kieferklemme, Zunahme der Schwerhörigkeit (evtl. Innenohr!) oder Blutungen, Schwindel und Fazialisparese typische Symptome.
Diagnostik: Otoskopisch finden sich häufig im Gehörgang bzw. Trommelfell leicht blutende Granulationen bzw. Polypen. Die Röntgenuntersuchung zeigt vor allem im Frühstadium keine typischen Veränderungen. Ein CT ist zur Ausdehnungsbestimmung notwendig. Entscheidend ist jedoch die histologische Untersuchung.
a
b
Abb. 3-17 a, b. Mittelohrmißbildung. a Computertomographie: Man sieht Mittelohr und Mastoid, der äußere Gehörgang fehlt. b Mißgebildetes Gehörknöchelchen.
Therapie: Anzustreben ist immer das operative Vorgehen, da es der alleinigen Bestrahlung im Hinblick auf die Prognose überlegen ist. Das operative Vorgehen ist abhängig von Lokalisation und Ausdehnung des Tumors (präoperative Computertomographie). Bei ausgedehnten Karzinomen der Mittelohrräume sind neben der radikalen Operation (bis zur subtotalen Petrosektomie) die Nachbestrahlung und die „Neck-dissection“ erforderlich, da eine hohe lymphogene Metastasierungsrate besteht.
Prognose: Die Prognose bei Mittelohrkarzinomen ist relativ schlecht. Die Fünfjahresüberlebenrate wird unter 30% angegeben.
3.7 Mittelohrmißbildungen
U. Koch
Bei den Mißbildungen der Mittelohrräume finden sich vor allem Veränderungen im Bereich der Paukenhöhle, der Gehörknöchelchenkette, der Tuba auditiva und im Verlauf des N. facialis im Felsenbein (Falloppio-Kanal).
Pathogenese: Äußeres und mittleres Ohr entwickeln sich gemeinsam aus der 1. Kiemen-furche bzw. dem 1. und 2. Kiemenbogen und der 1. Schlundtasche. Die Mißbildungen des Mittelohrs treten daher nur in Ausnahmefällen isoliert, meistens jedoch in Kombination mit Mißbildungen des äußeren Ohres (s. Abschn. 2.4), seltener des Innenohrs auf.
Klinik: Bei schweren Mißbildungen des Ohres ist fast immer der knöcherne oder häutige Anteil des Gehörgangs in unterschiedlichem Ausmaß mitbetroffen; im Extremfall, z.B. bei Aplasie des Os tympanicum, fehlt der knöcherne äußere Gehörgang (Abb. 3-17a).
Im Mittelohr sind vor allem die Veränderungen im Bereich der Gehörknöchelchenkette und des Trommelfells klinisch bedeutsam. So kann das Trommelfell durch eine Atresieplatte ersetzt sein, fast immer ist dann eine fehlgebildete Gehörknöchelchenkette zu erwarten (z.B. Aplasie von Gehörknöchelchen, Fixierung der Gehörknöchelchenkette durch Knochenspangen, Fehlgestaltung und Verplumpung von Gehörknöchelchen).
Unter klinischen Gesichtspunkten lassen sich die Mißbildungen in vier Gruppen zusammenfassen:
1 kleine Mißbildung des Mittelohrs bei intaktem Trommelfell (vor allem Defekte bzw. Fixation der Gehörknöchelchenkette),
2 einfache Mißbildung, u.a. mit Stenose bzw. Teilatresie des Gehörgangs, Atresie des Trommelfells, Mißbildung der Paukenhöhle (verkleinert) und der Gehörknöchelchenkette,
3 schwere, große Mißbildung mit kompletter Atresie des Gehörgangs, mißgebildeter Paukenhöhle und Gehörknöchelchenkette, z.T. Verlaufsanomalie des N. facialis,
4 schwerste Mißbildung mit kaum angelegter bzw. fehlender Paukenhöhle, rudimentärerer Gehörgang, Mißbildung am Labyrinth und den Fensternischen.
Symptome: Leitsymptom der Ohrmißbildungen ist die angeborene Schwerhörigkeit, meistens handelt es sich durch die veränderten Gehörknöchelchen und Verhältnisse im Mittelohr um eine Schalleitungsschwerhörigkeit. Neben der Atresie des häutigen Gehörgangs kann sich eine Kombination von Mißbildungen der Ohrmuschel (z.B. Mikrotie) und auch Gesichtsdeformitäten (z.B. FranceschettiSyndrom) finden.
Diagnostik: Bei der Hörprüfung ist neben dem Reintonaudiogramm vor allem im Kindesalter die ERA (elektrische Reaktionsaudiometrie), insbesondere die Ableitung der frühen akustisch evozierten Potentiale (FA-EP), zur Beurteilung des Hörvermögens entscheidend.
Durch das hochauflösende CT können das Ausmaß und die Lokalisation, insbesondere der knöchernen Mißbildungen, festgestellt werden. Präoperativ ist immer ein Computertomogramm erforderlich.
a
b
Abb. 3-18. a Traumatische Trommelfellperforation mit blutig-imbibierten Rändern. b Amboß-Steigbügel-Luxation
Therapie: Neben dem Aufbau einer Ohrmuschel (s. Kasten II) wird eine Hörverbesserung mit Rekonstruktion des Gehörgangs und des Mittelohrs (Tympanoplastik) angestrebt. Voraussetzung ist ein funktionsfähiges Innenohr.
Bei beidseitiger Mißbildung mit einer mittel- bis hochgradigen Schalleitungsschwerhörigkeit sollte das Kind bereits vor dem ersten Lebensjahr mit Hörgeräten versorgt werden (s. Kap. 5); eine Frühoperation sollte ab dem vierten bis fünften Lebensjahr erfolgen.
Bei einer einseitigen Mißbildung sollte eine Operationsindikation von dem Schwere-grad der Mißbildung abhängig gemacht werden, da bei ausgeprägter Atresie und insbesondere Aplasie postoperativ ein normales Hörvermögen in der Mehrzahl der Fälle und somit auch ein binaurales Hörvermögen nicht erreicht wird.
3.8 Verletzungen
U. Koch
3.8.1 Felsenbeinlängsfraktur
(s. Abschn. 6.1.1)
3.8.2 Verletzungen von Trommelfell und Mittelohr
3.8.2.1 Trommelfell
Pathogenese: Zu unterscheiden sind:
direkte Verletzungen des Trommelfells (Stichverletzungen, z.B. durch Getreidehalm, Zahnstocher, Q-Tip oder durch Verbrennungen und Verätzungen, z.B. Schweißperle) sowie
indirekte Verletzungen (z.B. Schlag auf das Ohr oder Explosionstrauma), die durch Druckerhöhung im Gehörgang entstehen.
Klinik und Diagnostik: Bei einer alleinigen Trommelfellverletzung besteht einen gering-bis mittelgradige Schalleitungsschwerhörigkeit. Beim Explosionstrauma ist eine zusätzliche Innenohrschwerhörigkeit möglich (Audiogramm).
Otoskopisch findet sich eine Trommelfell-perforation, die Perforationsränder können sowohl glatt begrenzt als auch ausgefranst und z.T. eingerollt sein (Abb. 3-18a).
Therapie: Die spontane Heilungsrate bei schlitzförmiger Perforation ist relativ hoch, so daß auf operative Maßnahmen verzichtet werden kann.
Bei großen Trommelfelldefekten ist häufig eine Reinigung des Gehörgangs und Trommelfells unter dem Operationsmikroskop notwendig. Anschließend werden evtl. umgeschlagene Perforationsränder reponiert und das Trommelfell durch Silikonfolie oder Zelluloseschienen abgedeckt und damit geschient.
Bei persistierenden Defekten wird die Tympanoplastik (s. Kasten IV in Abschn. 3.2.4) notwendig.
3.8.2.2 Mittelohr- und Innenohrbeteiligung
Mittelohr
Ätiologie: Sowohl bei direkten und indirekten Trommelfellverletzungen als auch bei Felsenbeinfrakturen kann es zur Luxation der Gehörknöchelchenkette kommen (Abb. 318b).
Klinik: Typischerweise bleibt dann nach Verschwinden des unfallbedingten Hämatotympanons oder nach Schließen des Trommelfelldefekts eine Schalleitungsschwerhörigkeit bestehen.
Diagnostik: Audiometrie und Impedanzaudiometrie (Stapediusreflexe).
Abb. 3-19. Phasen der Kompression und Dekompression während des Tauchens sowie des Fliegens mit typischen Krankheitsbildern
Therapie: Tympanoplasitk mit Rekonstruktion der Gehörknöchelchenkette.
Innenohr
Selten besteht bei Verletzungen von Trommelfell und Mittelohr eine Mitbeteiligung des Innenohrs.
Pathogenese: Meistens ist sie durch Stapesluxation oder Verletzungen der Fenstermembran ausgelöst.
Klinik: Neben der Schwerhörigkeit (evtl. auch Tinnitus) Schwindel, bei erheblicher Verletzung Liquorfluß.
Diagnostik: Schalleitungs- oder kombinierte Schwerhörigkeit im Audiogramm. Bei Schwindel Spontannystagmus, evtl. Liquorfluß (s. Abschn. 6.1.2.3).
Therapie: im Rahmen einer Probetympanotomie Revision der runden und ovalen Fensternische. Infektionsprophylaxe!
3.8.3 Barotrauma
Das Barotrauma des Ohres wird durch sehr rasche Veränderungen des Umgebungsdrucks ausgelöst, bei denen die Tuba Eustachii nicht in der Lage ist, den Mittelohrdruck dem Außendruck anzupassen.
Ätiologie: Typische Beispiele sind Druckänderungen beim Fliegen oder Tauchen (Abb. 3-19). Dabei liegt oft eine dauernde oder vorübergehende (z.B. Erkältung) Tùbenpassagestörung (s. Abschn. 3.1) vor. Ein relativer Überdruck im Mittelohr (z.B. Flugzeugaufstieg, Auftauchen) kann dabei durch passive Tubenöffnung leichter ausgeglichen werden als ein relativer Unterdruck (Flugzeuglandung, Abtauchen), der eine aktive Kontraktion des Musculus tensor bzw. levator veli palatini (z.B. Schlucken, Gähnen, ValsalvaVersuch) erfordert.
Pathogenese: Ein nicht ausgeglichener bzw. permanenter Unterdruck in den Mittelohr-räumen führt zur Schleimhautverdickung und damit zur zusätzlichen Tubenfunktionsbehinderung bis zur Tubenblockade. Folgen sind eine Hyperämie, ein Ödem und Transsudation der Schleimhaut, die ebenfalls einem Druckausgleich über die Tube entgegenstehen. Neben submukösen Blutungen werden auch Blutungen in die Paukenhöhle beobachtet, ebenso seröse Ergüsse. Zerreißungen des Trommelfells treten am häufigsten beim Tauchen auf.
Klinik: Ohrenschmerzen oder Druckgefühl mit u.U. sehr heftigen Stichen. Je nach Schweregrad unterschiedliche Schwerhörigkeit mit Ohrgeräuschen, in seltenen Fällen Gangunsicherheit mit Drehschwindel.
Diagnostik:
Otoskopisch erkennt man je nach Schweregrad des Barotraumas unterschiedlich starke Trommelfelleinziehungen und Rötungen, u.U. Einblutungen, seltener Trommelfellperforationen.
Audiometrisch besteht meist eine Schalleitungsschwerhörigkeit von 20-40 dB, in schweren Fällen eine zusätzliche Innenohrschwerhörigkeit.
Ein Spontannystagmus wird selten registriert.
Differentialdiagnose: Abgrenzungen z.B. gegenüber einem blanden Paukenerguß oder der akuten Mittelohrentzündung ergeben sich aus der Anamnese.
Therapie: Ziel sollte es sein, die eingetretene Tubenblockade zu durchbrechen, z.B. versuchsweise durch Applikation abschwellender Nasentropfen bei gleichzeitigem Versuch, die Tube durchzublasen. Bei ausgeprägtem Barotrauma evtl. Parazentese.
Je nach Schmerzzustand sind Analgetika, bei eingetretener Superinfektion Antibiotika indiziert.
Prophylaxe: Vorbeugende Maßnahmen gegen das Entstehen eines pathologischen Unterdrucks im Ohr bestehen in der Anwendung abschwellender Nasentropfen, z.B. beim Landeanflug, verbunden mit sogenannten „Tubenmanövern“ wie Schlucken, Kauen, Gähnen, Valsalva-Versuch.
Prognose: Im allgemeinen heilt die Erkrankung folgenlos aus, gelegentlich wurden jedoch auch irreversible Mittelohrschäden beobachtet.
3.8.4 Elektrounfall
Ätiologie: Im Rahmen des Unfalls wird der Körper in einen elektrischen Stromkreis mit-einbezogen, wobei die Schädigung neben der Stromstärke wesentlich vom Weg des Stromflusses durch den Organismus bestimmt wird (kardiale Wirkung, Atemstillstand, Blutdruckkrisen durch Vasokonstriktion u.a.).
Pathogenese: Neben Schädigungen unmittelbar im Stromweg gelegener Organe können entfernter liegende Organsysteme z.B. durch Nebenstromschleifen oder indirekt über Störungen der Blutversorgung betroffen sein.
Dies gilt besonders für Störungen im kochleovestibulären System.
Klinik: Hitzeschäden im gesamten Ohrbereich, vor allen Dingen im Innenohr mit Ertaubung und stärkstem Schwindel durch Vestibularisausfall, Trommelfellperforationen. Störungen im Hörnerv oder weiter zentral, die ebenso wie die kochleären Störungen durch spätere degenerative Vorgänge progredient sein können.
Blitzschlagunfall
Ätiologie und Pathogenese: entspricht weitgehend dem Elektrounfall.
Klinik: Hitzeschäden im gesamten Ohrbereich, evtl. Blutungen. Hinzu kommt durch den bei anderen Elektrofällen nicht auftretenden Donner ein erhebliches Schalltrauma. Zusätzlich erleidet der Verunfallte durch Hinstürzen sehr häufig ein Schädeltrauma mit Commotio und/oder Contusio labyrinthi (s. Abschn. 6.1.2.10), so daß letztendlich der Schädigungsmechanismus nicht mehr festzulegen ist.
Symptomatik und Prognose: können sehr unterschiedlich sein.